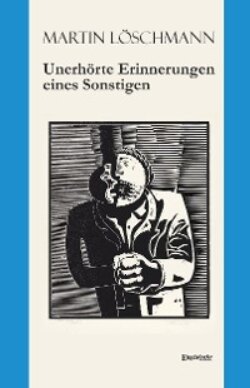Читать книгу Unerhörte Erinnerungen eines Sonstigen - Martin Löschmann - Страница 8
Familientreffen in Abwesenheit von Onkel Hugo
ОглавлениеJede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.
Alle glücklichen Familien gleichen einander.
Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi
„Du, Martin, zu deinem Begräbnis komme ich nicht und du musst auch nicht zu meinem kommen“, sagt Irla am letzten Tag der gemeinsamen Reise zu unserem Heimatdorf. Jacob Böhme stellt sich stracks ein: „Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt.“ Im ersten Moment bin ich verdutzt, flachse, wo ich hätte ernsthaft reagieren sollen: „Kommt Zeit, kommt Rat, noch ist es ja nicht so weit.“ In Wahrheit gibt die ausgesprochene Befreiung von der Begräbnisteilnahme den letzten Anstoß, in Berlin ein Familientreffen zu organisieren, bevor es zu spät ist: Irla ist die Älteste in der Löschmannfamilie und als Zeitzeugin anerkannt. Ein Treffen, keine Feier, wie Jörg und andere die Begegnung trotz meines Einspruchs immer wieder nannten, eine Begegnung mit bestenfalls katalysatorischem Effekt. Die Idee hatte es seit langem gegeben. Umbruchzeiten führen zur Besinnung auf die Familie. „Denn zu Zeiten der Not bedarf man seiner Verwandten.“ (Goethe)
Es brauchte jedoch eine lange Zeit, bis die Idee zum Durchbruch kam. Für den langen Weg bis zur Realisierung – fast 20 Jahre – gibt es verschiedene Erklärungen: Der Krieg hatte unsere Familie nicht nur dezimiert, sondern ihr auch die Existenzgrundlage entzogen. Vater, Bruder und Schwager, alle erwachsenen Männer, waren nicht zurückkehrt und der Rest der Familie in die verschiedensten Gegenden Deutschlands verschlagen. Irla kam, wie weiter oben mitgeteilt, nach Schleswig-Holstein, ihr folgte nach drei Jahren die Zweitälteste, Renate, unsere Mutter blieb mit den beiden Jüngsten, Gisela und mir, in Sachsen-Anhalt. Dort, aus dem Güterzug zermürbt ausgeladen, richtete sie sich traumatisiert, schicksalsergeben als einzige in der Ostzone ein. Der auf Grund der Entfernung einsetzende Entfremdungsprozess wurde durch den Mauerbau jäh verstärkt: Schluss mit Besuchen von Mutter und Geschwistern aus dem Osten, nun mussten die aus dem Westen uns besuchen. Außer Irla und Renate kamen keine weiteren Westverwandten nach Zeitz. Sie hatten mit dem Osten nichts im Sinn, höchstens ein Kopfschütteln parat, dass meine Mutter mit uns nicht in den Westen gegangen war, als es noch ging. Somit kann man sie getrost zu dem Fünftel der Westdeutschen zählen, die bald ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall nie in Ostdeutschland waren. Erst nach 1964, als Rentner wieder in die Bundesrepublik fahren durften, durchbrechen die Reisen der Mutter den einseitigen West-Ost-Verkehr.
Die vermauerte Teilung Deutschlands hatte unerbittliche Familieneinschnitte mit sich gebracht. Zum Beispiel die Verpflichtung, während unseres dreijährigen Finnlandaufenthaltes Ende der 60er Jahre jeglichen Briefkontakt mit Irla und Renate aufzugeben. Wir akzeptierten das Schreibverbot offiziell, hielten trotz dessen von Finnland aus wie bisher eher losen Kontakt, aber beschämend war das Verbot auf alle Fälle, zumal meine beiden Schwestern keinerlei Position mit Geheimnisträgerschaft innehatten, um in irgendeiner Weise für irgendjemanden von Interesse zu sein: Hausfrau in Hohenaspe die eine, Arzthelferin in Dortmund die andere.
Kati gehörte von Anfang an zu den Befürwortern des Treffens und setzte sich für sein Gelingen ein. „Für mich ist das Familientreffen eine stille Nachholestunde.“ Die Feststellung war umso bemerkenswerter, als unsere Tochter lange Zeit Alternativen zu dem ihr vorgelebten Familienleben gesucht hatte, raus aus dem bürgerlichen, erst recht aus dem sozialistischen. Nach Promotion und einem für die Arbeit als zugelassene Psychotherapeutin erforderlichen Zweit-, einem kostenintensiven Fernstudium in Bamberg, ist sie in Chemnitz angekommen und dieses Angekommensein schloss die Besinnung auf die Familie wohl ein. Von unseren beiden Kindern ist sie dasjenige, das einen engen Kontakt zu Anverwandten hat, zu Maren insbesondere, der Jüngeren von Giselas zwei Töchtern.
Meine Mutter unkte ein wenig herum, als 1958 die Doppelhochzeit von Irla und Gisela in Zeitz feststand. Solche Hochzeiten verhießen für sie nichts Gutes. Kinderlosigkeit wäre eine Strafe für eines der Paare, Krankheit und Tod eine andere. Sie hatte es selbst erfahren und konnte den Aberglauben nicht gänzlich beiseiteschieben: Doppelhochzeit, Erna und ihre Schwester Gertrud Krack aus Morgenstern heirateten zwei Löschmann-Brüder: Max und Hugo. Während meine Eltern fünf Kinder in die Welt setzten, starb Tante Gertrud kinderlos an Tuberkulose, zwei, drei Jahre nach der Hochzeit.
Solange meine Mutter lebte, ging es mit beiden in Zeitz getrauten Ehepaaren – Irla plus Christian Mundt und Gisela plus Wolfgang Fuhrmann – gut. Fast dreißig Jahre wohnte meine Mutter mit der Tochter zusammen, führte ihr auf weiten Strecken den Haushalt, betreute die Kinder, beaufsichtigte sie beim Lernen und Musizieren. Obwohl sie prinzipiell nicht in die Erziehung eingreifen wollte, gelang es ihr nicht, sich herauszuhalten: „Britta hast du schon …, Maren vergiss bitte nicht …, Gisela, du musst jetzt gehen, sonst kommst du zu spät.“ Vor meinem Schwager allerdings verstummte sie. Kam sie nach Leipzig zu Besuch, hielt sie sich bei uns konsequent aus allem heraus, lobte dies und jenes mit kargen Worten, vermied alles, was als Einmischung hätte aufgefasst werden können. Sie habe nicht vergessen, wie ihre Schwiegermutter sie immer wieder aufs Neue bevormundete.
Nach dem Tod unserer Mutter verfing sich mein Schwager Wolfgang in der Liebe zu einer Verlagsmitarbeiterin und verließ Gisela. Sie, die viele Jahre als Schöffin zahlreiche Ehescheidungen erlebt und beurteilt hatte, konnte es nicht fassen, dass ihre Ehe auseinanderbrach. Da half kein Reden, schon gar nicht das Verweisen auf die Vielzahl von Scheidungen um sie herum, da half keine Unterstützung: „Du kannst mit Maren zu uns kommen, bis du wieder Grund unter den Füßen hast.“ Einen langen Brief habe ich ihr geschrieben, um sie von den angedeuteten Selbstmordgedanken abzubringen und ihr als Wichtigstes die Verantwortung für ihre beiden Töchter, Maren, gerade mal 13, und Britta als Studienanfängerin in Jena auf die Familienbande besonders angewiesen, vor Augen und Seele zu führen. „Martin, wenn du mit mir sprichst, leuchtet mir ein, was du sagst, ich fasse Mut und denke, recht hat er. Aber wenn ich nach Hause komme, überfällt mich eine Dunkelheit, tut sich vor mir ein Abgrund auf, aus dem es kein Entrinnen gibt.“
Eine psychotherapeutische Behandlung hätte sicher etwas ausrichten können, doch die gab es in der DDR kaum. In der Nähe von Halle befand sich zwar eine Einrichtung, in der Suizidgefährdete erfolgreich behandelt wurden, wie wir in Erfahrung gebracht hatten, lange Wartelisten jedoch verhinderten die Aufnahme akuter, für den Aufbau des Sozialismus nicht unmittelbar relevanter Fälle. Bis zu einem Jahr Wartezeit in ihrem Fall. Dieses Jahr hätte mein Schwager mit seiner Frau gemeinsam überbrücken müssen. Sie war psychisch erkrankt, was uns und wahrscheinlich auch ihm nicht wirklich klar war. Da Wolfgang nicht die Kraft und die Entschlossenheit besaß, mit Gisela gemeinsam einen für beide dornigen Weg bis zur fälligen Psychotherapie zu finden und zu gehen, haben wir den Kontakt zu ihm abgebrochen und ihn deswegen nicht zum Familientreffen eingeladen, wie Jörg es gewünscht hatte. Die Wunde wird wohl offen bleiben. Wir erkennen unsere Schuld daran.
Nach zwei erfolglosen Suizidversuchen legte sich Gisela die Schlinge um den Hals. Für alle Hinterbliebenen ein furchtbarer Schlag, unfassbar, alles nur nicht das. Wie war sie lebenslustig, stand mit beiden Beinen sicher im Leben, leitete erfolgreich eine Buchhandlung in Halle-Neustadt, ließ uns die eine oder andere Lektüre-Bückware erwerben – Böll, Faulkner, Miller, Sartre, Stefan Zweig. Die gab es einzig und allein unter dem Ladentisch. Es konnte aber auch passieren, dass sie geschäftstüchtig unumwunden sagte: „Martin, den Hemingway kannst du nicht bekommen, ich habe da einen Kunden, der kauft deinen Hemingway plus ein Bündel von Parteiliteratur“ und dabei auf einen Stapel Broschüren zeigte, der mittels Bindfaden zusammengehalten auf den Abholer wartete. „Ich muss meine Vorgaben erfüllen.“
Buchhändlerin war ihr zweiter Beruf. In den Wochen der Umschulung an einer Fachschule in Leipzig war sie oft bei uns und wir haben in unserer Wohnung in der Springerstraße 4 trotz angestrengten Studiums eine recht lustige Zeit mit ihr verbracht. Über die Familienbande hinaus verband uns mit ihr und ihrem Mann eine feste Freundschaft. Es gab gegenseitige Besuche zu allen Gelegenheiten, wir haben tolle Feste gefeiert, gelegentlich Urlaub gemeinsam verbracht. Wir konnten uns aufeinander verlassen – Zusammenhalten der zwei jüngsten Geschwister, der durch gemeinsame Kriegs- und Nachkriegserlebnisse Geprägten, und nun diese jähe Wendung. Weshalb ich in meiner kurzen Begrüßungsrede zum Familientreffen darauf hinweise, dass uns nicht nur die gemeinsamen Gene verbinden, sondern mehr noch die gemeinsamen sozialen Erfahrungen, familienbedingte Schicksale. Die Geschwister gehören zur ersten Gruppe, in die man sich einfügen muss und dabei kann sich eine Tiefenbindung herausbilden, wie ich sie Gisela gegenüber empfunden habe.
Wochen vor dem Familientreffen deutete sich an, dass Maren mit ihren Kindern, Paul und Birte, und ihr Partner nicht kommen würden. Sie fühlte sich seit längerer Zeit nicht besonders, litt zu dieser Zeit an Depressionen, war zur Kur nicht weit von Chemnitz, von ihrer Cousine Kati entfernt. Sie sagte am Ende ab, offensichtlich wollte sie dem psychischen Druck einer solchen Begegnung aus dem Wege gehen. Sie musste erwarten, dass der Tod ihrer Mutter, meiner Lieblingsschwester, in irgendeiner Form thematisiert wird. Ich lasse den Begriff Lieblingsschwester stehen, wiewohl ich eine solche Bezeichnung lange Zeit für höchst fragwürdig hielt. Irla dagegen war eher wie eine Zweitmutter für mich.
Kati war es, die Maren nach der Verzweiflungstat ihrer Mutter aus Halle-Neustadt zu uns nach Leipzig holte. Offensichtlich unter Schock hatte Maren im Zug gepfiffen, sich verhalten, als wäre nichts passiert. Auch bei uns zu Hause zeigte sie keine Spur von Betroffenheit, geschweige denn irgendeine Art von Trauer. Vergeblich versuchten wir mit ihr ins Gespräch zu kommen, die Versuche prallten wie von einer leeren Wand ab. Ihre Mutter kam bei ihr einfach nicht mehr vor, den Platz nahm Giselas Nachfolgerin ein. Erst nach Abschluss der psychotherapeutischen Behandlung und dem Familientreffen kam sie auf uns zu, um sich nun endlich selbst ein Bild zu verschaffen.
Zu unserer Überraschung gestand sie, was uns die ganze Zeit unverständlich gewesen war, dass sie von ihrer leiblichen Mutter überhaupt keine Vorstellung mehr hatte. Wir verschwiegen ihr nicht, dass es für uns bis heute unbegreiflich ist, dass Gisela sie, ein liebes Mädchen, ein vielseitig interessiertes Kind, eine sehr gute Schülerin, mit dreizehn Jahren im Stich gelassen hatte. Immer wenn Maren mit guten Leistungen im Abitur, im Studium, im Beruf, in ihrem Unternehmen Tapir glänzte, denken wir an Gisela. Wie konntest du nur, du hättest so viel Freude an deinen Kindern und Enkeln haben können.
Britta war in diesen Vorwurf Gisela gegenüber zunächst viel weniger involviert, weil sie für uns beim Tod ihrer Mutter im Vergleich zu Maren erwachsen schien. Dabei hatte sie nicht weniger am Verlust zu tragen. Heute denke ich, sie brauchte eine Mutter noch ebenso wie Maren. Sie war auch die einzige der Familie, die über Jahre in Halle-Neustadt sowohl die Grabstätte ihrer Großmutter wie die von Gisela pflegte. Obwohl ich in den 70er Jahren wenig von Friedhofsbesuchen und kommunizierte Erinnerungen für viel wichtiger hielt, hatte ich lange Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich Britta mit den beiden Gräbern allein gelassen hatte. Beim Familientreffen spreche ich mein passiv gebliebenes Schuldgefühl an.
Auf den entscheidenden sozialen Aspekt bei der gefühlten Familienzugehörigkeit macht Olafs erste Reaktion auf das Familientreffen aufmerksam. „Ich kenne euch doch gar nicht“, lässt sich Irlas Sohn aus zweiter Ehe vernehmen. Recht hatte er, als er in der Familie aufwuchs, trennte uns die Mauer und als sie geöffnet wurde, gingen die verschiedenen Familien auf den unterschiedlichen Generationsebenen längst ihre eigenen Wege. Ausschlaggebend für Olafs Entscheidung, mit seiner Sabine am Ende zu kommen, war wohl Geralds Rat. Er, der Ehemann der vor Jahren verstorbenen Renate, meiner Schwester zwischen Irla und Gisela, kinderlos geblieben, hatte zu Olaf eine enge Bindung aufgebaut. Meinem Schwager bin ich für seinen guten Rat noch aus einem anderen Grund dankbar.
Nach dem Tode von Renate hatte Gerald jeglichen Kontakt zu mir abgebrochen und war selbst nach dem Umbruch nicht bereit, mich anzuhören. Und das kam so: Renate war stolz auf ihren Bruder, nicht zuletzt deshalb, weil er studiert hatte. Sie hatte ihn und seine Familie unterstützt, durch ‚Westpakete‘ zu Weihnachten und mitgebrachte Geschenke, wenn sie uns besuchten, z.B. zu Katis Jugendweihe Raufasertapete, Jahre später in der DDR zu haben. Als Verwandter ersten Grades hätte ich laut Gesetz die Erlaubnis bekommen müssen, an der Bestattung teilzunehmen. Nachdem ich die traurige Nachricht von Renates Tod erhalten hatte, teilte ich Gerald sofort mit, dass ich selbstverständlich kommen werde, fest der Überzeugung, man würde mich trotz des für mich derzeit bestehenden Reiseverbots nach Dortmund fahren lassen. Mitnichten. Ich lief von Pontius zu Pilatus, hatte die Unterstützung meines Direktors, Professor Hexelschneiders. Das Verbot, ins kapitalistische Ausland zu reisen, wurde für diesen Todesfall nicht aufgehoben. Anstatt den Tatbestand meinem Schwager ohne Umschweife zu sagen, gab ich aus Angepasstheit, aus Untertanengeist, Etabliertheit, Bequemlichkeit, Feigheit, Karrieredenken – ich stand kurz vor der Habilitation – nicht den wahren Grund an, sondern hielt mich an die offizielle Sprachreglung bei solchen Fällen: plötzliche Krankheit.
Gerald konnte nur schlussfolgern, der will nicht, ist zu bequem, pflichtvergessen, undankbar, ach was weiß ich; er hat mir mein Nichtkommen niemals verziehen, ich kann es ihm nicht verdenken. Er musste meine zwei Briefe nach der Wende als kläglichen Versuch empfinden, die erzwungene Absage zu rechtfertigen. Da war indes nichts zu rechtfertigen, bestenfalls ein Versagen zu erklären. Würfe mir jemand meine vorgestanzte Notlüge vor, akzeptierte ich es voll, heute noch leide ich an meiner damals geringen Zivilcourage. Man hätte mich zwar unter keinen Umständen nach Dortmund fahren lassen, jedoch hätte ich ein besseres Gewissen.
Auch Olafs Bruder Gernot gehörte wie Birge, Tochter von Ute und Gernot, von Anfang an zu den Befürwortern des Treffens. Birge wollte, obschon hochschwanger, unbedingt teilnehmen. Allein die Geburt ihrer Tochter Karoline verhindert das. Das freudige Familienereignis wird zur gelungenen, von allen Seiten begrüßten Parallelveranstaltung: „Hallo, Birge, Onkel Martin ist gerade am Ende seiner Begrüßungsrede. Gratulation zur Geburt von Karoline und wirklich alles, alles Gute für Kind, die Mutter und den Vater, schade, dass ihr nicht hier sein könnt.“ Keine Frage, Karoline war zum Baby-Star des Treffens avanciert.
„Das Familientreffen als eine Möglichkeit des Bekanntmachens und des Kennenlernens, der Zuordnung und Einordnung, des Austausches, der Aussprache, des sich Vergewisserns, des Bewusstwerdens von sozialer Vererbung, als Möglichkeit, sich mit dem Leben der Eltern, Großeltern, von Kindern und Enkeln, der Tanten und Onkel auseinanderzusetzen. Es geht nicht um Beschuldigungen, Rechtfertigungen, Verteidigung irgendwelcher Positionen, nicht um Spiegeleffekte, schon gar nicht um die Verteilung eines Lottogewinns“, schreibe ich an Jörg, weil ich ihm einsichtig machen will, worin ich den Sinn des vorerst einmaligen Treffens sehe. Mein Schreiben war notwendig geworden, weil ich seine thailändische Partnerin, jetzt seine Ehefrau, aus seiner Sicht brüsk ausgeladen hatte und er darüber so erbost war, dass er nicht teilnehmen wollte. Heike, seine damals angetraute Frau, hatte ich nämlich zuerst von allen Familienangehörigen eingeladen, sie ist die Mutter zweier unserer Enkelkinder und gehört bis heute selbstverständlich zur Familie.
Ohne es auszusprechen, hatte ich Suksan nicht in der Planung berücksichtigt. Ausschlaggebendes Argument für mich, dass sich die beiden Frauen bisher nicht über den Weg gelaufen waren, und die erste Begegnung sollte ausgerechnet bei dem Familientreffen stattfinden. Ich sah das nicht erprobte, brisante Aufeinandertreffen von Angehörigen, die sich zum Teil bislang niemals begegnet waren, unnötig belastet. Dass wir kein Problem mit Suksan hatten, wurde Jörg unmissverständlich vorsorglich gezeigt und sie schon mal zur bevorstehenden Feier zu seiner Mutters 70. Geburtstag, ein halbes Jahr darauf, eingeladen.
Jörg sah es anders und setzte uneinsichtig kraft seiner kompromisslosen Entschlossenheit ihre Teilnahme durch. Vor seiner Zusage die sattsam bekannten Vorwürfe, in diesem Fall hauptsächlich gegenüber dem Vater, Auseinandersetzungen, die wohl in keiner Familien mit Kindern fehlen. An erster Stelle meine gefühlt Äonen zurückliegende absolut deplatzierte Reaktion auf die Frage, wie ich denn seine neue Freundin Ute fände. „Das war wohl nichts“ (In seiner Erinnerung: „Dass sie wohl nix sei“), ist meine unverzeihlich unangemessene Antwort, die sich allein durch eine völlig falsche Standortbestimmung meinerseits erklären lässt: Ich hatte keinerlei Recht und Grund, meinen Maßstab anzulegen. Ute aus meiner Sicht, der eines angehenden älteren Herrn, zu beurteilen, war fraglos eine Fehlleistung. Ich hatte kaum ein Wort mit ihr gewechselt und dann diese grobschlächtige Antwort. Wie oft habe ich mich dafür entschuldigt, sie zu tiefst bedauert. Es half nichts, „denn eine Junge mit 17 Jahren vergisst nie, wenn sein Vater über eines seiner ersten Mädchen so etwas sagt – übrigens heute eine Frau, die schon vier eigene Patente angemeldet hat.“ Ich kann meine situativ unangemessene Reaktion nicht aus der Welt schaffen, dennoch kam ich nicht umhin, meinem Sohn zu schreiben: „Wenn die Liebe daran zerbricht, dass sich ein Elternteil alles andere als begeistert zum Objekt der Begierde äußert, dann kann es ja wohl nicht weit her gewesen sein mit der großen Liebe. Ich jedenfalls habe meine Mutter nicht gefragt, ob ihr mein Mädchen gefällt. Nun gut, du hast gefragt, und ich habe falsch reagiert.“
Viel mehr Zündstoff barg die Armeegeschichte. Ich, dank günstiger Umstände um einen Militärdienst herumgekommen, hatte Jörg zur Verpflichtung gedrängt, drei Jahre den ‚Ehrendienst in der Volksarmee zu leisten‘. Wie konnte ich den Jungen mit seinem empfindsamen Gemüt, seinen in der damaligen Zeit schulseitig kritisierten „individualistischen Tendenzen“ in die Zwangsjacke der Armee stecken wollen? Ja, wie konnte ich nur, und muss ich mir Vorwürfe machen oder mich gar entschuldigen? Nach den vielen Jahren wäre es gewiss keine Überwindung für mich gewesen.
Berechtigte Vorwürfe aus der Sicht meines Sohnes, obwohl sie im Laufe der Jahre in ein milderes Licht getaucht wurden. Reinigende Entschuldigungen, wie sie en vogue geworden sind, waren niemals gefragt. Um die damalige Problemlage einigermaßen korrekt zu erinnern, befrage ich den Betroffenen selber, Jahre nach dem Familientreffen und dem Entwurf dieses Kapitels. Danach stellt sich die missliche Geschichte folgendermaßen dar:
Wir waren aus Finnland und Jörg nach fast vierjähriger Unterbrechung in seine ehemalige Klasse zurückgekehrt. Trotz guter und sehr guter Leistungen hatte er aufgrund des vorgegebenen sozialen Schlüssels für die Erweiterte Oberschule gegenüber den Alteingessesenen wenig Chancen Du hast keine Chance, nutze sie! Verpflichtung nach dem Abitur, die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Im Wissen, eine solche Verpflichtung eines Dreizehnjährigen kann nicht bindend sein, wurde von uns allen der rettende Strohhalm ergriffen. Als in der 11. Klasse erneut die Verpflichtungswelle anlief, schien uns der dreijährige ‚Ehrendienst‘ ein vertretbarer Kompromiss, 18 Monate waren ohnehin nicht zu umgehen. Außerdem winkten bessere Chancen bei der Studienplatzvergabe und ein angehobenes Stipendium. Ein Außenwirtschaftsstudium wurde greifbarer. Dass es unter dem Strich nichts mit diesem Traumfach vieler Abiturienten wurde, steht auf einem anderen Blatt, es hätte mich nachdenklich stimmen müssen. Der Sohn eines Abteilungsleiters in der Bezirksleitung der Staatssicherheit mit einem Leistungsdurchschnitt von 2,4 erhält das Wunschstudienfach, nicht mein Sohn mit seinen 1,3.
Drei Jahre Armeedienst hielt ich für zumutbar, musste mich aber durch meinen Sohn eines Besseren belehren lassen. Bis zum ersten Augenzeugenbericht hatte ich ein arg geschöntes Bild von der Nationalen Volksarmee, keine Ahnung von den misslichen Zuständen. Vieles von den Schikanen der Vorgängerarmeen preußischer Couleur gehörte offensichtlich zu dem öffentlich unterschlagenen Erbe: Bei Vergehen Scheuern mit der Zahnbürste, zusätzliches Robben im Schlamm, Mitwirken beim Datschenbau des Vorgesetzten, all das, was in dem Film NVA aus dem Jahre 2005 trefflich karikiert wird. Und was ich in seiner Tragweite dann nicht unterschätzt habe: Wer bei ‚der Asche diente‘ wurde bei den Mädchen ausgegrenzt, Uniformträger waren in den Diskos nicht erwünscht.
Auf Jörg, unseren wenige Tage vor Fuhrmanns Tochter Britta Erstgeborenen hatten wir bei dem Familientreffen auf keinen Fall verzichten wollen. Kinder müssen sich von den Eltern abgrenzen, bloß nicht einen Beruf wie den eurigen hatte er entschlossen formuliert. Sein Studium Islamwissenschaften und die nachfolgende Promotion boten ihm gute Chancen sich abzusetzen. Die Inanspruchnahme von Vitamin B in Gestalt der Fürsprache von Mariannes Freundin Sara Wilsky, um einen der heißbegehrten Studienplätze bei den Regionalwissenschaften zu ergattern, schien uns angesichts des Militärdienstes durchaus vertretbar. Die Wende ließ Jörg nicht zuletzt wegen seiner Arabischkenntnisse beim Goethe-Institut in München landen, gewissermaßen setzt er unser DaF-Wirken fort.
Suksan kam mit. Der Verlauf des Treffens gab ihm Recht, meine Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Weitgehend sprachlos schwebte Su gewissermaßen unauffällig mit ihrer wohlproportionierten Mädchenfigur zwischen den anderen hin und her. Jörg konzentrierte sich weniger auf seine Partnerin, vielmehr setzte er sich umsichtig für das Gelingen des Treffens ein. Selbst Heike kam mit der Situation zurecht, die Zeit der Tränen war vergangen, und die Enkelkinder fügten sich dem Lauf der Dinge.
Ins Spannungsfeld des Treffens gehörte auch Nabil, unser Wahlsohn, über den schon an anderer Stelle geschrieben wurde. Altersmäßig zwischen uns und unseren Kindern kam er aus Mariannes allererster Gruppe, der sagenumwobenen T27, in unsere Familie und wuchs ohne größere interkulturelle Probleme in sie hinein, integrierte sich voll, übte Rechte und Pflichten eines Familienglieds aus, kümmerte sich um die Kinder, wenn wir mal nicht da waren. Der größere Bruder, der sich in der Rolle durchaus gefiel, klinkte sich gelegentlich sogar in Putzarbeiten ein, Staubsaugen seine Spezialität, das hätte er schon zu Hause gelernt.
Nabil gehört zur Familie und muss eingeladen werden. Alle waren sich einig und freuten sich sehr, als er zusagte. zweifelsohne hätte er seine Familie aus Kanada mitbringen können. Es unterblieb, zumal wir keinen nennenswerten Kontakt haben zu seiner Frau und den Töchtern, nicht einmal zu Rania, der Tochter aus der ersten Ehe mit Corinna. Corinna Harfouch dagegen kam als Überraschungsgast und bereicherte das Treffen.
Der Ablauf der Veranstaltung ist schnell berichtet: Unterbringung ‚der Auswärtigen‘ im Hotel Ibis in der Prenzlauer Allee, Brunch in unseren vier Wänden, einstündige Dampferfahrt auf der Spree durch die Berliner Innenstadt, historische Stadtmitte, Museumsinsel, Regierungsviertel und zurück; am Abend dann der Höhepunkt: Abendessen im Speisezimmer von Herr Bielig, freundliches Familienunternehmen, in Hotelnähe, Wohnzimmeratmosphäre, an der Wänden Fotos von Herrn Bieling und seinen Lebensstationen, dem Vater der beiden Betreiberinnen der Restauration. Ein Foto mit dem Namensgeber hatten wir allerdings durch mein Porträt in Öl ersetzt, auf das mich der russische Maler Bogomassov während seines vierwöchigen Besuchs 1976 als „satten Intellektuellen“ (des Malers Interpretation) gebannt hatte. Da das Porträt, das in unserer Wohnung hinter der Couch stand, den meisten unbekannt war, musste es trotz seiner eigentlich unangemessenen Größe (150 x 100) erst einmal nicht auffallen, ergab einen Gag zu späterer Stunde.
Die Gaststätte schuf von Hause aus einen angemessenen Rahmen für ein derartiges Treffen, verwies irgendwie auf den bäuerlichen Erbteil der hier Versammelten. Dass das Essen begrenzt, eher armselig daherkam, die Wirtinnen uns mit einer groben Verletzung des Preis-Leistungsverhältnisses konfrontierten, war freilich enttäuschend und gewissermaßen bloßstellend vor den lieben Verwandten. Allein der nächste Morgen richtete es mit dem Brunch im italienischen Restaurant Istoria am Käthe-Kollwitz-Platz gleich um die Ecke. Zusätzlich zur üppigen Auswahl an Gerichten stellte Marianne reichlich frischen Kaviar aus Tomsk auf den Tisch, den ich vor ein paar Tagen mitgebracht hatte.
Natürlich muss eine kurze Ansprache sein. Ich bin aufgeregt, spreche vom Sinn, von der Vorbereitung, vom Verlauf des Treffens, stelle fest, dass ich mit 14 von den Anwesenden blutsverwandt bin, zitiere, um den verdächtigen Begriff Blutsverwandtschaft zu ironisieren, Karl Kraus „Das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit“, was nicht ankommt. Den zweiten Spruch „Das Familienleben ist ein Eingriff in das Privatleben“ flechte ich erst gar nicht ein. Stelle die Altvorderen, Erna und Max Löschmann, vor, ordne mich als jüngstes und Irla als ältestes Kind ein, spreche über Dietrich, Renate und Gisela, die nicht mehr unter uns sind und alle unter uns sein könnten, wenn, ja wenn …
Nach dem Essen kommt Hesses Gedicht Stufen an die Reihe, das alle im Raum vertretenen Generationen berührt:
… und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne/Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten/An keinem wie an einer Heimat hängen/Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise/Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen/Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden/Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Anschließend darf jede Familie maximal zehn Fotos aus dem jeweiligen Familienalbum präsentieren. Die Familie von Britta und Carsten Müller aus Jena hatte die gute Idee, die enge Vorgabe 10 voll auszureizen, indem sie Collagen aus mehreren Fotos darbot.
Bei der Zusammenschau wird deutlich, dass es in unserer Familie relativ viele Lehrerinnen und Lehrer gibt und ich frage mich, ob diese Tendenz aus der früheren Wertschätzung des Berufes auf dem Dorfe herrührt. Von einem Lehrergen in unserer Familie spreche ich nicht. Der Lehrberuf kam durch Heirat in die Löschmannsche Familie. Eine Schwester meines Vaters heiratete einen Lehrer Jeschke, Paul Jeschke, der nach dem Krieg in St. Peter Ording lebte und über den eines Tages in der Hallenser Bezirkszeitung Freiheit zu lesen war, dass er die Prügelstrafe praktiziere. Da war in der DDR jegliche körperliche Züchtigung längst verboten
Irlas erster Ehemann war Lehrer, kam aus einer Lehrerfamilie und genoss bei den Schwiegereltern hohes Ansehen. Für den Sohn Gernot stand früh die Entscheidung für den Lehrerberuf fest. Tochter Birge fällt nicht weit vom Stamm: wird Lehrerin. Nichte Britta ist mit Leib und Seele Lehrerin, leitet heute eine Reformschule, schenkt uns ein Buch Ein neuer Jenaplan. Befreiung zum Lernen, in dem sie mit einem Beitrag Grundsätze vertreten ist. Wen heiratete Britta? Selbstredend einen Lehrer, Carsten Müller, Mathematiker, promoviert und Direktor eines Gymnasiums in Jena. Wen wundert es, die eine der beiden Müllers Töchter, Christiane wird Lehrerin.
Und Jörg und Kati ebenfalls in eine Lehrerfamilie hineingeboren: In Mariannes Familie gab und gibt es in jeder Generation Lehrerinnen, möglicherweise ist es hier, das Lehrergen. Antje, die Tochter von Mariannes Schwester Adelheid, setzt als Englisch- und Russischlehrerin in ihrer Linie die Tradition fort. Selbst Michael, ihr Bruder, studierte Philosoph, war er nicht kurzzeitig lehrend tätig, bevor ihn der Systemwechsel in vollkommen andere Bahnen lenkte?
Als Sohn Jörg geboren wird, studieren beide Elternteile mit dem Ziel, Lehrer zu werden, als Tochter Kati drei Jahre später das Licht der Welt erblickte, waren ihre Mutter Lehrerin für Geographie und Geschichte an einer Leipziger Tagesheimschule und ihr Vater Deutschlehrer am Herder-Institut mit der amtlichen Bezeichnung Dozent am Herder-Institut, das klang schon mal nach was.
Kati als praktizierende Psychotherapeutin wird sich bestimmt wehren, wenn ich meine, dass ihr Beruf nicht so weit entfernt vom Lehrerberuf, zumindest z.T. ein Beruf mit einem ‚Lehrauftrag‘ ist und letztlich hat auch Jörg beim Goethe-Institut immer mit Lehre zu tun.
Obwohl ein engagierter Lehrer, zog es ihn in die Kulturarbeit. Bester Beweis seine Ausstellung mit Künstlern aus Südostasien, die über Chiang Mai und Bangkok hinaus vom 22. Oktober bis 30 Januar 2005 in Berlin gezeigt wurde: Identity versus Globalisation? Die über 60 beteiligten Künstler und Künstlerinnen mit ihren Werken hatte Jörg in engen Kontakt mit ihnen ausgewählt. Als Quereinsteiger hatte er die Ausstellung kuratiert in Zusammenarbeit mit seiner Frau Heike, die 1999 die Leitung des Regionalbüros Südostasien der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Chiang Mai übernommen hatte. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Ethnologischen Museum tritt uns Dr. Jörg Löschmann als Kurator entgegen und gibt eine Einführung in die zeitgenössische Kunst aus Südostasien. Nach dem offiziellen Teil raunt uns eine Expertin ungefragt zu, die uns in Chiang Mai bei einer Party kennen gelernt hatte: „Brillant, was Ihr Sohn da vorgetragen hat, sie können stolz auf ihn sein. Um seine Karriere müssen Sie sich keine Sorgen machen.“ Schmeichelhaft für die Eltern. Von seinem Interesse an bildender Kunst und seinem Wissen darüber haben wir häufig profitiert.
In einer überbordenden Auseinandersetzung, in der Julika ihren Vater sicherlich treffen wollte, hielt sie ihm vor, er sei ja letztlich „nur“ Lehrer. Die Ursachen für die allenthalben zu beobachtende Geringschätzung des Lehrerberufes in Deutschland sind gewiss vielfältig, mir fallen ein: die z.T. im Verhältnis zu anderen akademischen Berufen geringere Entlohnung, weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Wie oft habe ich nicht hören müssen: Ehrlich gesagt, ich hätte auf den Lehrerjob keine Lust. Lehrer wäre für mich nichts. Wieso bist du, Martin, überhaupt mit einem Einser-Abitur Lehrer geworden?
Ursprünglich wollte ich in meiner kurzen Rede auf das schwarze Schaf bzw. die schwarzen Schafe eingehen, die es in jeder Familie mehr oder minder zwangsläufig gibt, weil durch den Kontrast das Charakteristische, das soziale Erbe einer Familie insofern sichtbar gemacht wird, als das ‚schwarze Schaf‘ dieses ignoriert, durchbricht, überschreitet. Ich habe letztendlich davon Abstand genommen, weil ich unnötigen Polarisierungen aus dem Wege gehen wollte. Deshalb spielte Onkel Hugo bei dem Treffen keine Rolle, obgleich er es verdient hätte.
Onkel Hugo, der Bruder meines Vaters, erheiratete sich in Morgenstern einen Bauernhof, indem er die Schwester meiner Mutter heiratete, die Doppelhochzeit wurde schon thematisiert. Nachdem ihm seine Frau weggestorben war, verkaufte er kurzerhand den Hof. Vom Erlös leistete er sich u.a. ein schickes Motorrad und einen Lederanzug plus Fliegerkappe, angelte sich eine Haushälterin, Martha, die er nach der Vertreibung in der Bundesrepublik endlich ehelichte. Besonders von den Kindern, von den Bauernjungen wurde er bewundert; jedes Mal, wenn er ins Dorf hineinknatterte, liefen wir zusammen und bestaunten seine Maschine, eine Dürkopp?
Ich kann mich freilich nur schemenhaft an Onkel Hugo erinnern. Eigenartigerweise: Je älter ich werde, desto stärker konturiert sich für mich sein Lebensweg, der diametral dem meines Vaters gegenüberstand. Für meine Eltern war er fraglos das schwarze Schaf, weil er sich – für sie unfassbar – der Verantwortung für den Hof entzog. Er wurde zwar nicht wie der Bock im alten Israel, auf den man die Sünden der Gemeinschaft übertrug, jedes Jahr vom Oberpriester rituell in die Wüste gejagt, gleichwohl auf Distanz gehalten. Er kam mindestens einmal in zwei Wochen zu Besuch, eine Provokation besonders im Sommer, wenn die Ernte im vollen Gange war und er sich zum Abendessen einlud, er schaute einfach mal vorbei, was kümmerte ihn die Arbeit der anderen. Er hatte die Plackerei auf dem Hof satt, suchte eine Alternative, fand und lebte sie unweit vom Hof seines erfolgreichen Bruders. Wie dichtete Friedrich Freiherr von Logau im 17. Jahrhundert „Brüder haben ein Geblüte, aber selten ein Gemüte.“
In den Augen meiner Eltern war er ein arger Tunichtgut, entgegen allen Annahmen jedoch nach dem Krieg zur Stelle: versorgte uns in Bernsdorf ab und an mit Wild, vornehmlich Hasen, mithilfe selbst gebastelter Fallen trotz Verbots seitens der Polen gefangen, fühlte sich für die Familie seines Bruders verantwortlich. Lange vor uns konnte er nach dem Krieg das Land verlassen, landete im Westen und wollte uns alsdann von Zeitz aus in den vermeintlich verheißungsvolleren Teil Deutschlands holen. Die Ablehnung meiner Mutter hing, da bin ich mir fast sicher, mit seiner Person zusammen. Im Innersten verzieh sie ihm nie, dass er nach dem Tode ihrer Schwester, die mehr oder weniger zur Heirat gezwungen worden war, den Hof verhökert und sich dem Müßiggang ergeben hatte. Er schien ihr nicht vertrauenswürdig, nicht zuverlässig. Ihre Aversion wurde durch den Versuch, sie auf ihren Westreisen mit dem Bruder seiner Frau zu verkuppeln, sicherlich verstärkt. Er war am Leben geblieben, ihr Mann, unser strebsamer Vater, Vater von fünf Kindern, im Krieg umgekommen.
Ich bedauere bis heute, dass ich ihn nicht besucht habe, als es noch ging. Andererseits stellten sich in der Jugend die heutigen Fragen nicht. Nicht, dass ich ihm hätte nacheifern wollen, da war ich zu sehr Sohn meines Vaters, indes seine Beweggründe, aus der bäuerlichen Familientradition auszuscheren, hätten mich echt interessiert.
Es gab Zeiten, wo ich die elterliche Familie mit ihren Verwandten – den in Erzählungen und Romanen oft apostrophierten Familienrat – vermisst habe. Ein Familienrat als Vaterersatz, mir fehlte der Vater. Die enge familiäre Bindung in anderen Kulturen hat mich gelegentlich abgeschreckt, aber am Ende meines Lebens kommt mir zum Bewusstsein, die Patchworkfamilie, das Singledasein, die Lebensgemeinschaften ohne Trauschein, hin und her, zur Erziehung von Kindern bedarf es Vater und Mutter, in welcher Beziehungsform auch immer.
Lange Zeit war ich auf der Suche nach einem Ersatzvater und fragte mich, warum mein älterer Vetter Hans Gutzmer nicht auf die Idee kam, sich um unsere Familie zu kümmern. Der Ritterkreuzträger war in der Bundesrepublik, in München, in die Wirtschaft eingestiegen, Mitglied eines renommierten Wirtschaftsklubs in Deutschland. Als er sich schließlich bequemte und aus der Ferne für mich den Eintritt in die Bundeswehr vorschlug, war ich entsetzt. Alles andere schien denkbar, nicht der freiwillige Eintritt in eine Armee, gleich welcher Couleur. Warum hatte er für mich allein den Vorschlag Bundeswehr? Zu spät, ich kann ihn nicht mehr fragen, er starb 2004 im Alter von 87 Jahren.
Ein anderer Verwandter, ein Onkel, stellte die Existenz von Vernichtungslagern für Juden im sog. Dritten Reich in Abrede. Er las mir einen Brief vor, aus dem hervorgehen sollte, „ins KZ seien nur Kriminelle und Arbeitsscheue gekommen“. Wahrscheinlich fühlte er sich durch mich provoziert. Da kommt ein Grünschnabel daher und will den Verwandten im Westen erklären, wer schuld am 2. Weltkrieg war, dass im Osten mit der Enteignung des Großkapitals die entscheidende Ursache von Kriegen aus der Welt geschafft sei und dass sich die Verbrechen der Nazis nicht wiederholen dürften. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mir damals das Argument aus dem Ahlener Programm der CDU von 1947 nicht zur Verfügung stand, wonach „das kapitalistische Wirtschaftssystem den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“ sei.
Man mag heute darüber lächeln, ich wollte aktiv mithelfen einen neuen Krieg, jedweden Krieg, um wie viel mehr einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Eine Form meines persönlichen Engagements war eine Zeitlang das Briefeschreiben: aufklärerische Briefe, für die ich mich heute wegen ihrer begrenzten Argumentationskraft bestimmt schämen würde, bekäme ich sie denn zu Gesicht. Gern möchte ich heute wissen, was genau ich als Oberschüler der neunten oder zehnten Klasse an Harald Wedel z.B. schrieb, dem bereits erwähnten Sohn unseres Ortgruppenleiters, der – hieß es – ins Großkapital oder war es der Landadel eingeheiratet hätte. Es würde mich wundern, wenn ich ihn nicht auf die Kriegsgefahr hingewiesen hätte, die er durch seine Heirat heraufbeschwöre. Er hat mir nicht geantwortet, der Brief ist auch nicht zurückgekommen. Vermutlich wurden meine Briefe wegen ‚kommunistischer Friedenspropaganda‘ aussortiert und vernichtet, wie es millionenfach in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik geschah. Aus der Sicht dieser Verwandten muss ich das schwarze Schaf gewesen sein
Es wäre reizvoll, überlege ich, bei einem zweiten Familientreffen (von keiner Seite bisher wirklich angestrebt) ein Rollenspiel zu initiieren:
Wer wäre denn gern das schwarze Schaf im gegebenen Familienverband geworden oder möchte es werden? Und wenn ja, wie viele?
Kati, die Schauspielerin hätte werden können, würde bestimmt den Reigen beginnen. Ein Ansatz: das angedrohte oder versuchte Hinwerfen der Dissertation kurz vor deren Abschluss. Das geschah in der Zeit der großen Veränderungen, in die sie aktiv eingebunden war. Ihr Vater, der 12 Promovenden und Promovendinnen zum erfolgreichen Abschluss geführt hatte, konnte gar nicht anders, als sie zum Weitermachen trotz aufregender und aufgeregter Zeiten zu ermutigen. Was musste der nicht alles wegstecken: Für mich beginne der Mensch erst beim Doktor vor dem Namen, war nicht der schlimmste Vorwurf.
Julika, allmählich auf die dreißig zugehend, weiß noch immer nicht recht, was sie wirklich will. Sie erklärte bereits im zarten Alter von sieben oder acht der versammelten Runde ihrer promovierten Großfamilie kategorisch: „Doktor werden wie ihr alle will ich nicht, auf keinen Fall“. Doch kein Doktor sein zu wollen ist fraglos kein Maß für ein schwarzes Schaf.
Janis, ihr Bruder, hat sich nicht davon beeinflussen lassen, verfolgt konsequent sein Ziel und steckt derzeit – 2014 – mitten in der Promotion.
Hanna, nach dem Umzug von Coburg nach Chemnitz, als die Mutter dort ihre Praxis eröffnete, legte sich die Latte tiefer, wechselte mehr oder minder munter zwischen den Schulformen: Gymnasium – Realschule – Gymnasium – Fachgymnasium. Was hat sich Hanna nicht alles an Argumenten anhören müssen, Wirkung zeigte das wenig, schon gar nicht mein Verweis auf wissenschaftliche Untersuchungen unter Jugendlichen, wonach mit steigender Bildung die Zufriedenheit mit dem persönlichen Leben wachse. Ich will mich lieber nicht als Prophet betätigen, wundern würde mich nicht, wenn sie als vorerst einzige den Löschmann’schen Nachkriegsstammbaum ohne Abitur ziert und einen anderen Weg geht.
Jörg und Kati wären überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, kein Abitur zu machen, jedenfalls kam mir nichts Derartiges zu Ohren. Birge, Britta, Christiane, Gernot, Maren, Olaf, Wiebke und wie sie alle heißen, höchstwahrscheinlich auch nicht. Dass Olafs Söhne studieren werden, scheint sicher wie das Amen in der Kirche. Hanna in dieser Beziehung das aktuelle schwarze Schaf? Kaum einer im engeren Familienkreis will es wie ich sehen. Wer habe nicht alles das Abitur geschmissen: Thomas Mann verließ das Lübecker Gymnasium Katharineum vorzeitig, Theodor Fontane gehört zu den Schulabbrechern, Einstein nicht vergessen.
Jörgs Aussteige-Ambitionen wurden nach dem Abitur ernst und kamen radikal daher. Eines Tages zog er aus der elterlichen Wohnung aus und bewies Vater und Mutter, dass es in der DDR, in Leipzig, in der Windscheidstraße, möglich war, mit einer Gang eine Wohnung zu finden und darin zu leben, ohne sich polizeilich anzumelden. Am Tag des Umzugs hatte ich einen Termin in Berlin und Marianne musste die Last seines Ausstiegs allein tragen: „Nur nicht weinen, keine Vorwürfe, keine Drohungen, eine Flasche Sekt spendieren und den Abschied gestalten.“ Es gelang, ein Kumpel äußert sich: „Du, so furchtbar finde ich deine Mutter gar nicht.“
Nach einigen Wochen, in denen wir uns große Sorgen um unseren Sohn machten, zog er wieder bei uns ein. Gern möchte ich davon ausgehen, dass ihm unser, in diesem Fall behutsames Vorgehen half, den Weg zurückzufinden. Wir haben ihn besucht, als wäre sein Auszug etwas eher Alltägliches, haben ihn zum Essen eingeladen, ihn nicht als schwarzes Schaf betrachtet, wozu ich in dieser kritischen Zeit gelegentlich neigte. Rational sah ich ein, dass wäre der falsche Weg gewesen, emotional sträubte sich in mir vieles, die Tür nicht zu verschließen. Nichts wäre falscher gewesen als das, da hatte seine Mutter Recht.
Man muss sich schon fragen, was ist in einem solchen Fall falsch gelaufen: Überforderung, zu harsche Durchsetzung von Forderungen an einen jungen Menschen, vor allem Unterschätzung von Aushandlungsstrategien. Was immer den Ausschlag gegeben haben mag, ein Absetzen von der Familie, gleich welcher Gestalt, ist ein natürlicher Vorgang im Prozess des Erwachsenenwerdens, die Art und Weisen sind verschieden. Man agiert auch als Elternteil nicht im zeitlosen Raum, kann sich schwer von den eigenen Bindungen und Erfahrungen lösen, macht Fehler, die, wenn überhaupt, erst im Nachhinein als solche erkannt werden.
Unser Sohn wähnte sich lange im Glauben, er hätte gewusst, wie wir ihn richtig hätten erziehen können, ja müssen. Den Glauben haben wir ihm nicht erschüttern können, das vermag nur das Leben selbst – böser, alter Elternspruch: Unsere Enkel werden uns rächen. Tochter Julika geht ihren eigenen Weg, oder sollte ich schreiben: geht ihre eigenen Umwege. Eines Tages brachte sie allen Vätern und Müttern der Familie das Buch von Alice Miller Das Drama des begabten Kindes mit. Abgesehen von der bewegenden Biografie der Autorin, stießen wir in ihrem Buch auf diskussionswürdige Ansichten, mit denen uns Julika allein ließ. Offensichtlich wollte sie uns zu verstehen geben, dass sich Kinder am besten ohne Anforderungen von außen entwickeln. Wir lesen in diesem Buch:
Ein Kind soll in seinem eigenen Wesen gestützt und gefördert werden. Sofern sich das Kind in seiner Eigenart und Besonderheit ausleben darf, entwickelt es sich von selbst zu einem gesunden und sozialen Wesen.
So sehr das Ausgehen vom Kinde, der behutsame Umgang mit ihm, das Eingehen auf das Kind unabdingbar sind, so wenig kann ich mir sein gedeihliches Heranwachsen ohne die geleitete aktive Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Realität vorstellen. Deshalb ist für mich Alice Millers einfühlsames Herangehen bestenfalls die eine Seite der Erziehungsmedaille, die andere die Notwendigkeit, Verhaltensregeln zu erwerben, die das Bestehen in der Gesellschaft ermöglichen. Deshalb, Julika, bitte nimm, wenn es ernst wird mit der Erziehung eines eigenen Kindes, ergänzend z.B. das Buch von Annette Kast-Zahn Jedes Kind kann Regeln lernen zur Hand.
Da das Spiel vom schwarzen Schaf in der Löschmann’schen Familie bisher nicht gespielt worden ist, muss der Leser mit meiner Sicht vorliebnehmen. Onkel Hugo ist für mich ein klarer Fall, bei all den weiteren, angedeuteten Fällen lassen sich lediglich Ansätze zum schwarzen Schaf erkennen, je nach gewähltem Umfeld und Perspektive. Schwarze Schafe können Außenseiter, Sonderlinge, Einzelgänger, Störenfriede, Kriminelle, aus dem Familienverband Ausbrechende, ihren eigenen Weg Gehende, Querdenker sein. Der Begriff ist zwar im landläufigen Sinne negativ geladen, muss es aber nicht sein. Im Alten Testament gibt es die bekannte Geschichte von Thomas Mann in seiner Tetralogie Josef und seine Brüder gestaltet, wonach Jaakob, Vater von Josef, als gerechten Lohn für seine jahrelange Arbeit von seinem Schwiegervater Laban bekanntlich die gefleckten und gescheckten Ziegen und Böcke sowie die schwarzen Schafe der Herde erbittet, die wegen der Farbe ihrer Wolle gering geschätzt waren. Es hat den Anschein, als ob er in bemerkenswerter Bescheidenheit minderwertige Tiere auswählte, doch er züchtete aus den nicht gewünschten Tieren eine kräftigere eigene Herde.