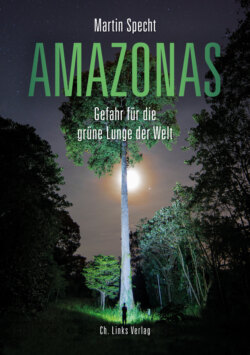Читать книгу Amazonas - Martin Specht - Страница 6
WEM GEHÖRT DER AMAZONAS?
ОглавлениеDer Tag bricht an. Ich liege in meiner Hängematte und lausche. Die ersten morgendlichen Geräusche vertreiben die der Nacht, der Regenwald ist niemals still. In der Dunkelheit hört man das Zirpen der Grillen, das metallene Quaken der Frösche, ab und zu den Ruf eines größeren Säugetiers, unterlegt vom Rauschen des Regens, der vom Himmel herabstürzt. Über mir raschelt es im Dach der Hütte, die mit einem Geflecht aus Palmblättern gedeckt ist. Ein dunkler Schatten, den ich mehr erahne, als dass ich ihn tatsächlich sehen kann, huscht unter dem Dach entlang und verschwindet zwischen den Palmblättern. Wahrscheinlich ist es die Fledermaus, die ich gestern gesehen habe, als ich mich mittags in der Hängematte ausruhte. Zuerst entdeckte ich eine Reihe kleiner weißer Zähne, dann die Umrisse des Kopfes und der gefalteten Flügel. Das Tier hielt sich mit den Krallen am Dachbalken fest und blickte mich aus Augen an, die aussahen wie winzige schwarze Perlen. Ich halte mich in einem Dorf der Tikuna am Ufer des Rio Camatiã auf, einem Zufluss des Rio Solimões in Brasilien. Flussaufwärts in Kolumbien und Peru nennt sich der Solimões bereits offiziell Amazonas, doch in Brasilien wird er erst wieder nach dem Zusammenfluss mit dem Rio Negro in der Nähe der Millionenmetropole Manaus zum Rio Amazonas.
Neben einem gelegentlichen Hahnenschrei sind nun auch die Stimmen der Dorfbewohner zu hören. Kurz darauf schallt Musik aus einem Radio. Dann beginnt der morgendliche Gesang der zahllosen am Amazonas lebenden Vögel, die sich aus Tausenden Kehlen einen zuweilen disharmonischen Wettstreit liefern, um ihr Dasein zu bekunden und ihre Territorien zu markieren.
Ich steige aus der Hängematte und schiebe das Moskitonetz zur Seite. Mit Flipflops an den Füßen trete ich aus der Hütte. Es ist schwülwarm, und in der Luft hängen die Rauchschwaden der Feuer, auf denen die Tikuna ihr Essen zubereiten. Ein Nachbar begrüßt mich und lädt mich ein, mit ihm und seiner Familie zu frühstücken. Es gibt Reis, gekochten Fisch und farinha, ein grobkörniges geröstetes Maniokmehl.
Ich sitze auf einer Holzbank und spreche mit meinen Gastgebern. Neben uns wäscht eine junge Frau ein Kleinkind in einer Plastikschüssel. Die Tikuna stellen mit 20 000 bis 40 000 Menschen die größte der etwa 400 indigenen Gruppen im Amazonasgebiet, sie leben auf dem Gebiet Brasiliens, Perus und Kolumbiens. Die Tikuna sprechen eine eigene Sprache, die sich in den verschiedenen Gemeinschaften in einzelnen Begriffen und Dialekten unterscheidet. Doch meist kann ich mich auf Spanisch oder Portugiesisch verständigen, es findet sich immer jemand, der eines von beidem versteht.
Am Vortag habe ich mit Fernando, einem der Dorfbewohner, verabredet, dass er mich am Morgen mit seinem Boot nach São Paulo de Olivença fahren würde. Der Ort liegt am Rio Solimões, von dort würde ich mit einem der größeren Schiffe, die auf dem Fluss regelmäßig verkehren, nach Manaus weiterreisen können. Nach dem Frühstück bedanke ich mich bei meinen Gastgebern, packe meine Sachen und folge Fernando zu seinem Boot. Er geht barfuß, trägt ein löchriges schwarzes T-Shirt und gelbe Shorts. Wir lassen das Dorf hinter uns und steigen eine Böschung zum Fluss hinab. Dort liegen gleich mehrere kleine Boote am Ufer vertäut. Die meisten von ihnen sind aus Holz, Fernandos ist jedoch aus Aluminium. Er füllt Benzin aus einer Plastikflasche in den Tank des Außenbordmotors. Ich hieve meinen Rucksack ins Boot, lege ihn auf eine der beiden Sitzbänke, setze mich auf die andere und streife meine Flipflops von den Füßen. Fernando stößt das Boot, ein sogenanntes peque-peque, vom Ufer ab und wirft den Motor an. Während der Fahrt stößt er ein endlos aneinander gereihtes »peque-peque-peque-peque« aus, was den Booten ihren Namen einbrachte. Das Tuckern des Zweitakters bildet die geräuschvolle Kulisse vieler Touren auf den Flüssen des Amazonasgebietes. Am Motor ist an einer etwa zweieinhalb Meter langen Stange die Schiffsschraube befestigt, die dicht unter der Wasseroberfläche liegt und bei Bedarf auch ganz aus dem Wasser herausgehoben werden kann. Die Konstruktion ist schwenkbar im Heck angebracht, und der Bootsführer steuert, indem er Motor samt Stange in die gewünschte Richtung bewegt. Dadurch haben die peque-peque kaum Tiefgang und können auch in flachem Wasser fahren. Sie sind weltweit verbreitet und das am häufigsten genutzte Transportmittel zwischen den Dörfern entlang der Flüsse. Im gesamten Amazonasgebiet gibt es nur wenige Straßen, darum sind die Flüsse die wichtigsten Verkehrswege. Sie bilden ein dichtes Netz von Wasserstraßen: Kleinere Flüsse münden in größere, diese wiederum in den Hauptstrom, den Solimões beziehungsweise Amazonas, der schließlich an der brasilianischen Küste in der Nähe der Stadt Belém in einem etwa 250 Kilometer breiten Delta in den Atlantik mündet. Mit der Breite und Wassertiefe der Flüsse – der Wasserstand variiert zwischen Regen- und Trockenzeit um mehr als zehn Meter –, verändern sich auch die Bootstypen: vom Kanu bis zum hochseetüchtigen Containerschiff. Letztere befahren den Amazonas zwischen der Atlantikküste und der circa 1700 Kilometer stromaufwärts im Landesinneren liegenden Hafenstadt Manaus.
Fernando lenkt das Boot mit der Strömung flussabwärts. Das Wasser ist dunkel und schwarz, ebenso die riesigen Bäume am dämmrigen Ufer. Der Himmel zeigt im Osten ein dunkles Grau. Wenn ich mich zu Fernando umdrehe, kann ich seine Gesichtszüge kaum erkennen, nur seine Zähne blitzen auf. Als ich ihn frage, ob es Piranhas und Anakondas im Rio Camatiã gibt, lacht er, antwortet aber nicht. Wir fahren eine Weile, dann stoppt er den Motor. Ohne das ständige »peque-peque-peque« ist es auf einmal still. Das Boot treibt mit der Strömung, das Wasser macht ein gurgelndes Geräusch an der Bordwand, vom Ufer hört man die Geräusche der Insekten. Ohne den Fahrtwind wird es schnell warm, die Luft ist drückend. Fernando füllt Benzin nach, und schon geht es weiter. Am Ufer schwingt sich ein Reiher vom Ast eines hohen Baumes und fliegt für eine Weile wie ein weißer Schatten neben uns her.
Der Fluss wird breiter, und die hohen Bäume am Ufer weichen kleinen, mit Schilf bewachsenen Inseln. Das Boot kurvt zwischen ihnen hindurch, schaukelt ein wenig hin und her. Plötzlich glaube ich mit den Füßen im Wasser zu stehen. Es fühlt sich kalt und nass an. Erschreckt schaue ich nach unten, doch es ist nur die Kälte des tiefen Wassers, die ich durch den Metallboden des Bootes hindurch spüre. Wir sind in den Hauptstrom, den Rio Solimões, eingebogen. Er ist tiefer und führt wesentlich mehr Wasser. Ich kann es fühlen, noch bevor ich es sehen kann. Ich hebe den Blick und schaue auf eine weite graue Fläche, deren Dimensionen eher einem größeren Binnensee als einem Fluss ähneln. Die Strömung ist gewaltig, Strudel bilden sich dort, wo die beiden Flüsse aufeinandertreffen. Äste, Grasbüschel und ganze Baumstämme werden vom Wasser mitgetragen. Fernando muss aufpassen, dass das flache Boot nicht mit ihnen zusammenstößt. Kurze Zeit später steigt die Sonne über die Wipfel und färbt den Himmel in ein zartes Blau. Als die Sonnenstrahlen das Boot treffen und ich mich zu Fernando wende, sehe ich, wie unbeweglich und konzentriert er aufs Wasser schaut. Ein Boot mit einer mehrköpfigen Familie an Bord passiert uns. Die Menschen hocken ebenfalls unbeweglich wie Statuen im langen Kanu.
Wenn man in der Amazonasregion unterwegs ist und die Menschen kennenlernt, die dieses Gebiet ihr Zuhause nennen, erkennt man, wie absurd der Gedanke ist, der Amazonas mit all seinem Reichtum könnte »jemandem gehören«. Die Kategorie Eigentum ist hier vollkommen fremd, und dennoch spielt sie eine entscheidende Rolle in Politik und Wirtschaft.
Zwischen den Anrainerstaaten des Amazonasgebietes und dem Konzern Amazon entbrannte vor einigen Jahren ein Streit darüber, wem die Internetdomain ».amazon« gehört. Dieser Streit macht deutlich, wie weit die Perspektiven auseinander liegen. Würde ich Fernando oder den Menschen im Kanu davon erzählen, sie würden mich nicht verstehen. Für sie ist der Amazonas ein Fluss mit einem gigantischen angrenzenden Waldgebiet und kein Warenstrom. Bestenfalls wissen sie, dass sich die Amazonasregion über die Territorien mehrerer Staaten erstreckt. Der Streit darüber, wem ».amazon« gehört, wurde weit entfernt auf einer internationalen politischen und juristischen Ebene ausgetragen. Dennoch betrifft er die Menschen, die am Amazonas leben, ganz direkt, schließlich wird hier nicht weniger als ihre Identität und Souveränität verhandelt. Schon allein deshalb lohnt es, einen genaueren Blick auf die Auseinandersetzung zu werfen.
Im Jahr 2012 rief die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) potenzielle Interessenten dazu auf, sich um noch zu vergebende Domains zu bewerben. Die ICANN ist die Organisation, die weltweit mit der Verwaltung und Vergabe von Internetadressen beauftragt ist. Domainnamen sind durchaus von hohem ideellen wie auch kommerziellen Wert, wenn sie beispielsweise ein Unternehmen mit ».vw«, oder ein Land mit ».de« bezeichnen, die sogenannten Top-Level-Domains. Nachdem ICANN die Vergabe neuer Top-Level-Domains angekündigt hatte, bewarb sich der Konzern Amazon um ».amazon«, ».bot« und ».kindle«. Daraufhin erhoben die in der Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTAC) organisierten Anrainerstaaten des Amazonasgebietes – Bolivien, Brasilien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela – Einspruch. Sie begründeten ihn damit, dass der Domainname ».amazon« für die kulturelle und geographische Identität der Amazonasregion stehe. So sahen die OTAC-Mitgliedsstaaten beispielsweise eine zukünftige Nutzung für touristische oder wirtschaftliche Zwecke voraus und boten dem Onlinegiganten an, stattdessen Domainnamen wie ».books.amazon« zu nutzen, solange die Rechte für die Top-Level-Domain bei ihnen verblieben. Der Konzern dagegen versuchte, die Amazonasanrainerstaaten umzustimmen, indem er ihnen die kostenfreie Nutzung von Cloud-Servern und Kindle-Lesegeräten anbot – denn eigentlich ist die kommerzielle Nutzung von geographischen Bezeichnungen ausgeschlossen oder bedarf zumindest der Genehmigung des jeweiligen Staates. Im Streit zwischen Amazon und den Amazonasanrainern wurde dahingehend argumentiert, dass es sich bei der Amazonasregion um keinen eigenständigen Staat handle und berechtigte Interessen für eine Nutzung der Domain durch die OTAC-Mitgliedsstaaten nicht zu erkennen seien. Allerdings stellt auch die Europäische Union keinen eigenständigen Staat dar, und trotzdem hält sie die Rechte an der Domain ».eu«. Dies ist aufgrund einer Ausnahmeregelung möglich, die den besonderen Bedarf für eine solche Nutzung anerkennt. Was die ICANN der europäischen Staatengemeinschaft gewährte – eine virtuelle kollektive Identität –, verweigerte sie Amazonasanrainerstaaten.
Nach einem jahrelangen Hin und Her zwischen den beiden Parteien und erfolglosen Vermittlungsversuchen entschieden die Verantwortlichen – auch auf Druck der USA – im Jahr 2019, die Domain ».amazon« an den Konzern zu vergeben. Die Amazonasanrainer protestierten und sandten im Januar 2020 einen von der Generalsekretärin der Organisation, der Bolivianerin Alexandra Moreira, unterzeichneten Brief an den ICANN-Chef, Göran Marby. Im Brief wird die Entscheidung der ICANN zugunsten von Amazon als ein Akt der Gewalt bezeichnet: »Wir halten diese Entscheidung für eine illegale und ungerechtfertigte Enteignung unserer Kultur, Tradition, Geschichte und unseres Erscheinungsbildes vor der Welt.« Dass der Protest Erfolg haben wird, ist eher unwahrscheinlich. Ich brauche nur einen Blick über die Reling zu werfen, um zu erkennen, warum die ICANN zugunsten des Onlinekonzerns entschieden hat. Und ich erkenne außerdem, warum auf internationaler Ebene so sehr um die Souveränitätsansprüche der Amazonasregion gestritten wird. Im Amazonasgebiet leben nur wenige Menschen, die politische und wirtschaftliche Entwicklung – wie auch immer diese aussehen mag – ist nicht weit fortgeschritten. Der größte Teil der Region besteht aus unzugänglichem Dschungel. Es handelt sich um das mit etwa sechs Millionen Quadratkilometern größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Erde – das entspricht 20 Mal der Fläche Deutschlands –, was allein deutlich machen dürfte, dass die Bedeutung Amazoniens nicht zu unterschätzen ist. Die Regenwälder sind Teil eines komplexen Ökosystems, das wiederum starke Auswirkungen auf das globale Klima hat. Experten sind sich mittlerweile einig darin, dass ein Verlust der Amazonasregenwälder, beispielsweise durch Brandrodung oder den massiven Abbau von Bodenschätzen, katastrophale Folgen für das globale Klima und für die Wasserversorgung weiter Teile Nord- und Südamerikas hätte. Die Entwicklungen im Amazonasgebiet sind eindeutig von globalem Interesse.
Mit zunehmender Sorge betrachten daher große Teile der Weltgemeinschaft die Politik des seit Januar 2019 in Brasilien amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro. Auf brasilianischem Territorium liegen etwa 60 Prozent des gesamten Amazonasgebietes, womit dem Land eine Schlüsselrolle in der Region zukommt. Bolsonaros Ziel ist es, die Amazonasregion schnell und in großem Ausmaß wirtschaftlich zu erschließen. Was im Einzelnen darauf hinausläuft, die Regenwälder der Agrarindustrie für ihre Zwecke zugänglich zu machen und Bodenschätze wie Gold, Öl, Gas und Mineralien in großem Stil abzubauen. Es liegt auf der Hand, dass all das zu Lasten des Regenwaldes geht. Im Januar 2020 wurde bereits doppelt so viel Fläche gerodet wie im Vorjahreszeitraum. Die indigenen Gruppen Brasiliens, von denen die meisten in der Amazonasregion leben, sind die Leidtragenden dieser Politik. Zwar sind ihre Rechte auf Autonomie und der Schutz ihrer Territorien in der Verfassung Brasiliens verankert, doch unterläuft der Präsident selbst diese in seinen öffentlichen Äußerungen. Er leugnet schlicht den Anstieg der Waldvernichtung und verkündet, den Indigenen in Zukunft keine weiteren Landrechte mehr zuzugestehen.
Nachdem im Herbst 2019 Nachrichten von verheerenden Großbränden im brasilianischen Teil der Amazonasregion um die Welt gingen, wurde internationale Kritik laut. Staatspräsident Bolsonaro reagierte darauf, indem er den anderen Staaten vorwarf, die Souveränität Brasiliens zu verletzen. Was immer man von ihm halten mag, man muss dieses Argument ernst nehmen, denn Fragen der Souveränität sind in der ehemaligen Kolonie Brasilien seit jeher von großer Bedeutung. Nach der Ermordung des international bekannten brasilianischen Gewerkschaftsführers und Kautschukbauern Chico Mendes im Jahr 1988 sagte der US-amerikanische Senator Robert Kasten in einer Rede, in der er den Tod Mendes’ bedauerte und den Schutz der Regenwälder forderte: »Es ist eine Tatsache, dass wir die Regenwälder brauchen und auch nutzen – es sind also auch unsere Wälder.« Daraufhin brach in Brasilien über alle Parteigrenzen hinweg ein Sturm der Entrüstung los. Die USA und Europa würden das Amazonasgebiet zu einer Art »grünem Persischen Golf« machen wollen und Brasilien werde nicht dulden, dass der Amazonas zum Botanischen Garten der Menschheit werde, sagte der damalige brasilianische Außenminister. Ich selbst habe in Gesprächen mit Brasilianern – auch mit solchen, die die Politik Bolsonaros entschieden ablehnen – immer wieder das Argument gehört: Warum soll die Amazonasregion quasi »Allgemeingut« sein, wenn doch die weltweiten Ölvorräte – ebenfalls wichtig für das Funktionieren der Weltgemeinschaft – im Besitz einzelner Staaten sind? Demnach müsse man Brasilien das Recht zugestehen, die Amazonasregion nach eigenem Ermessen als Ressource für seine wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Ein Argument, das auch Bolsonaro anführt.
Die Idee, die Amazonasregenwälder wirtschaftlich zu erschließen, ist freilich keineswegs neu, und Bolsonaro greift lediglich auf, was das brasilianische Militär bereits in den 1970er Jahren, zu Zeiten der von 1964 bis 1985 herrschenden Militärdiktatur, erfolglos versucht hat. Eines der Hauptziele der damaligen Machthaber war die Nutzbarmachung von bis dahin unterentwickelten Regionen, namentlich des Amazonasgebietes. Seinerzeit wurden von der herrschenden Junta gleich mehrere Großprojekte in Angriff genommen, die die brasilianische Amazonasregion wirtschaftlich öffnen sollten. Eines davon ist die umstrittene Transamazônica, eine etwa 4000 Kilometer lange Straße, die in ostwestlicher Richtung durch den Regenwald verläuft. Ein erstes Teilstück wurde zwar 1972 eingeweiht, doch bis heute sind weite Abschnitte nicht asphaltiert und während der Regenzeit kaum passierbar. Der erhoffte wirtschaftliche Nutzen der Transamazônica für die brasilianische Wirtschaft blieb weitgehend aus, dagegen wurde der Regenwald in den jeweiligen Regionen durch Holzfäller, Viehzüchter und illegale Landnahme stark geschädigt.
Der ehemalige Armeehauptmann Jair Bolsonaro stellt also – auch in seiner provokanten, simplifizierenden und zuweilen offen rassistischen Rhetorik – keine wirklich neuen politischen und wirtschaftlichen Ideen vor. Er ist Teil einer brasilianischen Führungselite in Militär und Politik, die seit Jahrzehnten in positivistischer Tradition denkt und handelt. Der französische Philosoph Auguste Comte hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts den philosophischen Positivismus neu begründet. Er war der Ansicht, dass die Entwicklung der Menschheit sich in drei Stadien vollziehen werde: Der erste Entwicklungsschritt beginne mit den Kulten, darunter fallen auch die Glaubensvorstellungen der indigenen Gruppen, die sich zu verschiedenen Formen des Monotheismus entwickeln (darunter das Christentum und der Islam), um schließlich in einer Art Weltgesellschaft, basierend auf Naturwissenschaften sowie technischem und sozialem Fortschritt, eine vorläufige Vollendung zu finden. Der Comte’sche Positivismus hatte eine soziale Ordnung zum Ziel, in der gesellschaftliche Werte wie Familie, Altruismus und Leistungsbereitschaft dem Wohl aller dienten und dazu beitragen sollten, die Lebensverhältnisse dauerhaft zu verbessern. In der Definition dieser Werte wies der Positivismus Comtes Parallelen zum Katholizismus auf. In den Kreisen des Militärs und des städtischen Bürgertums Brasiliens wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine verkürzte Lesart dieser Theorie populär, da man sich von ihr eine überzeugte Hinwendung zu technischem und wissenschaftlichem Fortschritt versprach, mit der sich die Rückständigkeit der kolonialen Vergangenheit überwinden ließe. Bis heute findet sich der Leitspruch des Comte’schen Positivismus »Ordem e Progresso« (Ordnung und Fortschritt) in der Nationalflagge Brasiliens. Für die indigenen Gruppen der Amazonasregenwälder stellte der in Brasilien populäre Positivismus insofern eine Gefahr dar, als er die Naturreligionen als ein Entwicklungsstadium sah, das es zu überwinden galt. Damit waren die indigenen Kulturen etwas, das in ein positivistisches Gesellschaftskonzept assimiliert werden musste. Die Positivisten sahen schon im 19. Jahrhundert im Regenwald und den hier lebenden Menschen eine Ressource, die sie in ihrem Sinne nutzen wollten. Bedauerlicherweise wurden die indigenen Regenwaldbewohner nicht nach ihrer Haltung dazu gefragt.
Doch es sind beileibe nicht nur rechtsgerichtete Politiker und Regierungen, deren Politik eine Bedrohung für den Amazonasregenwald und seine Bewohner darstellt. Der linksgerichtete ehemalige Präsident Lula da Silva hatte bereits im Jahr 2006 – weit bevor Bolsonaro auf der politischen Bühne des Landes auftauchte – »das Hemmnis des Wachstums durch Umweltschützer, Indigene, afrobrasilianische Gemeinschaften und das Steuerwesen« ausgemacht. Damit wurden, ebenfalls offen rassistisch, Umweltschützer, Indigene und Afrobrasilianer zu Feinden des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts in Brasilien erklärt. Auch andere linksgerichtete Regierungen Südamerikas, darunter die Venezuelas, betrachten den Regenwald vor allem als Lieferanten von Rohstoffen und lassen sich bei deren Ausbeutung nur selten von den verheerenden Folgen für die Ökosysteme abhalten. Unter dem inzwischen abgesetzten bolivianischen Präsidenten Evo Morales wurde in der Verfassung des Landes die Industrialisierung der natürlichen Ressourcen als vorrangiges Ziel deklariert. Hinzu kommt, dass der Großteil des Amazonasgebietes unter den bestehenden Voraussetzungen nur schwer zu regieren oder zu kontrollieren ist. Selbst wenn die einzelnen Staaten eine noch so konstruktive oder nachhaltige Umweltpolitik betreiben würden, es fehlen ihnen, angesichts der gewaltigen Ausdehnung und der Unzugänglichkeit der Amazonasregion, schlichtweg die Möglichkeiten, deren Einhaltung zu überwachen oder gar durchzusetzen.
Als die Britin Emma Kelty im Jahr 2017 mit einem Kajak den Amazonas in seiner gesamten Länge befahren wollte, wurde sie am 44. Tag ihrer Reise auf dem Rio Solimões – auf dem auch ich unterwegs bin – ermordet. Die Täter wurden mittlerweile gefasst, es handelt sich um Kriminelle, die die Wertsachen von Kelty auf einem lokalen Markt verkaufen wollten. Einheimische, die sich auf den Flüssen des Amazonasgebietes bewegen, sagen, Verbrechen wie diese seien nicht außergewöhnlich. Der Tod von Emma Kelty wurde nur darum aufgeklärt, weil einer der Mörder versehentlich einen satellitengestützten Notsender aktiviert hatte, den er für ein Mobiltelefon hielt – und weil sie eine westliche Ausländerin war. Tagtäglich verschwinden Menschen in den Dschungeln des Amazonas, und man hört nie wieder etwas von ihnen. Zehn tote Goldgräber, ein Dutzend verschwundener Flüchtlinge aus Venezuela oder eine Gruppe ermordeter Indigener, so etwas wird am Amazonas schnell vergessen, die Verantwortlichen beinahe nie zur Rechenschaft gezogen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es manchmal tatsächlich vermessen und naiv, wenn westliche Organisationen oder Politiker die Überwachung bestimmter Umweltgesetze einfordern, und es stellt sich die Frage, wie sich die bekannten Ansätze, Umwelt- und Menschenrechte zu schützen, der komplexen Realität anpassen lassen. Denn nicht alle Indigenen sind automatisch gute Menschen – selbst wenn man sie im Westen gern romantisierend als letzte Hüter des Waldes stilisiert. Und illegale Goldgräber sind nicht zwangsläufig böse, weil sie die Natur bei der Goldgewinnung mit Quecksilber vergiften. Wie wir sehen werden, leben all diese Menschen in einer herausfordernden Umgebung und müssen ihr Überleben diesen Gegebenheiten anpassen.
Es gibt bereits vielversprechende Ansätze. Ecuador beispielsweise hat im Jahr 2008 die Natur als ein eigenständiges Rechtssubjekt in seine Verfassung aufgenommen. Kurz gefasst bedeutet das, dass die Natur per se Rechte besitzt, die sie zu ihrem Schutz geltend machen kann, unabhängig von ihrer Bedeutung für die Menschen. Bisher bestanden die juristischen Regelungen im Umgang mit der Natur hauptsächlich aus Umweltschutzrechten und einem der Natur zugesprochenen materiellen oder ideellen Wert. Der neue Ansatz geht weit über diese zweckorientierte Auffassung hinaus und verfolgt eine andere Richtung, die – wie wir sehen werden – eher etwas mit der Weltanschauung der indigenen Gruppen zu tun hat. Natürlich können ein Wald, ein Fluss oder ein Berg nicht selbst vor Gericht ziehen und diese Rechte einfordern, sondern brauchen jemanden, der das in ihrem Namen tut. Im April 2018 verkündete das Oberste Gericht Kolumbiens ein Urteil, in dem es dem Amazonasgebiet ebenfalls den Status eines eigenständigen Rechtssubjekts – sujeto de derechos – zusprach. Dem Urteil ging die Klage der NGO Dejusticia voraus. Sie war von jungen Kolumbianern initiiert worden, die in der Zerstörung der Amazonasregion eine Bedrohung ihrer Zukunft sahen.
Eng verbunden mit den Umweltschutzbemühungen ist die Wahrung der Rechte indigener Gruppen. In den meisten Staaten des Amazonasgebietes haben sie bereits seit Jahrzehnten einen eigenen Rechtsanspruch, der ihre Kultur und ihre Territorien schützt. Tatsächlich sehen sie sich aber – besonders in jüngster Zeit in Brasilien – immer mehr den Übergriffen von illegalen Goldgräbern, Holzfällern, Fischern und Drogenkriminellen ausgesetzt, die in ihren Lebensraum eindringen und diesen zerstören.
Wenn es um die Rechte indigener Gemeinschaften geht, ist der Ethnologe Martín von Hildebrand einer der kompetentesten Ansprechpartner weltweit. Der Kolumbianer mit deutschen Vorfahren war in den 1980er Jahren Leiter der kolumbianischen Indigenenbehörde, er beriet mehrere Regierungen und sorgte dafür, dass mehr als 240 000 Quadratkilometer Land im Amazonasgebiet Kolumbiens als indigene Territorien geschützt wurden. Er war während der 1970er Jahre erstmals ins Amazonasgebiet gereist und hatte gesehen, wie schlecht die indigenen Gruppen dort behandelt wurden. Aufgrund dieser Eindrücke beschloss er, sich für ihre Rechte einzusetzen. Nach seiner Tätigkeit für die kolumbianische Regierung gründete von Hildebrand die Fundacíon Gaia Amazonas, die sich ebenfalls um den Schutz indigener Gruppen bemüht. Dabei war er zu Beginn auf zahlreiche Schwierigkeiten gestoßen, und auch heute sei die Situation nicht immer leicht. Zuerst, erklärte er mir einmal, müssten die entsprechenden Gesetze erlassen werden, auf die sich die Indigenen berufen können. Dafür sei es wichtig, dass die Gemeinschaften sich organisieren und gewissermaßen in indigenen Verwaltungen oder Regierungen tätig werden. Gleichzeitig müsse der gesamten Gesellschaft der Wert und die Wichtigkeit der indigenen Kulturen vermittelt werden, um Akzeptanz und Verständnis für ihre Anliegen zu schaffen. Doch der wichtigste Punkt sei, dass das Land, auf dem die Indigenen leben, offiziell als das ihre anerkannt werde. Von Hildebrand erzählt mir von einem Fall im kolumbianischen Vaupés, in dem er den Mitgliedern einer indigenen Gemeinschaft die Problematik und das weitere Vorgehen ausführlich erklärte. Er riet ihnen, sich mit seiner Hilfe darum zu bemühen, dass ihr Anspruch auf das Land in der Hauptstadt Bogotá schriftlich anerkannt werde, doch sie verstanden ihn nicht. Als von Hildebrand insistierte und erklärte, sie müssten dafür sorgen, dass das Land auf dem sie lebten, ihnen gehört, lehnten sie ab. »Das Land«, sagten sie voller Überzeugung, »gehört niemandem. Wir gehören dem Land.« Womöglich ist das die Antwort auf die Frage, wem der Amazonas gehört.