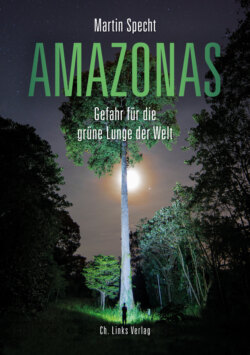Читать книгу Amazonas - Martin Specht - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
WIE FUNKTIONIERT DAS ÖKOSYSTEM REGENWALD? Bäume und Klima
ОглавлениеIch wende mich dem Land zu und nehme Abschied von Fernando, der mich mit seinem Boot ins brasilianische São Paulo de Olivença gefahren hat. Über zwei breite, im Wasser schwimmende Baumstämme balanciere ich – samt Rucksack – zum Ufer. Als ich mich umdrehe, um ihm zum Abschied zuzuwinken, hat die Strömung des Solimões ihn schon fortgetrieben. Ich sehe, wie er über die Lenkstange des Motors gebeugt im Heck des Bootes sitzt und starr nach vorne schaut. So wie die Gruppe von Menschen, die uns kurz zuvor im Kanu entgegengekommen ist. Die Uferböschung ist schlammig, und am Himmel türmen sich Wolken in die Höhe. Beides hängt miteinander zusammen. Die Wolkenformationen sind gigantisch und ragen wie große Pilze in den Himmel. Die Formen wechseln schnell, schon ist aus dem Pilz eine riesige Säule geworden. Alles ist in Bewegung, strömt einem Ziel entgegen. Zusammen mit der schnell sinkenden Sonne lassen die Wolken abends im Amazonasgebiet die spektakulärsten Farbenspiele entstehen. Wenn die Sonne ihren tiefsten Punkt erreicht, ist das Licht manchmal dunkel violett, und über allem ziehen schwarze Wolken am Himmel hinweg. Die Wassermengen darin sind so enorm, dass die Indigenen von »fliegenden Flüssen« sprechen. Das Wasser bewegt sich am Boden in Flussläufen und am Himmel in gewaltigen Wolken über die Erde. Das Amazonasgebiet ist ein Land des Wassers.
Bis heute gehen die Meinungen darüber auseinander, wo genau der Amazonas entspringt, und damit auch darüber, wie lang er tatsächlich ist. Unbestritten ist, dass der Fluss, der erstmals in Peru als Río Amazonas bezeichnet wird, ein Zusammenfluss mehrerer Flüsse ist, die sämtlich in den peruanischen Anden entspringen. Diese Gebirgsformation mit mehr als 6500 Meter hohen Gipfeln durchzieht den gesamten südamerikanischen Kontinent in nordsüdlicher Richtung. Die beiden wichtigsten Quellflüsse des Amazonas sind der Marañón – mit mehr als 1600 Kilometern Länge – und der etwa 2600 Kilometer lange, weiter südlich gelegene Ucayali. Etwa 100 Kilometer von der peruanischen Stadt Iquitos entfernt, vereinigen sich der Marañón und der Ucayali, von dort an nennt sich der Strom Río Amazonas. Diesen Namen behält er auf seinem Weg in Richtung Osten – auf dem er Peru und Kolumbien passiert – bis zur brasilianischen Grenze. Nun heißt er Rio Solimões und wird erst wieder nach dem Zusammenfluss mit dem Rio Negro in der Nähe der Großstadt Manaus zum Amazonas, bis er schließlich in den Atlantik mündet. Der Hauptstrom wird aus zahlreichen Zuflüssen gespeist, die die europäischen Flüsse an Länge und Wasserstand meist übertreffen. Die größten Nebenflüsse des Amazonas sind auch während der Trockenzeit schiffbar und stellen wichtige – und neben dem Flugzeug meist die einzigen – Verkehrswege dar. Zu diesen Nebenflüssen gehören der Río Putumayo (circa 2060 Kilometer Länge), der Rio Madeira-Guaporé (etwa 3240 Kilometer), der Tocantins (circa 2640 Kilometer), der Rio Tapajós (etwa 2000 Kilometer), der Rio Xingu (circa 1980 Kilometer), und der Rio Negro (etwa 1550 Kilometer). Zum Vergleich: Der Rhein ist von der Quelle bis zur Mündung etwa 1230 Kilometer lang und führt deutlich weniger Wasser als die meisten der hier erwähnten Nebenflüsse des Amazonas. Der Amazonas legt eine Strecke von mehr als 6900 Kilometern zurück – mehr als die Entfernung Berlin – New York –, bis er an der brasilianischen Küste in den Atlantik mündet.
Betrachtet man Landkarten oder Satellitenbilder der Amazonasregion, so erinnern die Verzweigungen der Nebenflüsse, die sich schließlich im Hauptstrom vereinen, an einen liegenden Baum, dessen mächtigen Stamm der Amazonas darstellt. Obwohl die indigenen Gruppen der Amazonasregion über keinerlei Kartographie verfügten, findet sich das Bild des liegenden Baumes tatsächlich in einigen Schöpfungsmythen wieder.
Einer der schönsten wird von einigen Gruppen der Tikuna erzählt. Darin suchen Yoi und seine Schwester Ipi, die Zwillinge, die aus den Knien des großen Vaters Nguxtapax geboren worden sind, im Dschungel nach einem Ort, an dem sie das Volk der Tikuna erschaffen können. Sie kommen an eine Stelle, an der ein hoher Lupunabaum steht. So nennen die Tikuna die im Amazonasregenwald verbreiteten Kapokbäume, die uralt und bis zu 70 Meter groß werden können. Die gewaltigen brettartigen Wurzeln ragen über der Erde aus dem Stamm heraus. Als Yoi und Ipi den Baum erreichen, wollen die dort lebenden Tiere gerade die Gegend verlassen, weil sein Schatten alles Darunterliegende ins Dunkel hüllt. Yoi und Ipi rufen die wenigen verbliebenen Tiere zusammen und bitten sie, mit ihren Klauen und Zähnen den Baum zu fällen. Das Eichhörnchen, der Specht und einige andere schaffen es tatsächlich, den Stamm des Baumes zu durchtrennen, doch er fällt nicht um. Das Eichhörnchen wird nach oben geschickt, um nachzusehen, was los ist. Es entdeckt ein Faultier, das in der Baumkrone sitzt und sich mit einem Arm an den Wolken festhält. Yoi befiehlt dem Eichhörnchen, Pfeffer in die Augen des Faultiers zu streuen, damit es die Wolken loslässt, doch ohne Erfolg. Das Eichhörnchen wird erneut in die Baumkrone geschickt, diesmal mit einer Handvoll stechender Ameisen. Oben angekommen, wirft es die Ameisen nach dem Faultier, das seinen Griff nun endlich lockert. Wie erwartet stürzt der Baum zu Boden. Doch sobald seine Äste die Erde berühren, beginnt es zu blitzen und zu donnern. Gleichzeitig schießt Wasser von irgendwoher herbei. Das Wasser öffnet ein riesiges Loch in der Erde, aus dem das Flussbett wird, und so entsteht der Río Amazonas. Aus den Zweigen des Baumes werden kleinere und größere Zuflüsse. Die Blätter verwandeln sich in Fische, die sich auf wundersame Art vermehren. Yoi und Ipi nehmen das Herz des Baumes und pflanzen es in die Mitte des neuen Dorfes.
Auch wenn man die zahlreichen Mythen der Indigenen über den Ursprung der Welt außer Acht lässt, so sind es doch Sonne und Wasser, die dem Leben im Amazonasgebiet seine Form geben. Das Amazonasbecken – gemeint ist das im Westen vom Rand der Anden her abfallende und sich im Osten bis an den Atlantik erstreckende relativ flache Tiefland – ist auf etwa fünf bis sechs Millionen Quadratkilometern von Regenwald bedeckt, hinzu kommen noch einmal circa eine Million Quadratkilometer Savannenvegetation. Beides zusammen bezeichnet man als Amazonasbiom, das damit eine flächenmäßige Ausdehnung etwa in der Größe der USA hat. Im Mündungsgebiet verzweigt sich der Amazonas in ein circa 250 Kilometer breites Flussdelta, aus dem pro Sekunde (!) zwischen 35 000 und – bei Höchststand – 160 000 Liter in den Atlantik fließen.
Doch wie funktioniert der Wasserkreislauf im Einzelnen, und wie hängt er mit dem globalen Klima zusammen? Das Amazonasgebiet liegt nahe am Äquator, darum sind Sonneneinstrahlung und die Wärmeentwicklung das ganze Jahr über enorm. Wasser, das über dem Atlantik verdunstet, wird als Wolke vom Wind landeinwärts getragen, bis es auf die Barriere der Anden trifft, dort wiederum als Regen vom Himmel fällt und im Amazonas-Flusssystem zum Atlantik zurückkehrt. So hat man den Wasserkreislauf in der Amazonasregion zumindest lange Zeit erklärt. Doch in Wirklichkeit ist er wesentlich komplexer, und es wird schnell offensichtlich, wie wichtig dieses Geschehen für das globale Klima ist. Der Schlüssel dazu liegt in den Bäumen des Regenwaldes. Im Boden des Amazonasgebietes sind wegen der beschriebenen Wasserzyklen enorme Wasservorräte vorhanden. Durch die beständige starke Sonneneinstrahlung »schwitzen« die Bäume und transportieren mittels ihrer Wurzeln Wasser aus dem Erdreich ins Laub, wo es über die Blätter verdunstet und sich mit dem über Flüssen und Atlantik verdampfenden Wasser zu den »fliegenden Flüssen« vereint.
Da von einer Regenwaldfläche von fünf bis sechs Millionen Quadratkilometern die Rede ist, kann man sich vorstellen, wie es zu den riesigen Wassermengen kommt, die über das Gebiet hinwegziehen. Ein einzelner Baum im Amazonasregenwald kann bis zu 1000 Liter Wasser am Tag verdunsten. Deswegen bedeutet »Trockenzeit« am Amazonas auch nicht, dass es gar nicht regnet: Die Bäume machen sich ihren Regen gewissermaßen selbst, unabhängig vom Wechsel der Jahreszeiten. In der sogenannten Regenzeit ist der Wasserstand der Flüsse höher, und es regnet häufiger. Ohne den ganzjährigen Regen – Teil eines permanenten Wasserkreislaufs – könnte der Regenwald nicht überleben. Die Phasen der Regen- und Trockenzeit dauern jeweils etwa sechs Monate. Die Regenzeit beginnt im November oder Dezember und hält bis April oder Mai an.
Im Amazonasbecken produzieren die Bäume sieben Mal mehr Wasser, als es durch die Verdunstung im Atlantik geschieht. Das hat noch einen anderen Effekt: Durch die Verdunstung entsteht ein Vakuum, das wiederum den Regen ansaugt. Es ist nicht nur der Wind, sondern auch der so entstehende Unterdruck, der große Auswirkungen auf das globale Klima hat. Diese Luftströmungen bestimmen das Wetter in ganz Süd- und Nordamerika. Einige Experten glauben, Teile des Kontinents könnten zu Wüsten werden, sollte es am Amazonas nicht mehr ausreichend regnen. Dabei handelt es sich um ein äußerst fragiles System. Wenn es zu wenig regnet, trocknet der Regenwald aus und die zunehmende Sonneneinstrahlung erhöht, verstärkt durch Eingriffe des Menschen, die Waldbrandgefahr. Auch die indigenen Gruppen wissen um die Beziehung, die Sonne und Wasser in der Amazonasregion eingehen. Und das schon lange, bevor in Europa so etwas wie Klimaforschung überhaupt existierte.
Ein weiterer Mythos der Tikuna erzählt folgende Geschichte: Der curaca, das Dorfoberhaupt der Tikuna, sieht seit Tagen dem fallenden Regen von seiner Hütte aus zu. Diesmal regnet es selbst für amazonische Verhältnisse ungewöhnlich stark. Weitere Regentage vergehen, und schließlich bemerkt der curaca, dass statt Wasser Tiere vom Himmel fallen. Frösche, Papageien, Fische, Schlangen, Gürteltiere, Ameisen und viele mehr. Der curaca traut seinen Augen nicht und ruft seine Frau und seinen Sohn, damit sie sich das Schauspiel ansehen. Sobald die Tiere auf dem Boden landen, verwandeln sie sich in Kobolde, rennen davon und verstecken sich in den Zweigen der Renacobäume. Der »Regen der Tiere« hält noch lange Zeit an. Eines Morgens erscheint die Sonne im Körper einer sehr schönen jungen Frau. Sie geht zum curaca und bittet ihn um Obdach. Sie bleibt bei ihm und seiner Familie, ist fröhlich und fleißig. Der Sohn des curaca und die junge Frau verlieben sich ineinander und beschließen, sich zusammenzutun. Die Frau stellt eine Bedingung: Er dürfe niemals ihr Haar berühren. Sie bauen ihre Hütte in einiger Entfernung zu der des curaca. Das Paar rodet ein großes Stück Dschungel und pflanzt Mais, Yucca, Kochbananen, Ananas und achiote, den Annattostrauch, aus dessen Beeren die rote Körperbemalung einiger indigener Gruppen hergestellt wird. Dank der Energie der jungen Frau gedeiht der Garten. Sie ist stärker als ein Mann und klettert auf die höchsten Palmen, um deren Früchte zu ernten. An einem Morgen, an dem es nicht regnet, geht das Paar zu einem Bach, um zu baden. Der junge Mann ist neugierig darauf, wie sich ihr Haar anfühlt. Er versteckt sich zwischen den Sträuchern, wartet auf den Moment, da die Frau den Kopf ins Wasser taucht, kommt hervor und berührt ihr Haar. Die junge Frau ist wütend und schreit ihn an: »Warum hast du das getan? Ich hätte glücklich sein können, doch nun muss ich für immer im kalten Schatten der Renacobäume leben!« Noch während sie das sagt, verwandelt sie sich in einen Kobold, fährt ihre Krallen aus und enthauptet den Sohn des curaca. Dann frisst sie sein Herz und verschwindet so schnell sie kann zwischen den verschlungenen Wurzeln der Renacobäume.
Die Bäume nehmen die Kobolde in sich auf und schützen so die Menschen – womit wir beim Thema Kohlendioxid und Treibhausgasen wären. Der Regenwald des Amazonasgebietes ist nicht nur ein gigantischer Süßwasserproduzent, seine Bäume absorbieren in ihrer Gesamtheit auch große Mengen an Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre. Das ist dank der Fähigkeit der Bäume und Pflanzen zur sogenannten Fotosynthese möglich, der Zusammenfügung verschiedener energiereicher Elemente unter Einwirkung von Licht auf das in den Blättern (auch Algen besitzen die Fähigkeit zur Fotosynthese) enthaltene Chlorophyll. Über die Blätter nehmen die Bäume Kohlendioxid und Wasser aus der Luft auf, wandeln es unter anderem in Sauerstoff um, der an die Umwelt abgegeben wird, und lagern den Kohlenstoff in Holz und Boden ein. Durch die Amazonasregenwälder wird der Erdatmosphäre ein Teil des – auch als Treibhausgas bezeichneten – CO2 entzogen.
Treibhausgase sind in der Erdatmosphäre vorhandene Gase, darunter Ozon und Methan, die sich durch die Sonneneinstrahlung besonders erwärmen (sie reagieren auf das ultraviolette Spektrum des Sonnenlichts) und so zu einem Anstieg der globalen Temperatur führen. Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, wie zum Beispiel Öl, Kohle, Holz und Gas. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat errechnet, dass die Regenwälder Brasiliens zwischen 290 und 440 Milliarden Tonnen CO2 speichern. Die Amazonasregenwälder insgesamt nehmen etwa fünf Prozent der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen auf.
Obwohl Kohlendioxid auch auf natürliche Weise in der Erdatmosphäre vorhanden ist, ist der Ausstoß seit Beginn der Industrialisierung so weit angestiegen, dass er zu einer globalen Erwärmung geführt hat. Darum haben sich die am Pariser Klimaabkommen von 2015 beteiligten Staaten darauf geeinigt, den Kohlendioxid-Anteil in der Erdatmosphäre durch eine Begrenzung der Emissionen zu reduzieren und – so das Ziel des Abkommens – die Erderwärmung bis zum Jahr 2030 auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Epoche zu begrenzen. Sollte dieses Ziel verfehlt werden, droht laut Experten eine Klimakatastrophe, deren Folgen dramatischer kaum sein könnten: Anstieg der Meeresspiegel, Überschwemmungen, Orkane von bisher nicht gekanntem Ausmaß, das Abschmelzen der Polkappen, verheerende Trockenheit in Teilen der Erde – und der Verlust der Amazonasregenwälder.
Die Szenarien zum tatsächlichen Verlauf und zu den Folgen des Klimawandels liegen, was den Amazonas betrifft, sehr weit auseinander. Manche Experten glauben, dass, sollte die Erderwärmung um etwa zwei Grad ansteigen, die Hälfte der Regenwaldflächen verlorengehen würde. Dies geschähe durch Austrocknung, die wiederum wegen der starken Hitzeeinstrahlung im Amazonasgebiet zu Bränden führt. Andere Studien sprechen von etwa zehn Prozent Waldverlust. Es ist schwer vorherzusehen, wie sich die Situation des Amazonasregenwaldes entwickeln wird, da nicht nur die Erderwärmung seinen Bestand gefährdet. Auch die teilweise Abholzung und der Abbau von Bodenschätzen machen ihm zu schaffen. Durch Entwaldung fragmentierte Regenwaldflächen sind weitaus anfälliger als große, zusammenhängende.
Neben dem Klimawandel sind es also auch politische und ökonomische Faktoren in den Amazonasanrainerstaaten, die in den nächsten Jahren darüber entscheiden werden, in welchem Maße der Regenwald erhalten bleiben wird. Im Jahr 2020 geht man davon aus, dass bereits etwa 20 Prozent der einstigen Regenwaldflächen vernichtet wurden, was laut dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu einer Erwärmung zwischen 0,8 und 0,9 Grad in der Amazonasregion geführt hat. Kommt es zu einem weiteren Temperaturanstieg, verbunden mit dem Absterben der Regenwälder, so könnte das eintreten, was von Experten als Tipping-Point-Prozess bezeichnet wird: Anstatt Kohlendioxid zu binden, produzieren die Wälder zusätzliches CO2, das durch abgestorbene und verrottende Pflanzen und Bäume entsteht.
Woher aber haben indigene Gruppen, deren Mythen bisweilen komplexe Zusammenhänge des Regenwaldsystems darstellen, die wir mit modernen wissenschaftlichen Methoden gerade erst ansatzweise begreifen, ihr Wissen? Im Leben der indigenen Gruppen wird vieles durch Tabus geregelt. Zu bestimmten Zeiten dürfen bestimmte Nahrungsmittel nicht gegessen oder bestimmte Dinge, wie das Haar der jungen Frau in der Geschichte mit den Kobolden, nicht berührt werden. Die Tikuna kennen zum Beispiel den Brauch der pelación, bei dem jungen Frauen nach der ersten Menstruation sämtliche Haare ausgezupft werden. Erst wenn sie nachgewachsen sind, dürfen sie auch tagsüber die Hütte wieder verlassen. Außerdem gelten bestimmte Regeln für die Ernährung in dieser Zeit. Für die Indigenen ergeben diese Vorschriften und Verbote einen Sinn, auch wenn sie für uns mitunter irrational und willkürlich erscheinen. In der Kobold-Geschichte fungiert der Regen, der sich in davonrennende Tiere verwandelt, als Lebensspender, doch wird ein Tabu verletzt – oder eine Grenze übertreten – verwandelt sich Leben in Tod.
Der Regenwald ist voller Orte, die geheimnisvoll und mitunter auch bedrohlich wirken. Im Januar 2020 fahre ich in einem Kanu über den Lago Tarapoto. Der See ist mit dem Río Amazonas verbunden, in der Flussmitte verläuft die Grenze zwischen Peru und Kolumbien. Es gießt in Strömen, und obwohl es schwülwarm ist, erinnert das Licht an einen Novembernachmittag in Nordeuropa. Auf dem Boden des Kanus stehen Pfützen, und auf dem Wasser des Sees bilden Regentropfen konzentrische Kreise, die sich, in sanften Wellen auslaufend, vergrößern und ineinander übergehen. Ich halte das Paddel in den nassen Händen. Eine flüssige graue Welt. Die Bäume stehen dunkel am Ufer. Ein großer Raubvogel hockt mit nassem Gefieder auf einem der oberen Äste. Ohne den Lärm des peque-peque sind die Geräusche des Regenwaldes viel deutlicher zu hören. Das Prasseln des Regens, der Ruf eines Vogels. Irgendwo hinter mir klatscht etwas aufs Wasser, vielleicht ein großer Fisch. Ich halte auf die Bäume zu. In der Regenzeit steht dieser Teil des Waldes für einige Monate bis zu mehreren Metern unter Wasser. Es ist auch die Zeit, in der viele Früchte reif sind. Fische, Schlangen und Vögel kommen zu den umfluteten Bäumen, um sich von ihnen zu ernähren, die Piranhas legen hier ihre Eier ab. Die Raubfische jagen nicht nur, sondern ernähren sich zusätzlich von Früchten und Samenkapseln, die sie im Überfluss finden. Auch Schlangen, Kaimane, Flussdelfine und der pirarucu, einer der größten Fische des Amazonas, leben zu dieser Zeit im überfluteten Wald. Sobald ich mit dem Kanu den offenen See verlasse und in den Schatten des Waldes eintauche, wird es dunkel um mich herum. Unter dem Blätterdach ist es trockener, denn die Bäume im Amazonasgebiet tragen ganzjährig Laub. Moskitos landen auf meinen Armen und Beinen. Im Zwielicht sehe ich sie kaum, spüre aber ihre Stiche.
Plötzlich stößt mein Kanu gegen ein Hindernis unter der Wasseroberfläche und stockt in seiner gleitenden Bewegung. Ich greife nach einem tiefhängenden Ast und ziehe das Boot ein Stück vorwärts. Die Wasseroberfläche ist beinahe schwarz. In der Nähe eines Baumstammes vor mir bilden sich Strudel. Unangenehm nah summen die Mücken an meinem Ohr. Ich ziehe das Paddel über die Bordwand und lasse das Boot treiben. Ohne das Plätschern des Wassers wird es nun noch stiller. Ich schaue nach oben, Lianen hängen ins Wasser herab. In einer Astgabel sitzt ein Specht mit einer Haube aus roten Federn. Als er mich sieht, legt er den Kopf schräg in meine Richtung und fliegt zu einem anderen Ast.
Im Kanu gleite ich dahin und spähe durch das Gewirr der Bäume. Je weiter ich in den Wald hineinfahre, desto merkwürdiger erscheinen sie mir. Manche sehen aus, als habe man sie auf den Kopf gestellt. Das im Wasser verschwindende Wurzelwerk, ganz anders als das der Kapokbäume, ist geradezu grotesk ineinander verschlungen, wie eine weit verästelte Baumkrone. Im Schutz dieser Wurzeln laichen die pirarucus. Der Gedanke, dass einer oder gleich mehrere dieser Riesenfische unter dem Kanu schwimmen könnten, ist mir unheimlich. Langsam schiebe ich das Paddel senkrecht nach unten. Es taucht bis zur Mitte ein, ohne den Grund zu berühren. Ich hole mein Smartphone aus der Tasche, wo es in einer wasserdichten Hülle steckt. Hier gibt es zwar keinen Empfang, aber ich habe in einem Forschungsinstitut im peruanischen Iquitos einige Seiten eines Buches abfotografiert, in dem die wichtigsten Bäume des Amazonasgebietes aufgelistet sind. Die Fotos helfen mir, wenn ich mich mit Einheimischen über die hiesige Pflanzenwelt austauschen will. Das Kanu schaukelt sanft, und ein paar Regentropfen fallen von den Blättern über mir herab. Ein Moskito sticht mich in den Finger. Schließlich finde ich den Baum mit den bizarren Wurzeln: Ficus schultesii Dugand, auch bekannt als árbol de renaco. Es handelt sich um jenen Baum aus dem Mythos der Tikuna, in dessen Wurzelwerk sich Kobolde versteckt halten sollen. Beim Anblick des Wirrwarrs aus Verzweigungen, das im Dunkel des Wassers verschwindet, liegt der Gedanke an Geheimnisvolles und Übernatürliches tatsächlich nahe, finde ich. Schließlich paddele ich weiter.
Um später auch zum Tarapoto-See zurückzufinden, präge ich mir meinen Weg so gut es geht ein. Auf einmal riecht es nach Kuhstall, so zumindest mein erster Gedanke. Dabei weiß ich, dass es weit und breit weder eine Ansiedlung noch so etwas wie einen Kuhstall geben kann. Aber genau daran erinnert mich der Geruch, der zu mir aufsteigt. Ich höre und sehe weiterhin nichts als Wasser und das Gewirr der Bäume. Dann fällt mir ein, was ein Biologe mir einige Tage zuvor erklärt hat. Die überschwemmten Waldflächen setzen Methan und Kohlendioxid frei. Einige Bäume sterben, andere verlieren Blätter und all das verrottet. Außerdem gibt es während der Regenzeit weniger Licht und Sauerstoff, der zu den Blättern und Wurzeln gelangt. Die meisten Phänomene, die die Wissenschaft abstrakt beschreibt, kann man tatsächlich irgendwo beobachten, und so lässt sich das Methan im Regenwald als übelriechendes Gas wahrnehmen. Vielleicht sind das die Kobolde der Indigenen, die einerseits Fruchtbarkeit, aber – wenn man sie in ihrem Gleichgewicht stört – auch Verderben und Unheil bringen können.