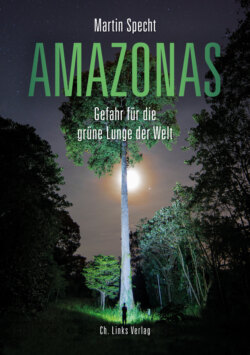Читать книгу Amazonas - Martin Specht - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Biodiversität
ОглавлениеIn den Schöpfungsgeschichten der meisten indigenen Gruppen tauchen die Menschen erst in einer dritten Welt auf. »Auftauchen« ist dabei wörtlich gemeint, denn die ersten Menschen wurden im Meer geboren. Das heißt, ihre Geister, die aus indigener Sicht das Sein ausmachen, wurden geboren. Menschen und Tiere hatten zu Anfang die gleichen Geister, nur die der Pflanzen waren von einer anderen Art. Mit der Anakonda kamen die Geister der zukünftigen Menschen und die der zukünftigen Tiere aus dem Meer den Fluss hinauf. Aus einigen wurden Menschen, aus anderen wurden Tiere. Für die Indigenen kehrt die Anakonda in jedem Jahr mit einer gereinigten Energie zurück.
»Das«, so erklärte es mir der Anthropologe Martín von Hildebrand, »ist der Pfad der Anakonda. Die Verbindung des Atlantiks mit dem Amazonas und den Anden.« Historisch ist diese Verbindung ebenfalls belegt, denn es gibt Beweise dafür, dass die indigenen Gruppen des nördlichen Amazonasgebietes von jeher in einem beständigen Austausch mit anderen gelebt haben, etwa Gemeinsamkeiten in der Sprache. Diese Verbindung erstreckt sich laut von Hildebrand über einen Korridor von der Atlantikküste Brasiliens bis in die Ausläufer der Anden in Kolumbien. »Die Indigenen sprechen von der anaconda ancestral«, sagt der Anthropologe. Man kann den Begriff sinngemäß mit »Anakonda der Vorfahren« übersetzen. Martín von Hildebrand und die von ihm gegründete Fundación Gaia Amazonas haben im Amazonasgebiet Kolumbiens dabei geholfen, die Rechte der dort lebenden indigenen Gruppen und deren Territorien zu schützen. Im nördlichen Amazonasbecken Brasiliens stehen ebenfalls viele indigene Gebiete unter Schutz. Gelänge es, sie miteinander zu verbinden, entstünde eine Art »Biodiversitätskorridor«, der dem Pfad der Anakonda entspricht, erklärt von Hildebrand. »Die Indigenen«, sagt er, »sind am besten dazu in der Lage, das Ökosystem Regenwald zu schützen. Vor allem, weil sie vom Regenwald leben. Wenn man so will, ist er ihre Bank. Die Indigenen haben nur eben keine ›Geldbank‹, sondern eine ›Biodiversitätsbank‹, die sie am Leben erhält. Und um die kümmern sie sich so, wie auch die westlichen Gesellschaften sich um ihre Banken kümmern.«
Der Vergleich, den von Hildebrand anstellt, ist interessant, sieht er doch in der Biodiversität ein überlebensnotwendiges Kapital der Regenwaldbewohner. Tatsächlich sind die Amazonasregenwälder die artenreichsten Gebiete der Welt, sogenannte Mega-Diverse-Zonen oder Biodiversitätshotspots. Unter Biodiversität versteht man die Vielfalt aller in einem bestimmten Bereich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten, einschließlich der daraus resultierenden genetischen Vielfalt. Die Vereinten Nationen haben sich in ihrer Biodiversitätskonvention auf folgende Definition geeinigt: »Biodiversität bedeutet biologische Vielfalt, die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb und zwischen den Arten und ebenso die Vielfalt der Ökosysteme.«
Grundsätzlich ist in den tropischen Gebieten der Erde die Biodiversitätsdichte deutlich höher als in den gemäßigten oder kühlen Zonen. Am Amazonas ist sie mit etwa drei Millionen Tier- und Pflanzenarten am höchsten. Auf einen Hektar kommen manchmal mehrere Tausend Arten, in Europa sind es im Durchschnitt einige Dutzend.
Einmal verbringe ich einen Tag mit einer Entomologin im brasilianischen Teil des Amazonasregenwaldes. Wir brechen frühmorgens auf und folgen einem Pfad, den uns die Einheimischen gezeigt haben. Am Mittag sind wir gerade einmal 20 Meter weit gekommen. Die Entomologin ist entzückt. Unter jedem Blatt, an jeder Blüte und auf jedem Stamm zeigen sich Insekten. Manche klein und unscheinbar, andere groß und furchteinflößend. Mit Schaudern betrachtete ich etwa die Fangbeine und Beißwerkzeuge einer Gottesanbeterin. »Dios mío«, sage ich und wende mich ab, meine Begleiterin nennt den lateinischen Namen des Insekts. Ich selbst sehe wahrscheinlich aus wie eine schwarze Fledermaus, denn ich habe mir – nicht wegen des Regens, der fiel gerade einmal nicht, sondern zum Schutz gegen die Moskitos – meinen schwarzen Regenumhang übergeworfen. So geht es im Schneckentempo über den Dschungelpfad. Ich helfe, wo ich kann, schon allein um mich zu beschäftigen – und in der Hoffnung, dass wir so schneller vorankämen. Mal halte ich einen Behälter, mal ein Blatt in die Höhe, dann die Kamera oder den Schreibblock. Insgeheim hoffe ich auf das Auftauchen größerer Tiere. Vielleicht einer Anakonda oder eines Jaguars, beide sollen ebenfalls in diesem Gebiet leben. Aber abgesehen von ein oder zwei scheuen Vögeln lässt sich nichts blicken.
Meine Begleiterin kriecht weiterhin zwischen giftig aussehenden Sträuchern herum, während ich mich abseits halte und die Wasserflasche aus dem Rucksack nehme. Gerade setze ich zum Trinken an und schiebe mir die Kapuze aus dem Gesicht, als ich bemerke, dass mich ein Augenpaar anstarrt. Zwei schwarze Pupillen zittern vor mir in der Luft. Ein Stück entfernt ein weiteres Paar. Ich bewege mich nicht und starre zurück. Die Luft um die schwarzen Punkte herum scheint zu vibrieren. Dem Blick aus dem Dschungel standhaltend, schiebe ich mich näher heran. Die Entomologin ist immer noch zwischen den Sträuchern abgetaucht. Einige Zweige knacken, als sie sich den Weg durch die Vegetation bahnt. Ich veränderte den Blickwinkel. In dem, was ich eben noch für eine Vibration in der Luft hielt, erkenne ich nun das elegant geschwungene Flügelpaar einer Libelle. Der schlanke Körper in der Mitte ist kaum zu erkennen. Nun, da ich weiß, worum es sich handelt, kann ich den Anblick genießen. Transparente Insekten, deren Augen den Eindruck erwecken sollen, als gehörten sie viel größeren Tieren, eine geschickte Mimikry. Der Regenwald ist voll von faszinierenden Lebensformen. Ich rufe die Entomologin, die sich zwar ebenfalls über meine Entdeckung freut, aber mehr an einem Insekt interessiert ist, das aussieht wie ein langer Zweig, aber Beine und Fühler hat. »Das ist eine maría palitos«, sagte sie. Eine Gespenstschrecke.
Der Amazonasregenwald ist tatsächlich bevölkert von den exotischsten und für das menschliche Empfinden bizarrsten Kreaturen. Einige davon sind beängstigend, wie die bis zu neun Meter lange und 200 Kilogramm schwere Anakonda, die mit rasiermesserscharfen Zähnen bewehrten Piranhas oder die zahlreichen – zum Teil handtellergroßen – Vogelspinnen, die ich zu meinem Leidwesen immer wieder antreffe. Doch es gibt auch Tiere, die atemberaubend schön sind: prächtige Papageien und Tukane, winzige Kolibris, die wegen ihrer schillernden Farben auch geflügelte Diamanten genannt werden, oder tiefblau leuchtende Schmetterlinge. Einige Tiere – und Pflanzen – sind beides, bedrohlich und schön. Der Jaguar und die vielen giftigen Schlangen gehören dazu. Die Piranhas und Anakondas der Amazonasregion sind, wenn man so will, Spezialisten. Wie alle Tier- und Pflanzenarten sind sie eigens ausgestattet, um sich in ihrem spezifischen Lebensraum ernähren und überleben zu können. Der Kolibri, der mit seinem an die Blütenformen seines Lebensraums angepassten Schnabel Nektar sammelt. Oder der Zitteraal, der sich mit Stromschlägen von mehr als 500 Volt gegen seine Feinde zur Wehr setzt. Frösche, deren Haut bei Berührung ein tödliches Gift überträgt, wandernde Ameisen, die eine Spur der Verwüstung im Regenwald hinterlassen. Doch warum sind diese Spezialisierungen gerade am Amazonas so ausgeprägt? In solchen, wie es scheint, üppigen Wäldern müsste doch eigentlich Nahrung im Überfluss vorhanden sein. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall – das üppige Grün täuscht jedoch darüber hinweg. So erklären sich die zahlreichen und vielfältigen Spezialisierungen, die den Tieren bei der Nahrungssuche helfen.
Auf der Exkursion mit der Entomologin fällt mir auf, dass wir zwar sehr viele Insekten, aber nur wenige andere Tiere sehen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint der Begriff der hohen Biodiversität in einem anderen Licht. Es gibt zwar unzählige Arten, doch, das haben Forschungen gezeigt, nur wenige Exemplare einer einzelnen Art pro Quadratkilometer Regenwald. Während in Europa mitunter große Gruppen einer einzelnen Vogelart, aber nur wenige unterschiedliche Arten zu beobachten sind, ist es im Amazonasgebiet meistens genau umgekehrt. Hinzu kommt, dass die überwiegende Zahl aller Arten – und auch ein hoher Anteil der im Regenwald vorhandenen Biomasse, mehr als 30 Prozent – aus Insekten besteht.
Als Alexander von Humboldt den Regenwald im Gebiet des Orinoco und des Casiquiare bereiste und erforschte, bezeichnete er ihn als »grüne Wüste, in der man auch verhungern kann«. Auch die Berichte der ersten Konquistadoren, die sich zum Amazonas vorgewagt hatten, sprechen davon, dass es äußerst schwierig und mühselig gewesen sei, hier etwas Essbares aufzutreiben. Einige waren gar dem Hungertod nahe. Den conquistadores fiel auf, dass die Indigenen, denen sie begegneten und deren Dörfer sie besuchten, ebenfalls nicht im Überfluss lebten, sondern zum Teil selbst Hunger litten. Für diesen Widerspruch zwischen einerseits üppiger Natur und der mühseligen Suche nach Nahrung andererseits gibt es eine interessante Erklärung.