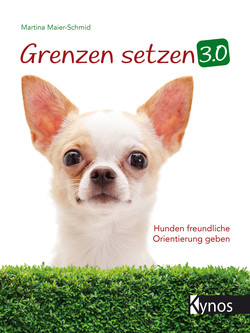Читать книгу Grenzen setzen 3.0 - Martina Maier-Schmid - Страница 7
Оглавление2. Der Ruf nach Grenzen in der Hundeerziehung
Im Zusammenhang mit Hundeerziehung wird der Ruf nach Grenzen meist in dem Sinne genutzt, dass es um Einengung und Beschränkung geht. In der Regel geht es darum, dass der Halter seinem Hund eine Grenze setzt, wenn dieser aus Sicht des Menschen unerwünschtes Verhalten zeigt, das stört oder eventuell auch gefährlich ist. Das unerwünschte Verhalten soll abgestellt werden, indem der Hund seine Grenzen aufgezeigt bekommt. In diesem Zusammenhang fallen die Sätze wie „bis hierher und nicht weiter“, „jetzt reichts aber“, „der (gemeint ist der Hund) weiß genau, dass er das nicht soll“ oder „der muss doch wissen was falsch ist“, „das darf der doch nicht, das ist gefährlich“. Der Fokus liegt dabei auf den Verhaltensweisen des Hundes, die der Mensch als störend empfindet oder die tatsächlich gefährlich werden könnten.
Warum haben Menschen das Gefühl, Grenzen setzen zu müssen?
Es kann unterschiedliche Gründe haben, warum ein Mensch das Verhalten seines Hundes als störend empfindet und verändern möchte. Viele Hundehalter möchten ihre Hunde so erziehen, dass sie niemand belästigen oder schaden. Sie wollen Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr Hund in seinem Lebensumfeld für niemanden eine Gefahr oder Belastung darstellt. Die Katze des Nachbarn soll nicht gescheucht werden, die Kindergartenkinder von nebenan sich sicher fühlen können, der Jogger oder Radfahrer gefahrlos am Hund vorbeikommen. Wenn dieses Ziel erreicht werden kann, ist das für alle Beteiligten ein Gewinn.
Vorstellung und Wirklichkeit
Manchmal sind die unbewussten Idealvorstellungen des Hundehalters, wie schnell ein Hund das alles lernen kann, sehr ambitioniert. Die Erkenntnis, dass Verhaltenstraining geplant und kleinschrittig aufgebaut werden muss und auf viele unterschiedliche Situationen und Erregungszustände übertragen und generalisiert werden muss, ist anfänglich häufig nicht vorhanden und reift erst im Laufe der Zeit. Frust und Ärger sind vorprogrammiert.
Manchmal sind die Idealvorstellungen, was der eigene Hund können soll, weit von dem entfernt, was er zu diesem Zeitpunkt leisten kann. So würde der Hundehalter seinen Hund gerne immer und überall frei laufen lassen können. Der Hund jagt aber gerne oder rennt freudig zu allen entgegenkommenden Hunden und/oder Menschen hin. Oder der Hundehalter wünscht sich sehr, dass der eigene Hund von allen Menschen jederzeit gestreichelt werden kann, was dieser aber mit Abwehrverhalten vereitelt. Die Diskrepanz zwischen der Wunschvorstellung des Halters und dem Verhalten des Hundes kann ebenfalls Frust und manchmal sogar Wut beim Menschen auslösen. Genau genommen liegt hinter dem Frust und hinter der Wut die Trauer über die geplatzten Traumvorstellungen. Dies umso mehr, wenn sich im Laufe der Zeit vielleicht herausstellt, dass der Hund auch langfristig die Erwartungen nur sehr schwer oder gar nicht wird erfüllen können. Gesellt sich die Idee dazu, dass über die „richtige“ Erziehung auch alles erreicht werden kann, steigt der Druck für alle Beteiligten, weil der Hundehalter sich unfähig oder inkompetent erlebt, wenn dies nicht oder nur eingeschränkt gelingt.
Menschen haben Wunschvorstellungen, wie ihr Hund sich verhalten soll und vergleichen schnell mit anderen Hunden. Erfüllen sich diese Erwartungen nicht, empfinden Menschen Frust und Wut, weil sie um ihre Träume trauern. Das kann erheblichen Handlungsdruck verursachen.
Immer wieder erleben Hundebesitzer auch, dass ihnen die „Schuld“ am Verhalten ihres Hundes gegeben wird. Wer seinen Hund „richtig“ erzieht, hat solche Schwierigkeiten nicht. Da muss man einfach mal richtig durchgreifen. Wer eine gute Bindung zu seinem Hund hat, genug Sicherheit ausstrahlt, selbstbewusst genug auftritt, dem Hund genug Sicherheit gibt, hat einen Hund, der zuverlässig folgt und keine „Probleme“ macht. Scham- und Schuldgefühle können dadurch entstehen und wachsen und schaffen zusätzlichen Handlungsdruck.
Interpretieren und bewerten
Es passiert schnell, dass Hundehalter das Verhalten des Hundes als nervig, ungebührlich, frech, dominant, unverschämt, unverständlich, unmöglich, vorsätzlich, einschränkend, aufsässig, unpassend, absichtlich, gegen den Menschen gerichtet und so weiter bewerten. Diese Bewertung löst beim Hundehalter Gefühle wie Frustration, Ärger oder Wut über das Hundeverhalten aus, was sich in den oben genannten Sätzen ausdrückt. Mit der Frage, ob Hunde solche Absichten überhaupt haben können, befassen wir uns später noch eingehend.
Oder Hundehalter haben schon in das Training ihres Hundes investiert und erwarten, dass er zu jeder Zeit gelernte Signale befolgen kann. Sie sind enttäuscht und frustriert, vielleicht auch resigniert und hilflos, wenn ihr Hund in bestimmten Situationen dann doch nicht auf ein Signal hört und bewerten dies als absichtliche, ungehorsame oder widersetzliche Handlung des Hundes. Es kann sehr frustrierend sein, zu üben und zu trainieren und dann zu erleben, dass es Situationen gibt, in denen das Geübte dennoch nicht funktioniert.
Unsicherheit und Sorge
Und immer wieder spielen auch Unsicherheit und Angst beim Menschen eine Rolle, wenn der Ruf nach Grenzen für den Hund laut wird. Sie haben vielleicht in Büchern oder in der Hundeschule gelernt, dass das Nichtbefolgen von Signalen eine Missachtung ihrer Chefposition sei und es gefährlich sei, wenn der Hund nicht endlich lernen würde, sich unterzuordnen. Sie greifen dann durch, manchmal gegen das eigene Bauchgefühl, weil sie große Angst haben, dass ihnen ihr Hund sonst irgendwann nur noch auf der Nase herumtanzt. Bei jagenden Hunden oder Hunden, die starkes Abwehrverhalten gegenüber anderen Hunden oder Menschen zeigen, ist die Angst der Halter häufig groß, dass ein Lebewesen irgendwann einmal schwer verletzt werden könnte. Hier entsteht viel Handlungsdruck für den Menschen.
Die unangenehmen Emotionen beim Hundehalter sind ein guter Nährboden dafür, dass Menschen Trainingswege annehmen, die das störende Verhalten des Hundes sehr in den Fokus nehmen und über Strenge und unangenehme Einwirkungen auf den Hund abstellen sollen.
Ein in Schlüsselsituationen nicht gehorchender Hund baut verständlicherweise großen Druck bei seinem Halter auf. Dieser erhöht die Bereitschaft, zu rabiaten Methoden zu greifen – was das Problem aber nicht löst, sondern langfristig eher verschlimmert. Atmen Sie durch! Es gibt andere Lösungen!
Was bedeutet Grenzen setzen für den Trainingsansatz?
Die Forderung, dass Hunde Grenzen brauchen, ist häufig gepaart mit Trainingstechniken, die das unerwünschte Verhalten unterbrechen sollen. Sehr oft wird dieses Vorgehen in der Trainingsliteratur oder von Hundefachleuten damit begründet, dass der Hund dominant sei und wissen müsse, wo er in der Rangordnung stehe. Es gibt immer noch etliche Trainingskonzepte, die auf der Basis von Dominanz- und Rangordnungsvorstellungen entwickelt und gestaltet werden. In der Praxis bedeutet dies dann häufig, dass das unerwünschte Verhalten abgewartet oder sogar provoziert wird, um dann durch Einwirkungen abgestellt zu werden, die für den Hund unangenehm, erschreckend oder gar schmerzhaft sind. Die Palette der Einwirkungen hat eine weite Streuung: Da wird der Hund an der Leine weitergezerrt, der Hund wird angeschrien, gezwickt, getreten, mit Wasser bespritzt, angezischt, mit Gegenständen beworfen, körpersprachlich bedrängt, abgedrängt, mit einem Leinenruck bedacht und vieles mehr. Es werden Hilfsmittel eingesetzt, die schmerzhaft auf den Körper einwirken oder unangenehme Geräusche machen. Meist wird die Einwirkung dann beschönigend anders genannt, sodass nicht immer direkt deutlich wird, über welchen Wirkmechanismus gearbeitet wird. Es sei Kommunikation mit dem Hund, Hunde machen das untereinander auch so, das tut nicht weh, es ist wichtig, dass der Hund weiß, wo sein Platz in der Rangordnung ist, es stärkt die Bindung, es ist artgerecht.
Bindung entsteht nicht durch Machtdemonstrationen!
Für mich muss klar unterschieden werden, ob solche Einwirkungen bewusst als Trainingsmittel zur Verhaltensänderung eingesetzt werden oder ob einem Hundehalter einfach mal die Nerven blank liegen und die Impulskontrolle versagt und er dann aus der Haut fährt. Als Trainingsmittel sind diese Maßnahmen nicht sinnvoll und zielführend, wie wir später noch ausführlich besprechen werden.
Der Ruf nach Grenzen ist somit häufig ein Ausdruck davon, dass sich Menschen auf das unerwünschte Verhalten fokussieren und dieses abstellen wollen, um für sich selbst zu sorgen oder Schaden für Dritte abzuwenden. Dahinter steht auch häufig die eigene Belastung, die den Halter an die eigenen Grenzen der Belastbarkeit bringen kann. Die Annahme, dass dies nur über das Setzen von Grenzen im Sinne einschränkender Regeln ginge, ist noch weit verbreitet. Sie begegnet uns nicht nur in der Hundeerziehung, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und der Kindererziehung. Es ist also im Grunde nicht verwunderlich, dass dieser Blinkwinkel auch in der Hundeerziehung weit verbreitet ist.
Auch das ist eine Aussage, die oft zu hören und zu lesen ist. „Der Hund will ja nur seine Grenzen testen“. Diese Annahme suggeriert unterschwellig, dass der Hund ein Verhalten, das dem Menschen nicht angenehm ist, absichtlich und wider besseres Wissen zeigt, um zu prüfen, ob der Mensch konsequent ist oder wirklich Chef ist und in dem Bewusstsein, dass es dem Menschen nicht gefällt. Auch die Annahme, dass Hunde Verhalten vorspielen, um zu protestieren, weil es nicht nach ihrem Willen ginge, oder um ihren Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren, ist noch weit verbreitet. Irgendwie scheinen Menschen für diese Sorge oder Angst empfänglich zu sein. Im Grunde beinhalten diese Aussagen die Annahme, der Hund würde seinen Menschen in Frage stellen und gegen ihn arbeiten wollen.
Um zu verstehen, warum das nicht so ist, ist wichtig zu wissen: Verhalten entsteht nicht im luftleeren Raum. Verhalten dient der Anpassung an das aktuelle Lebensumfeld. Es gibt immer auslösende Bedingungen für Verhalten. Dazu zählen gesundheitliche Faktoren, genetische Veranlagung, Stressbelastung, Frustrationsbelastung, Lernerfahrungen, hormoneller Zustand, Erregungslevel, Präsenz von Auslösern und so weiter. Verhalten verfolgt ein Ziel, es hat einen Zweck, soll eine Funktion erfüllen. Es gibt aus Hundesicht immer gute Gründe für das eigene Verhalten, auch wenn es aus Menschensicht nicht immer nachvollziehbar ist oder gefällt.
Es gibt immer gute und nachvollziehbare Gründe für ein Verhalten des Hundes, auch, wenn dies dem Menschen nicht gefällt.
Verhalten dient dazu, das eigene Wohlbefinden zu erreichen und zu sichern und eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Alle Säugetiere sind sich hier sehr ähnlich. Hunde registrieren, ob das gezeigte Verhalten dazu führt, das eigene Wohlbefinden zu erreichen und zu sichern, Bedürfnisse dadurch erfüllt werden oder eben auch nicht. Das Verhalten wird dann angepasst. Diesen Vorgang nennt man Lernen. Was Hunde nach heutigem Wissen von Menschen unterscheidet, ist die Fähigkeit der bewussten Reflektion des eigenen Verhaltens und wie es auf andere wirkt. Und damit auch der bewusste Einsatz von Verhalten, um ein Gegenüber bewusst und gegen dessen eigentlichen Willen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen, zu manipulieren oder das Gegenüber in Frage zu stellen und zu ärgern. Anzunehmen, Hunde könnten beispielsweise Angst oder Krankheit vorspielen, um den Menschen zu beeinflussen, sich gegen den eigenen Willen für ihre Bedürfnisse entscheiden, ist aus meiner Sicht eine „Vermenschlichung“ des Hundes, während das Zugestehen von der Empfindungsfähigkeit von Schmerzen, Emotionen und Bedürfnissen auf einer wachsender breiten Basis von Wissenserkenntnissen von Biologen, Ethologen, Verhaltensforschern und anderen Wissenschaftlern beruht.
Hunde täuschen nicht bewusst ein Verhalten vor, um ihre Menschen zu manipulieren.
Natürlich kann ein Hund, der gerade Lust hat, Ball zu spielen, lernen, dass sein Mensch mit ihm spielt, wenn er ihm lange genug den Ball in den Schoß wirft, obwohl der Mensch eigentlich gemütlich Kaffee trinken möchte. Einfach, weil das Verhalten immer wieder dazu führt, dass der Hund erreicht, was er haben möchte. Das bedeutet aber nicht, dass er absichtlich und willentlich seinen Menschen ärgern und nerven möchte und austestet, wie weit er gehen kann. Es bedeutet lediglich, dass er gelernt hat: Wenn ich den Ball immer wieder in den Schoß werfe, spielt mein Mensch mit! Also wirft er den Ball in den Schoß des Menschen, wenn er Lust hat, mit ihm zu spielen. Hunde, die gerne spielen, können dabei sehr ausdauernd sein. Vermutlich wollte der Mensch seinem Hund dieses Verhalten nicht beibringen, und dennoch hat er es unbewusst verstärkt, indem er dann doch noch irgendwann mitgemacht hat. Somit bleibt es auch seine Verantwortung, sich einen Weg zu überlegen, wie der Hund lernen kann, zu erkennen, wenn sein Mensch nicht mitspielen möchte und das auch zu akzeptieren, ohne ihn ausdauernd zu belagern. Eine häufig empfohlene Lösungsstrategie ist es, das Verhalten des Hundes einfach zu ignorieren. Bei Hunden, die eine Zeit lang immer wieder durch dieses Verhalten erreicht haben, dass der Mensch mit ihnen spielt, führt dies häufig dazu, dass sie das Verhalten noch vermehrt zeigen und sehr aufdringlich werden können. Verhalten, das immer funktioniert hat und plötzlich nicht mehr funktioniert, wird zunächst vehementer gezeigt. Darin zeigt sich der Frust, dass dieses Verhalten plötzlich nicht mehr klappt. Und es wird sichtbar, dass der Hund keine Idee hat, was er stattdessen tun könnte. Dies wird schnell als frech, aufmüpfig, dominant, grenzüberschreitend vom Menschen gedeutet, dabei handelt es sich schlicht um Löschungstrotz, also Lernverhalten und hat nichts damit zu tun, dass der Hund mal ausprobieren möchte, wie weit er gehen kann.
Bei Fenjo wurde das Verhalten „Mensch ausdauernd zum Ballspielen auffordern“ unabsichtlich verstärkt. Nervig für den Menschen – aber sicher kein Fall von „Grenzen testen“!
Hunde „testen keine Grenzen“. Hunde lernen, was sich für sie lohnt!
Ein Hund, der entgegenkommende Menschen anknurrt, weil er sich vor ihnen ängstigt, sich bedrängt oder bedroht fühlt, möchte mehr Abstand zum fremden Menschen haben. Dies teilt er durch Knurren mit, wenn seine vorausgegangenen unscheinbareren körpersprachlichen Signale bis dahin nicht beachtet wurden. Das ist im biologischen Normalprogramm des Hundes so angelegt. Der Hund wird nun oder im Verlauf lernen, ob Knurren dazu führt, dass sich die Distanz zum fremden Menschen erhöht oder zumindest nicht weiter verringert oder ob Knurren nicht dazu führt. Er wird nicht darüber nachdenken, dass sein Verhalten seinem Menschen peinlich ist, weil sich das nicht gehört und er nicht unangenehm auffallen möchte. Und testet es dann auch nicht erneut, um zu prüfen, wie weit er gehen kann, bis sein Mensch das nicht mehr ertragen kann. Der Hund will es auch nicht für seinen Menschen regeln, sondern für sich selbst. Der Hund macht macht entweder die Lernerfahrung, dass Knurren Distanz zu einem Menschen schafft, der ihm Angst macht, oder dass es nichts daran ändert, dass dieser Mensch da ist oder gar näher kommt. Und diese Lernerfahrung wird sein zukünftiges Verhalten beeinflussen. Wenn nun sein Halter dafür sorgt, dass die Distanz zum fremden Menschen so bleibt, dass sie für ihn in Ordnung ist, wird das Verhalten Knurren nicht gezeigt und es wird eine sehr gute Grundlage geschaffen, mit dem Hund zu erarbeiten, dass er fremde Menschen nicht mehr als bedrohlich einstuft und dann auch im weiteren Trainingsverlauf an ihnen vorbeigehen zu können.
Ein Hund, der sofort zu bellen beginnt, wenn sein Mensch die Wohnung verlässt und ihn allein zuhause lässt und dabei dauerhaft bellt oder Sachen zerstört, hat Trennungsschmerz und versucht, seinen Bindungspartner zurückzurufen beziehungsweise seinen Stress abzubauen. Er fühlt sich allein, verlassen und weiß nicht, wie er wieder ins seelische Gleichgewicht kommen kann. Er hat schlicht noch nicht lernen können, entspannt alleine zu bleiben. Er will mit diesem Verhalten weder seinen Menschen kontrollieren noch Grenzen testen und braucht dringend die Unterstützung seines Menschen. Wenn der Mensch zurückkommt, solange der Hund bellt, wird der Hund merken, dass Bellen seinen Bindungspartner zurückbringt und dies möglichweise häufiger machen. Er will damit aber nicht den Menschen manipulieren, sondern sorgt für das eigene Wohlbefinden, für seine eigene Sicherheit. Er möchte sich handlungsfähig fühlen, um seine eigene Befindlichkeit beeinflussen und die Situation bewältigen zu können. Auch hier wird häufig empfohlen, das Bellen zu ignorieren. Wenn das Bellen für den Hund eine entlastende Funktion hat, ihm hilft, seinen Trennungsstress besser ertragen zu können, wird das Ignorieren des Bellens durch den Menschen nicht dazu führen, dass der Hund zukünftig nicht mehr bellen wird – weil das Bellen für ihn eine entlastende Funktion erfüllt und dazu führt, dass er ein bisschen Druck loswerden kann. Wenn das Bellen keine entlastende Funktion hat und den Bindungspartner nicht zurückbringt, kann das dazu führen, dass der Hund nicht mehr bellt. Für diesen vermeintlichen Erfolg zahlt der Hund einen hohen Preis. Es ist für den Hund enorm frustrierend, belastend und führt nicht dazu, dass das Alleinebleiben für den Hund einfacher wird, im Gegenteil. Es kommt noch dazu, dass der Hund auch noch seiner Bewältigungsstrategie beraubt wird. Vielleicht beginnt er statt des Bellens Dinge zu zerstören oder Stresspippi in der Wohnung zu machen, was das „Problem“ auch für den Menschen nur verlagert. Vielleicht resigniert er, stellt alle Aktivitäten zum Stressabbau ein und der gesamte Stress bleibt im Inneren des Hundes, was nach einer gelungenen „Problemlösung“ aus Sicht des Menschen aussehen kann, für den Hund aber mit einer hohen Stressbelastung einhergeht und langfristig sogar krank machen kann. Wenn das Bellen als Signal des Hundes verstanden werden kann, dass er mit der Situation nicht zurechtkommt, ist der Gedanke, ihm hier unbedingt eine Grenze setzen zu müssen, weit weg. Und der Blick wird frei für die Frage, wie der Hund unterstützt werden kann, um das Alleinebleiben zukünftig entspannt bewältigen zu können.
Hunden, die sich unerwünscht verhalten, wird oft eine Absicht oder ein Streben nach Kontrolle ihrer Menschen unterstellt. Dieser Blickwinkel ist nicht zielführend! Fragen Sie sich stattdessen: Was sind die Gründe für sein Verhalten?
Wenn ein Hund ein Signal, das bereits geübt wurde und in bestimmten Situationen auch abrufbar ist, nicht ausführt, interpretieren Menschen dies schnell so, dass er seine Grenzen testet, einfach keinen Bock hat oder gar dominant ist. Dahinter steckt die Annahme, dass Hunde ein Bedürfnis hätten, sich gegenüber ihrem Menschen zu erheben oder wie oben schon beschrieben bewusst gegen den Willen des Menschen aktiv entscheiden. Die weitaus näherliegende Erklärung ist, dass das Signal nicht kleinschrittig und zuverlässig etabliert wurde und/oder noch nicht ausreichend generalisiert wurde und somit bei hoher Erregungslage des Hundes oder bei Ablenkungen noch nicht gezeigt werden kann. Hunden fällt es schwer, Verhalten zu generalisieren. Manchmal hat sich vielleicht auch beim Training der ein oder andere Fehler oder Schlendrian eingeschlichen. Auch gesundheitliche Faktoren können eine Rolle spielen, wenn es mal nicht funktioniert. Vielleicht klappt der Rückruf schon sehr gut, wenn Menschen oder Hunde entgegenkommen, aber beim flüchtenden Reh eben noch nicht. Sitz geht bei Läufigkeit plötzlich weniger gut als außerhalb der Läufigkeit. Oder bei einer Hundebegegnung ist ein Hund körperlich noch so angespannt, dass er sich nicht gut setzen kann, weil die Muskulatur noch so fest ist, dass das schwer fällt. Die Umorientierung zum Menschen klappt gut, wenn ein entgegenkommender Mensch noch dreißig Meter entfernt ist, aber in zehn Meter Entfernung noch nicht, weil die Erregung da noch viel zu hoch ist.
Wenn ein Hund nicht gehorcht, ist das eine wichtige Information für den Menschen, wo noch weiterer Trainingsbedarf besteht.
Könnte es auch ganz anders sein?
Eine andere Betrachtungsweise ist es, davon auszugehen, dass das Verhalten eines Hundes immer einen guten Grund, eine aus Hundesicht logische Ursache, einen biologisch sinnvollen Hintergrund hat. Wie oben bereits erwähnt entsteht Verhalten nicht im luftleeren Raum. Es gibt auslösende Bedingungen für Verhalten und Verhalten hat eine Konsequenz, es hat Erfolg oder auch keinen Erfolg. Die auslösenden Bedingungen führen dazu, dass Verhalten gezeigt wird. Ob das gezeigte Verhalten Erfolg oder Misserfolg zur Folge hat, beeinflusst wiederum, ob das Verhalten in Zukunft mit einer größeren Wahrscheinlichkeit häufiger oder seltener gezeigt wird.
Verhalten entsteht nicht im luftleeren Raum. Es wird bestimmt durch auslösende Bedingungen und die Konsequenzen, die es für den Hund hat.
Mit einer solchen Herangehensweise wird es möglich, zu erforschen, welche auslösenden Faktoren für das Verhalten bestehen. Im ersten Schritt ist es sinnvoll, wenn das Verhalten des Hundes zunächst sachlich und wertungsfrei beschrieben wird. Eine Beschreibung enthält noch keine Deutungen und Interpretationen, sondern nur das, was konkret beobachtbar ist. Ein gutes Bild dafür ist die Vorstellung, das zu beschreiben, was man auf einem Bild oder einer aufeinanderfolgenden Bilderserie sehen kann. Wenn wir konkrete Beobachtungen beschreiben, bleibt unser Blick offener für mehrere Deutungen, warum das so passiert ist.
Um den Grund für ein Verhalten auf die Spur zu kommen, beschreiben Sie es zunächst neutral, ohne Wertung und Interpretation.
Wenn ein Hund beim Kuscheln (plötzlich) zuschnappt, könnte die Beschreibung so aussehen: „Wir haben friedlich gekuschelt, der Hund hat das genossen und plötzlich aus dem Nichts heraus zugebissen. Da muss jetzt echt was passieren, so ein freches, respektloses und unberechenbares Verhalten darf man keinesfalls akzeptieren.“ Oder die Beschreibung kann so lauten: „Mein Hund lag neben mir, ich habe ihn mit der rechten Hand gestreichelt, erst am Bauch, dann am Rücken. Mein Hund hat alle vier Pfoten in die Luft gestreckt und die Augen geschlossen. Als meine Hand dann am Kopf gestreichelt hat, hat er den Kopf rumgerissen und meine Hand in den Fang genommen, den Fang wieder zugemacht und nach fünf Sekunden wieder aufgemacht. Auf meiner Hand waren leicht erkennbare Zahnabdrücke, aber keine Verletzung der Hautoberfläche zu sehen.“
Mit dieser Beschreibung wird deutlich, dass es beobachtbare Körpersignale gab, die darauf hindeuten, dass der Hund das Kuscheln zunächst entspannt genießen konnte, bis die Hand am Kopf ankam. Erst dann erfolgte eine schnelle Körperaktion, eine Abwehrreaktion. Diese plötzliche Reaktion des Hundes deutet auf einen schnellen emotionalen Umschwung beim Hund hin, wie ihn Schreck- und Schmerzreaktionen mit sich bringen. Also kann von da aus weiter überlegt werden: ist es schon häufiger vorgekommen, dass der Hund mit Erschrecken auf eine Annäherung mit der Hand im Kopfbereich reagiert hat? Könnte es sein, dass der Hund Schmerzen hat, Zahnweh, Ohrenweh, Augenprobleme? Wenn eine Untersuchung beim Tierarzt dann eine Ohrenentzündung ergibt, hat die Berührung der Hand im Ohrbereich plötzliche Schmerzen ausgelöst, die zur Reaktion des Schnappens geführt hat. Eine sofortige Behandlung der Ohrenentzündung verändert die auslösenden Bedingungen für das Verhalten und kann dazu führen, dass es beim einmaligen Schnappen bleibt. Ein Hund, der noch nicht ganz stubenrein war und plötzlich wieder vermehrt reinpinkelt, könnte eine Blasenentzündung haben. Wird diese behandelt, kann das Training zur Stubenreinheit erfolgreich fortgesetzt werden.
Verhalten hat immer gute Gründeerforschen Sie die auslösenden Bedingungen für Verhalten.
Wenn Hundebegegnungen problematisch sind, kann es helfen, anfangs sehr kleinschrittig mit viel Distanz zum Auslöser (fremder Hund) zu trainieren. Das Ergebnis kann dann so entspannt aussehen wie hier.
Ein Tierschutzhund aus dem Ausland, der neu eingezogen ist, ist vielleicht durch die in Deutschland stark belebte Umwelt reizüberflutet, hat möglicherweise durch tägliche längere Gassigänge Muskelkater und ist durch die Einengung auf bestimmte Liegeplätze und eine kurze Leine draußen stark frustriert. Dies alles führt zu einer starken Grunderregung, die sich unter anderem draußen in heftigem Ziehen an der Leine zeigen kann. Kürzere Gassigänge in reizarmer Umgebung und eine Schleppleine am Brustgeschirr befestigt können Abhilfe bringen, da Frustration verringert, der Hund körperlich und auch psychisch nicht überfordert wird und mehr zur Ruhe kommt, was zu einer entspannteren Grundlage für das Training führt.
Wenn ein unerwünschtes Verhalten dauerhaft auftritt, lohnt es sich, zu prüfen, wodurch es aus Hundesicht Erfolg hat. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob und wie die Situation verändert werden kann, damit das Verhalten nicht immer wieder zum Erfolg führt. Ein Hund, der vor anderen Hunden Angst hat und diese deshalb auf Distanz halten will und dies durch Verbellen und/oder Anknurren auch erreicht und sich dadurch erleichtert fühlt, kann am Anfang eines Trainings so viel Distanz zum Auslöser erhalten, dass das Verbellen und Anknurren nach Möglichkeit nicht mehr auftritt. Damit wird das Bedürfnis des Hundes nach ausreichend Abstand und Sicherheitsgefühl erfüllt und sichergestellt, dass das aus Menschensicht unerwünschte Verbellen und/oder Anknurren sich nicht immer weiter festigt. Auf dieser Basis kann dann mit einem Trainingsplan erarbeitet werden, dass der Hund lernen kann, an anderen Hunden Schritt für Schritt auf immer kürzere angemessene Distanz entspannt vorbei zu gehen.
Wenn ein Verhalten immer wieder gezeigt wird, suchen Sie nach dem Verstärker, der es immer wieder festigt!
Die Fragestellung wäre möglich, ob Signale und Erlerntes zwar schon ganz gut funktionieren, aber bei der Generalisierung noch Übungsbedarf besteht und wie das Verhalten zuverlässig bei steigenden Ablenkungen und / oder steigender Erregung trainiert werden kann. Frei nach dem Zitat: Hunde zeigen immer, was man sie gelehrt hat. Wenn Verhaltensweisen als das Bestreben, eigene Bedürfnisse ohne Hintergedanken (alternativ als biologisches Normalverhalten) zu erfüllen begriffen werden, kann dies dem Menschen die Wut und den Frust nehmen, dass ein Hund das tut, um ihn zu ärgern oder zu hinterfragen.
Und ausgehend von einem solchen Blickwinkel stellt sich die Kernfrage: Können unerwünschte oder störende Verhaltensweisen eines Hundes nur über Einengung und Beschränkung des Hundes und gegebenenfalls durch aversive Trainingsmittel verändert werden? Oder gibt es auch andere Wege, um unerwünschtes Verhalten zu begrenzen und zu verändern? Diesen Kenntnissen und Fragen widmen sich die nächsten Kapitel des Buches.
Überprüfen Sie auslösende und verstärkende Faktoren für das Verhalten Ihres Hundes und verändern Sie diese entsprechend. Dann ändert sich auch das Verhalten Ihres Hundes.
Wenn der Hund beispielsweise auf Ihren Rückruf nicht hört, hat dies nichts mit Ihnen als Person oder dem Testen von Grenzen zu tun, sondern nur damit, dass Sie ihn noch nicht ausreichend in verschiedenen Situationen trainiert haben.