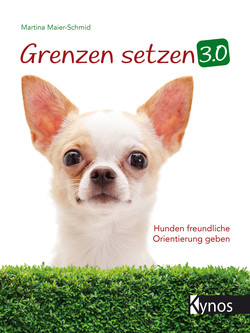Читать книгу Grenzen setzen 3.0 - Martina Maier-Schmid - Страница 8
Оглавление3. Braucht Zusammenleben Grenzen?
Im Zusammenleben von Hunden und Menschen kann es kaum ohne Regelungen gehen, wie es ja auch im Zusammenleben menschlicher Familien nicht ohne Übereinkommen von Abläufen und Umgangsformen gehen kann. Die Vorlieben und Bedürfnisse aller stehen im Raum und wollen miteinander abgeglichen werden. Friedliches, konfliktfreies Zusammenleben klingt viel einfacher, als es im Alltag häufig ist. Wenn sich die Bedürfnisse des Menschen und die des Hundes (stark) voneinander unterscheiden, entstehen schnell Konflikte.
Grenzen setzen sichert das eigene Wohlbefinden
Nehmen wir das Beispiel, dass ein Mensch es nicht mag, wenn der Hund auf dem Sofa liegt, weil er es unhygienisch findet. Sein Hund wiederum findet das Sofa als weichen, warmen, gemütlichen und schön nach Mensch duftenden Liegeplatz unwiderstehlich. Daraus entsteht ein Konflikt zwischen den Bedürfnissen des Hundes und den Bedürfnissen des Hundehalters, der irgendwie aufgelöst werden muss. Für eine Klärung gibt es immer mehrere Möglichkeiten.
Der Hundehalter nimmt für sich in Anspruch, sein Bedürfnis zu sichern und verbietet dem Hund, auf dem Sofa zu liegen. Das könnte er erreichen, indem er mit dem Hund schimpft, wenn dieser auf dem Sofa liegt oder gerade auf dem Weg zum Sofa ist. Er könnte ihn vom Sofa herunterziehen, etwas nach ihm werfen, wenn er auf dem Sofa liegt, etwas auf das Sofa legen, was ziept und pikst, wenn der Hund draufgeht und so weiter. Der Fokus dabei liegt auf einer Einschränkung des Hundes durch Einwirkungen, die für ihn unangenehm sind, ihn erschrecken oder ihm wehtun. Wenn der Hund nicht mehr auf das Sofa geht, ist das Bedürfnis des Menschen erfüllt, das Wohlbefinden des Menschen gesichert. Für den Menschen fühlt sich das gut an. Für den Hund bedeutet es Verlust – und möglicherweise bauen sich Ängste vor den Einwirkungen und/oder vor seinem Menschen auf.
Eine andere Herangehensweise wäre es, dass der Hund schlicht lernen darf, dass er woanders ebenfalls komfortabel liegen und einen Großteil der Bedürfnisse „warm, gemütlich, weich und schön nach Mensch duftend“ befriedigen kann. Das kann direkt auf dem Boden am Sofarand sein, eine besonders gemütliche sonstige Liegestelle, ein direkt an das Sofa angestellter Sofahocker, den nur der Hund benutzt – oder was auch immer der jeweiligen Familie an kreativen Möglichkeiten einfällt. Wie gut der Hund die Alternativen annehmen kann, wird damit zusammenhängen, wie groß sein Bedürfnis nach dem Sofaplatz ist und wie gut die dazugehörigen Menschen es ihm beibringen, woanders liegen zu können und wie gut es ihnen gelingt, die Bedürfnisse des Hundes dabei zu berücksichtigen.
Grenzen sind individuell und können für jedes Mensch-Hund-Team andere sein.
Sally liebt es, in der Nähe ihrer Menschen zu sein und sich dabei weich irgendwo anlehnen zu können. Dieses Körbchen vor dem Sofa bietet das alles – und das Sofa bleibt frei und sauber.
Auch das ist eine Möglichkeit, den Bedürfnissen von Mensch und Hund Rechnung zu tragen: Hund glücklich, Sofa sauber!
Eine weitere Möglichkeit wäre, zu überlegen, wie sowohl das Hygienebedürfnis des Menschen erfüllt werden kann als auch das Bedürfnis des Hundes, auf dem warmen, weichen, nach Mensch riechenden Sofa liegen zu können. Zum Beispiel, indem man dem Hund eine Decke auf das Sofa legt und eine Inkontinenzauflage darunter, die das Polster vor Nässe, Haaren, Schuppen und Schmutz schützt. Oder es wird ein Körbchen mit hohem Rand auf das Sofa gestellt, in dem der Hund dann ruhen und schlafen kann und das Sofa geschützt wird.
Häufig erlebe ich Kunden, die Angst haben, ihre Hunde könnten aggressiv oder völlig unkontrollierbar werden, wenn sie jetzt nicht durchgreifen. Manchmal ist diese Sorge bereits da, bevor überhaupt ein Problem entstanden ist. Es reicht das Kopfkino, was passieren könnte oder vielleicht auch Vorerfahrungen mit einem früheren Hund oder einem Hund aus der Kindheit. Manchmal entwickeln sich diese Bedenken auch durch Mahnungen aus der Umwelt, von Trainern oder aus Büchern. Manchmal ist es auch die Sorge aus Unsicherheit, ob das überhaupt jemals was wird.
Bei Hundehaltern, deren Hunde Abwehrverhalten gegen Hunde und/oder Menschen zeigen, ist die Angst, dass das Abwehrverhalten richtig eskalieren wird, wenn sie nicht sofort deutlich durchgreifen, häufig sehr hoch. Sie möchten sich mit ihrem Hund sicher fühlen, die Gewissheit haben, dass kein anderes Lebewesen durch den eigenen Hund gefährdet ist. Wenn ein Hund Menschen aus der Familie mit Abwehrverhalten begegnet, ist die emotionale Belastung sehr hoch. Das Sicherheitsbedürfnis ist hier selbstverständlich groß und das Vertrauen wird beschädigt. Vor allem dann, wenn die Menschen sich nicht erklären können, warum der Hund gegen sie Abwehrverhalten zeigt. Und es ist wichtig, sich im Umgang mit dem eigenen Hund sicher fühlen zu können.
Auch hier dienen einschränkende Grenzen der Sicherung des Wohlbefindens des Menschen. Es ist vielen Hundehaltern ein sehr vertrauter Gedanke, Abwehrverhalten um jeden Preis in der Situation, in der es auftritt, zu unterbinden. Auch hier greift dann der Mechanismus, dass bereits gezeigtes Verhalten verhindert wird, anstatt zu überlegen, wie erreicht werden kann, dass der Hund für sich gar keinen Grund mehr sieht, Abwehrverhalten zu zeigen.
Ein Hund, der knurrt, wenn sich ein Mensch ihm während des Fressens annähert, sichert sich damit sein Essen. Er hat Angst, dass der Mensch ihm dieses vielleicht wegnehmen könnte. Ressourcensicherung gehört zum biologischem Normalverhalten des Hundes und kann vorkommen. Der betroffene Mensch reagiert vermutlich besorgt, ängstlich und ist vielleicht unsicher, wie er darauf reagieren kann. Daraus entsteht schnell der Wunsch, dass sich diese Situation keinesfalls wiederholen darf. Kommt eine moralische Bewertung des Menschen hinzu, dass das Abwehrverhalten des Hundes ungehörig, frech, dominant oder unverschämt sei, entstehen Ärger und das Gefühl, da mal wirklich durchgreifen zu müssen. Wird das Abwehrverhalten als normales Verhalten betrachtet, ist es leichter, einen Weg zu suchen, wie man es erreichen kann, dass der Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigen wird. Es fällt Menschen dann leichter, sich auf schützende Managementmaßnahmen und auf eine Trainingsplanung einzulassen, die zum Ziel hat, dass der Hund lernen kann, dass er gar keinen Grund hat, Abwehrverhalten zu zeigen, wenn der Mensch sich seinem Fressen nähert.
Betrachten Sie Abwehrverhalten des Hundes als normales Verhalten anstatt als Angriff gegen Sie. Das macht es leichter, Lösungen zu finden.
Immer wieder bringen Menschen ihren Hunden dieses Verhalten aber auch erst (selbstverständlich unbeabsichtigt) bei, und zwar durch präventiv gemeintes Training. Viele Hunde kennen die Übung, dass der Futternapf gefüllt wird und ihnen dann während des Fressens ein- oder mehrmals weggenommen wird. Die Hundehalter wollen dem Hund so beibringen, dass sie der Chef sind und über die Ressource Futter verfügen können. Oder sie möchten so erreichen, dass sie ihrem Hund auch mal was Fressbares wegnehmen können, falls mal etwas Gefährliches wie z.B. Glasscherben eins herabfallenden Glases in den Napf fällt oder der Hund unterwegs etwas Gefährliches aufnimmt. Viele Hunde lernen erst durch dieses vermeintlich präventive Training, dass ein Mensch, der sich beim Fressen nähert, bedeuten kann, dass sein Futter weggenommen wird bzw. sein Fressen unterbrochen wird. Für Hunde, die das stresst oder frustriert, wird die Annäherung des Menschen am Fressen mit unangenehmen Emotionen und Befürchtungen verknüpft – sie können auf Grund der Lernerfahrung mit Abwehrverhalten reagieren, um zu verhindern, dass das Futter wieder weggenommen wird. Bei Hunden, die diese oben beschriebene, leider falsche Art des „präventiven“ Trainings gar nicht kennen, ist eine Abwehrreaktion sehr viel unwahrscheinlicher.
Auch in diesem Fall lohnt sich ein anderer Blickwinkel. Ein Hund, der mit Angst um sein Essen auf die Annäherung des Menschen reagiert, hat einen guten Grund, sein Futter zu verteidigen. Wenn dieser Hund nun lernen kann, dass ein sich annähernder Mensch zukünftig immer bedeutet, dass er noch etwas Tolles dazu bekommt, wird sich die Erwartungshaltung ändern. Es wird dann bald eine freudige Erwartung anstelle der Sorge und Angst eintreten und damit fällt der Grund für das Abwehrverhalten weg. Ganz ohne Abstrafen des aus menschlicher Sicht störenden und sogar gefährlichen Verhaltens.
Warum sollte sich denn der Mensch nach dem Hund richten?
Vielleicht schießt Ihnen jetzt sofort diese Frage durch den Kopf. Es kann doch nicht angehen, dass der Mensch sich nach dem Hund richtet! Warum sollte man sich da so viele Gedanken um die Bedürfnisse des Hundes machen, der kann sich doch anpassen! Vielleicht spüren Sie Widerwillen und Widerstand in sich aufsteigen. Immerhin ist der Mensch derjenige in der Mensch-Hund-Beziehung, der in unserer komplexen Welt für die Sicherheit des Hundes und des Umfeldes sorgen muss. Und es kann ja auch nicht angehen, dass der Mensch seine Bedürfnisse zurückschrauben muss, damit der Hund glücklich ist und dann vielleicht noch dem Menschen auf der Nase herumtanzt. Diese Gedanken und Empfindungen sind sehr nachvollziehbar.