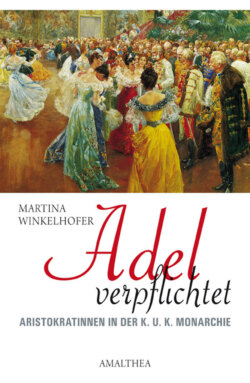Читать книгу Adel verpflichtet - Martina Winkelhofer - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWenn sich ein Paar in seinen Gefühlen – oder zumindest Erwartungen – einig war und die Eltern beider ihr Einverständnis gegeben hatten, begannen, vor der offiziellen Bekanntgabe der Verlobung, die Verhandlungen über die Mitgift. Und hier kam es nicht selten zu wahren Feilschereien. Hinsichtlich des finanziellen Aspekts einer Heirat dachte der Adel sehr praktisch: Eine perfekte Verbindung zur Wahrung des Stammbaums war gut, eine zusätzliche solide finanzielle Grundlage einer Ehe noch besser. Beide Seiten, die Familie der Braut wie des Bräutigams, versuchten herauszuholen, was nur ging. Die Mitgift der Braut sollte so hoch wie möglich sein, entsprechend annehmbar das Heiratsgut des Bräutigams. So manche Familie flunkerte bei den ersten finanziellen Erkundigungen, die die Familie des Bräutigams einholten. Zähe Nachverhandlungen, immer vor dem drohenden Hintergrund einer geplatzten Verlobung, die für beide Seiten peinlich wäre, waren an der Tagesordnung. Manche Familien einigten sich schnell, manche rangen um jede Kleinigkeit. Manche hatten zu hoch gepokert und mussten nun die Karten offen auf den Tisch legen, und manche weigerten sich, zu geben, was sie versprochen hatten: »So empörte man sich bei den Mitgift-Verhandlungen anlässlich einer Verbindung der Familien Trauttmansdorff und Auersperg, dass der Brautvater alle »über’s Ohr« gehaut habe und statt der versprochenen hohen Summe lediglich einen Minimalbetrag zu bezahlen gedachte.«54
Die reichen und mächtigen Familien ließen sich freilich nicht »über’s Ohr hauen«. Im Fall etwa einer Tochter des regierenden Fürsten Liechtenstein, wurde ein Heiratsvertrag aufgesetzt, der hieb und stichfest war. Die Mitgift einer Prinzessin Liechtenstein, oder einer Prinzessin Schwarzenberg, war so groß, dass die Familie der Braut praktisch alle finanziellen Bedingungen einer Eheschließung diktieren konnte. Als Prinzessin Eleonore Liechtenstein den Fürsten Schwarzenberg heiratete, brachte sie so viel Vermögen in die an sich schon reiche Familie Schwarzenberg mit, dass ihr Vater eine absolute Absicherung seiner Tochter verlangte. Denn die junge Eleonore erhielt anlässlich ihrer Hochzeit nicht nur von ihrem steinreichen Vater ein enormes Heiratsgut, auch ihr Großvater Fürst Esterhazy überließ ihr nun ein riesiges Vermögen. So bestand in diesem Fall der Vater der Braut darauf, dass nicht, wie sonst üblich, nur der Vater des Bräutigams die Bürgschaft für die Einhaltung des Ehevertrags übernahm, sondern dass diese Bürgschaft im Todesfall des Schwiegervaters und des Ehemannes auch auf alle eventuellen nachfolgenden Familienchefs überging – hier wurde eine goldene Braut absolut abgesichert.55
Üblicherweise wurde im Ehevertrag festgehalten, wie viel Kapital die Braut in die Ehe einbrachte und wie viel der künftige Ehemann »widerlegte«, das heißt, um wie viel er das Kapital, das sie in die Familie mitbrachte, aufstocken würde.56
Geregelt wurde außerdem, wie viel Geld eine Frau jährlich zu ihrer freien Disposition haben würde – das so genannte »Spenadelgeld«. Wohnmöglichkeiten in den Familienschlössern und Palais sowie das Anrecht auf Wagen und Pferde wurden ebenfalls festgeschriebem. Teil der Mitgift war fast immer – und wurde auch vertraglich festgesetzt – ein diamantenes Diadem samt Collier, das die Braut mitbrachte und womit sie den Familienschmuck ihrer neuen Familie aufstockte. Deren Hausschmuck durfte die Braut hingegen lediglich tragen; er verblieb im Eigentum des Bräutigams. Bei sehr reichen Bräuten konnten die Brauteltern ausverhandeln, dass Teile der Mitgift im persönlichen Vermögen der Braut blieben.
War man sich endlich über die finanziellen Modalitäten einig geworden und die Heiratsverträge unter Dach und Fach, konnte die Verlobung bekanntgegeben werden. Nach außen demonstrierte man bestes Einvernehmen, unabhängig davon, ob man erst kurz zuvor über jedes Detail verhandelt hatte. Oder, wie ein Zeitgenosse nach Beendigung einer langen Vorlaufzeit süffisant schrieb: »Es ist schon geschehen. Die Heirath ist deklariert und wie immer bei diesen Gelegenheiten der Himmel voller Geigen.«57
Für die jungen Frauen begann jetzt der angenehme Teil der Verlobungsvorbereitung. Sie durften den so genannten »Trousseau« besorgen – also einkaufen gehen. Denn zur klassischen Mitgift der Komtessen gehörte auch der Trousseau – die Aussteuer, also der gesamte Hausrat, den die Braut von ihrer Familie mitbekam und der nach der Verlobung gekauft und erstellt wurde: eine komplette und neue Garnitur Kleidung (kostbare Festkleider, aber auch Tageskleider und Wäsche, Hüte, Handschuhe, Strümpfe, Nachtwäsche), Weißwäsche und Bettwäsche, Damast, Seide und Spitze für die Wohnung, vor allem aber Teile des Familienschmucks. Beim Trousseau gerieten sich Mütter und Töchter regelmäßig in die Haare. Die jungen Frauen hatten natürlich ganz andere Vorstellungen als ihre Mütter. Sie wollten lieber mehr Kleidung, vor allem aber kostbare Ball- und Putzkleider anstatt praktischer Hausratsstücke, die jedoch auch mitgebracht werden mussten. Streitereien waren an der Tagesordnung. Rudolf Liechtenstein über die Einkaufstouren einer seiner Nichten: »Bei der Besorgung vom Trousseau soll es bei jedem einzelnen Stück Schlachten geben!«58
Die fröhliche, bunte Komtessenwelt, dieser Rausch an Bällen, Festen, Verehrern und erstem Herzklopfen, der in einer Heirat mündete, hatte aber auch eine Schattenseite. Dann nämlich, wenn eine junge Frau diese Zeit nicht »nutzen«, also keine Heiratskandidaten für sich gewinnen konnte. Und für jene, die nach einer Saison (oder gar einer zweiten) keine ernsthaften Bewerber vorzuweisen hatten, entstand ein enormer sozialer Druck. Schon nach einiger Zeit, wenn sich während einer Saison keine Courmacher einfanden, begannen sie nervös zu werden – was für ihr Auftreten nicht unbedingt förderlich war. Jede weitere Saison ohne ernsthafte Aussichten wurde zum Spießrutenlauf in der Gesellschaft – man stand unter permanenter Beobachtung. Die eigene Familie, die Bekannten und Freunde, alle bekamen mit, wenn sich bei einer Komtess keine Angebote einstellten. Unsichere, wacklige Heiratskombinationen und oftmalige Ablehnungen konnten derart an den Nerven der jungen Frauen zerren und sie wegen ihrer Verletzungen auch mitunter die Contenance verlieren lassen. Manche Komtess fand nicht nur einen guten Bewerber, sondern verliebte sich auch in ihn, sah sich schon vor dem Traualtar – bis der Kandidat von seinen Eltern gedrängt wurde, diese Verbindung zu beenden (so vor allem die Eltern von Majoratsherren, die keine Schwiegertochter ohne große Mitgift wünschten).