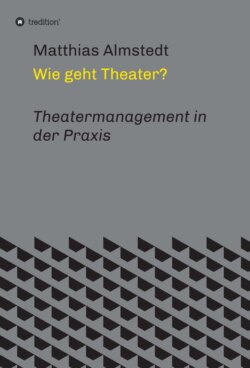Читать книгу Wie geht Theater? - Matthias Almstedt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Theaterstrukturen in Deutschland
1.1 Die Theaterstatistik als Datengrundlage
Dieses erste Kapitel soll einen einführenden, zahlenorientierten Überblick über die Strukturen der deutschen Theaterlandschaft geben. Die Ausführungen basieren auf der vom Deutschen Bühnenverein, dem Bundesverband der Theater und Orchester, jährlich herausgegebenen Theaterstatistik, die folgende Institutionen erfasst:3
alle öffentlichen Theater, also diejenigen Häuser, die sich in der Trägerschaft der öffentlichen Hand befinden; Voraussetzung: eigenes Ensemble, kein reiner Gastspielbetrieb;
diejenigen Privattheater, also sich in privater Hand befindenden Häuser, die ihr Geschäft „professionell“ betreiben, d.h. in einem Umfang Aufführungen auf die Bühne bringen, der mehr als gelegentliches Spielen umfasst und damit zum Ziel auch den eigenen „Broterwerb“ hat, so z.B. große Privattheater mit zum Teil durchaus öffentlichem Charakter, Boulevardtheater, Jugendtheater, Musicalunternehmen etc.; Voraussetzung auch hier: ein eigenes Ensemble;
weiterhin die selbstständigen Kulturorchester (die anderen, nicht selbstständigen Kulturorchester, die durchaus auch Konzerte anbieten, sind mit bei den öffentlichen Theatern erfasst);
schließlich die Festspielunternehmen, die nicht kontinuierlich spielen, sondern nur zu ausgewählten (Jahres-)Zeiten Aufführungen anbieten, z.B. die Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth, die Bad Gandesheimer Domfestspiele oder die Burgfestspiele Mayen.
Von der Theaterstatistik nicht erfasst werden:
Theater ohne eigenes Ensemble, sogenannte Bespieltheater,
private Tourneetheater,
freie Theatergruppen,
Laien- und Liebhabertheater.
Der Fokus der nachfolgenden Ausführungen liegt dabei auf den öffentlichen Theatern.
1.2 Trägerschaft
Insgesamt gibt es in Deutschland gut 140 öffentliche Theater. Hiermit sind sowohl reine Schauspielhäuser, reine Opernbetriebe wie auch Mehrspartenhäuser, die mehrere (je nach individueller Zählweise bis zu fünf) Sparten unter einem rechtlichen Dach vereinen. Damit hat die Bundesrepublik Deutschland eine Theaterdichte wie kein anderes Land der Erde.
2014 wurde die Deutsche Theater- und Orchesterlandschaft auf Initiative des Deutschen Bühnenvereins und des Deutschen Musikrats sogar in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Ein Eintrag in dieses Verzeichnis ist die Vorbedingung für eine UNESCO-Nominierung. 2018 wurde dann die Aufnahme für die offizielle Anerkennung der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft als immaterielles Kulturerbe bei der UN-Kulturorganisation UNESCO beantragt. Eine abschließende Entscheidung hierüber ist noch nicht gefallen. Das Verfahren dauert an.
Aus der Bezeichnung des jeweiligen Theaters kann man in der Regel dessen Trägerschaft ablesen.
Eine sich in der Hand eines Bundeslandes befindende Bühne trägt häufig den Namen Staatstheater. So ist beispielsweise der Träger des Saarländischen Staatstheaters das Bundesland Saarland, der Träger des Staatstheaters Braunschweig das Land Niedersachsen. Ca. ein Fünftel der deutschen Theater befinden sich in der Trägerschaft eines Bundeslandes.
Ein kommunales, also städtisches Theater wird als Stadttheater bezeichnet. Aus Marketing-/Markengründen ist die Bezeichnung Stadttheater bei vielen kommunalen Theatern in den vergangenen Jahren in den Hintergrund getreten und sie tragen diesen Namen gegebenenfalls noch in der Unterzeile. Stattdessen nennen sie sich häufig nur noch Theater oder Bühnen. Hier einige Beispiele für Namensgebungen kommunaler Theaterbetriebe: Theater Bielefeld; Bühnen Köln; aber: Stadttheater Ingolstadt. Die kommunale Trägerschaft ist am ausgeprägtesten. Knapp 50 % der bundesdeutschen Theater gehören einer Kommune.
Sind mehrere Gebietskörperschaften gemeinsam Eigentümer an einem öffentlichen Theater, so spricht man von einer Mehrträgerschaft. Neben einigen Stadttheatern wie beispielsweise dem Theater Krefeld-Mönchengladbach, aber auch dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin sind häufig Landesbühnen, teilweise auch als Landestheater bezeichnet, in dieser Struktur verankert. Deren primäre Aufgabe ist die Bespielung einer bestimmten Region, sie „reisen über Land“. An den Landesbühnen sind regelmäßig deren Sitzstädte, aber auch Gebietskörperschaften, deren Spielstätten von der Landesbühne bespielt werden, beteiligt. So sind z.B. Träger der Burghofbühne Dinslaken, des Landestheaters im Kreis Wesel, neben der Sitzstadt Dinslaken u.a. die Stadt und der Landkreis Wesel sowie die Gemeinde Hünxe. Bei der Badischen Landesbühne in Bruchsal bilden vier Landkreise und 16 Mitgliedsgemeinden aus dem Bespielgebiet sowie das Land Baden-Württemberg den Trägerverband. Gut ein Drittel der bundesdeutschen Theater befinden sich in der Konstruktion einer Mehrträgerschaft.
Aber nicht immer kann man vom Namen des Theaters automatisch auf die Art der Trägerschaft schließen. So ist z.B. die Staatsoperette Dresden keine Beteiligung des Freistaats Sachsen, sondern befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden.
Auch der Namensbestandteil „National~“ führt regelmäßig in die Irre, so z.B. beim Nationaltheater Mannheim oder beim Deutschen Nationaltheater Weimar. Das erste ist das Stadttheater der Stadt Mannheim und das zweite befindet sich in der gemeinsamen Trägerschaft des Freistaates Thüringen und der Stadt Weimar. Hierzu ist festzuhalten, dass sich kein öffentliches Theater im Eigentum des Bundes, also der Bundesrepublik Deutschland befindet. Zurückzuführen ist dieses auf die im Grundgesetz verankerte Kulturhoheit der Bundesländer.
Eine weitere Besonderheit ist die, dass als einziges Bundesland Nordrhein-Westfalen kein Staatstheater besitzt außer einer gemeinsamen Trägerschaft mit der Landeshauptstadt Düsseldorf am Düsseldorfer Schauspielhaus. Die Deutsche Oper am Rhein mit Sitz ebenfalls in Düsseldorf wird dagegen von den beiden Städten Düsseldorf und Duisburg (zusammen mit dem Freundeskreis der Oper) als Theatergemeinschaft betrieben.
1.1 Rechtsformen
An dieser Stelle wird nur kurz aus quantitativer Sicht in das Thema der Rechtsformen eingeführt. In ausführlicher Form beschäftigt sich das Kapitel 3 mit den einzelnen Rechtsformen.
Für öffentliche Betriebe und damit auch für öffentliche Theater steht eine Vielzahl von Rechtsformen zur Auswahl. Grundsätzlich wird zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Rechtsformen unterschieden. Während erstere sowohl für privatwirtschaftliche Betriebe als auch für Betriebe der öffentlichen Hand wählbar sind, sind die öffentlich-rechtlichen Rechtsformen ausschließlich für die öffentliche Hand bestimmt.
Die drei Rechtsformen, in denen mit weitem Abstand am meisten öffentliche Theater geführt werden sind die privatrechtliche Rechtsform GmbH und die beiden öffentlich-rechtlichen Rechtsformen Eigenbetrieb und Regiebetrieb. Die Rechtsform der GmbH haben ca. 40 % der Theaterbetriebe, die beiden öffentlichen Rechtsformen sind ungefähr gleichauf mit 20 bis 25 %.
Hätte man diesen Vergleich zu Beginn dieses Jahrtausends gezogen, so wäre die Reihenfolge eine andere gewesen: Regiebetrieb vor GmbH und Eigenbetrieb. Man kann daran erkennen, dass der Trend bei den öffentlichen Theatern in den letzten Jahrzehnten weg vom Regiebetrieb mit seinem kameralen Rechnungssystem hin zu einer kaufmännischen (doppelten) Buchführung entweder in der Rechtsform eines nicht selbstständigen Eigenbetriebs oder sogar zur GmbH als eigenständige Rechtsform gegangen ist (siehe hierzu auch Kapitel 3).
Des Weiteren sind öffentliche Theater in kleiner Zahl in den Rechtsformen Stiftung, Anstalt des öffentlichen Rechts, eingetragener Verein, Zweckverband und Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu finden.
1.4 Besucher
Nimmt man die Gesamtzahl der Besucher, die in der Theaterstatistik für die Bundesrepublik Deutschland erfasst ist, so kommt man auf die stolze Summe von ca. 32. Mio. Besuchern pro Spielzeit. Ca. 18,5 Mio. Besucher davon gehen in die Veranstaltungen der öffentlichen Theater (inkl. der Besucher der Konzerte der in die Theater integrierten Orchester). Konzertveranstaltungen der selbstständigen Kulturorchester und der Rundfunkorchester besuchen jährlich rd. 3 Mio. Besucher. In die Vorstellungen der Privattheater gehen rd. 7,5 Mio. Zuschauer pro Saison. Hier ist festzuhalten, dass ein Großteil dieser Besucherzahl durch die privaten Musicalunternehmen mit ihren Long-Run-Produktionen wie „Der König der Löwen“ in Hamburg oder „Starlight Express“ in Bochum generiert wird. Die Festspiele ziehen jährlich rd. 3 Mio. Besucher an.
Interessant ist an dieser Stelle der Vergleich mit der Fußball-Bundesliga, auch wenn dieser aufgrund der unterschiedlichen Veranstaltungsstrukturen – Theater: vergleichsweise viele, aber kleine Spielstätten mit vielen Vorstellungen; Bundesliga: vergleichsweise wenige, aber große Stadien mit wenigen Veranstaltungen – ein wenig hinkt: Die Zuschauerzahl der 1. Bundesliga liegt seit der Saison 2008/2009 relativ konstant bei ca. 13 Mio. Zuschauern. Rechnet man die 2. Bundesliga mit durchschnittlich 5 bis 6 Mio. Zuschauern hinzu, so kommt man auf eine Zuschauerzahl, die ungefähr der der öffentlichen Theater pro Spielzeit entspricht.
Die zeitliche Entwicklung der Besucherzahlen der öffentlichen Theater ist in der Abbildung 1-1 visualisiert.
Abbildung 1-1: Die Entwicklung der Besucherzahlen der öffentlichen Theater seit 1951/52
Man kann anhand dieser Abbildung sehr gut erkennen, wie sich der Zuschauerzuspruch der öffentlichen Theater seit den 1950er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verändert hat.
In den 1950er Jahren, der Nachkriegszeit, wuchs der Wunsch nach Kultur von Jahr zu Jahr an. Die Zuschauerzahlen der öffentlichen Theater nahmen stetig zu. Es gehörte zum gesellschaftlichen Status dazu, ein Theater-Abo zu besitzen und ins Theater zu gehen. In der ersten Hälfte der 1960er Jahren stabilisierten sich diese Zahlen auf hohem Niveau. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bekam das Theater Konkurrenz durch andere Freizeitangebote, so beispielsweise das Kino, seit 1967 die Verbreitung des Farbfernsehens und eine ständige Zunahme des Tourismus. Hinzu kamen veränderte gesellschaftspolitische Ansichten, insbesondere bei der Jugend und jungen Erwachsenen (Stichwort: Studentenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland). Theater war nun für viele etwas „Verstaubtes“, zum Establishment und Bildungsbürgertum Gehörendes. Die Besucherzahlen nahmen kontinuierlich ab: von über 20 Mio. Anfang der 1960er Jahre bis auf etwas über 15 Mio. pro Spielzeit Ende der 1980 Jahre. Aufgrund der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 nahm dann durch die Vergrößerung der erfassten Theater die Zahl der Besucher wieder zu, da ab der Spielzeit 1990/1991 die Zahlen der Theater aus den fünf neuen Bundesländern in die Theaterstatistik integriert wurden. Auf eine rückwirkende Hinzurechnung der Zahlen aus der ehemaligen DDR für die Zeit vor der Wiedervereinigung wurde verzichtet. So lag die Zahl der Theaterbesucher Anfang der 1990er Jahre „wieder“ bei gut 20 Mio. und verblieb bis zum Ende des Jahrtausends auf diesem Niveau. Seit den 2000er Jahren ist wieder ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. Das Niveau pendelt sich seit einigen Spielzeiten zwischen 18 Mio. und 19 Mio. Besuchern pro Saison ein.
Die Theaterbesucher haben verschiedene Möglichkeiten, einen Theaterbesuch zu organisieren. Hierbei geht es insbesondere um die Art des Kartenerwerbs.
Schaut man sich die Theaterstatistik an, so sieht man, dass der größte Teil der Theaterbesucher, zwischen 40 und 50 %, Karten zum Vollpreis an der Tages- oder Abendkasse im freien Verkauf erwirbt.
Die Abonnenten machen im Durchschnitt 15 bis 20 % der Theaterbesucher aus. Der Preisrabatt für Abonnenten schwankt von Theater zu Theater und von Abonnement-Reihe zu Abonnement-Reihe. Meistens liegt die Reduzierung zwischen 20 und 40 % des regulären Kartenpreises.
Der Kartenvertrieb über Besucherorganisationen liegt bundesweit bei rd. 5 %. Besucherorganisationen sind quasi Vermittler zwischen Theater und Besuchern. Sie sind häufig gemeinnützige Vereine, die ihren theaterinteressierten Mitgliedern Theaterkarten mit deutlichen Preisermäßigungen, eine organisierte Hin- und Rückfahrt zum Theater sowie häufig auch Einführungen und /oder Nachbereitungen von Theaterstücken oder auch weitere Serviceleistungen bieten. Bekannte Besucherorganisationen in Deutschland sind die Theatergemeinden und die Volksbühnen. So wurden ab dem Ende des 19. Jahrhunderts Volksbühnen als kulturpolitische Massenorganisationen der deutschen Arbeiterbewegung mit dem Ziel gegründet, gesellschaftlich und sozial schwächer gestellten Bevölkerungsgruppen einen Zugang zu Bildung und zum kulturellen Leben zu ermöglichen. Die erste ihrer Art war die Freie Volksbühne Berlin; sie wurde 1890 gegründet. Die Volksbühnen sind in Deutschland im Bund Deutscher Volksbühnen zusammengeschlossen, der auf eine Tradition bis 1920 zurückblickt. Neben der Volksbühnenorganisation gibt es in der Bundesrepublik aktuell 23 Theatergemeinden. Ihre Aufgabe liegt in ähnlicher Form darin, ihren Mitgliedern ein vielfältiges Kulturprogramm zu vermitteln und durch ermäßigte Eintrittspreise eine aktive Teilnahme am kulturellen Leben in ihrer jeweiligen Stadt zu ermöglichen. Die Idee von Kulturgemeinden in Vereinsform ist um einiges älter als der 1951 wiedergegründete Dachverband, der Bund der Theatergemeinden. Ursprünglich kommt der Gedanke der Theatergemeinden aus der Bildungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Er entstammt derselben kulturhistorischen Wurzel, aus der beispielsweise Volkshochschulen und öffentliche Bibliotheken erwuchsen sowie überhaupt die öffentliche Kultur selbst. Die Preisrabattierung schwankt je nach „Marktmacht“ der Besucherorganisation und der Geschäftsbeziehung mit dem jeweiligen Theater in der Regel zwischen 20 bis zu 50 % auf den Vollpreis.
Schüler-, Studenten-, Kinder- und Jugendkarten sind in der Theaterstatistik mit einem Anteil von rd. 20 % ausgewiesen. Neben allen, sich in der neueren Zeit auch verstärkenden Bemühungen der Theater um ein jüngeres Publikum ist festzuhalten, dass ein großer Teil der an diese Klientel verkauften Eintrittskarten auf das zur Advents- und Weihnachtszeit von den allermeisten Theatern gespielte Schüler- und Familienstück (im Volksmund häufig auch als „Weihnachtsmärchen“ bezeichnet) zurückzuführen ist. Dieses Weihnachtsstück ist für einen Großteil des Publikums in der Regel der erste, wichtige Kontakt mit der Theaterwelt überhaupt.
Sonstige rabattierte Karten machen einen Anteil von ca. 10 % der Karten aus. Hierunter fallen ermäßigte Karten, die regelmäßig für Schüler, Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, Empfänger von laufenden Leistungen nach SGB II und XII oder Schwerbehinderte ausgegeben werden. Der Rabatt liegt hier bei (bis zu) 50 %. Aber auch ermäßigte Karten für größere private oder auch professionell, z.B. touristisch, organisierte Besuchergruppen fallen in diese Kategorie. Je nach Theater beginnen hier die Rabattstaffeln bei zehn oder zwanzig Personen.
Unter Gebührenkarten, häufig auch Steuerkarten genannt, versteht man Karten, die in der Regel an Beschäftigte des eigenen Theaters oder auch an Beschäftigte anderer Theater ausgegeben werden. Im Bundesdurchschnitt machen diese ca. 2 % aller Theaterbesuche aus. So wie viele Unternehmen ihren Mitarbeitern auf die eigenen Produkte Personalrabatte geben, wird diese Vorgehensweise durch die Ausgabe von Gebühren-/Steuerkarten in Analogie auch im Theaterbereich angewendet.
Bei einem Anteil von rd. 5 % liegen Ehren-, Frei- und Dienstkarten. Dienstkarten werden für Beschäftigte des Theaters ausgegeben, die sich Vorstellungen aus dienstlichen Gründen anschauen (müssen): so z.B. die Theaterleitung, die bei Premieren das Theater repräsentiert, der Regieassistent, der sich zwecks Qualitätssicherung eine Vorstellung anschaut, der Operndirektor, der einen Sänger während einer Vorstellung „begutachtet“, oder die Souffleuse, die beispielsweise bei bestimmten Schauspiel-Produktionen von der ersten Zuschauerreihe aus ihre Arbeit verrichtet. Ehren- bzw. Freikarten werden einerseits an Honoratioren, VIPs und Multiplikatoren ausgegeben, andererseits werden Freikartenkontingente regelmäßig von Theatern auch im Rahmen von Sponsoring-Geschäften als Gegenleistung vereinbart (zum Sponsoring siehe Kapitel 7.3). Während in früheren Zeiten die Ausgabe dieser Karten relativ freizügig erfolgte, ist diese in den letzten Jahren doch aufgrund der virulenter gewordenen Compliance-Thematik4 merklich zurückgegangen. Die Regelungen zur Vergabe von Dienst-, Gebühren-, Frei- und Ehrenkarten sind vom jeweiligen Theater regelmäßig in einer für dieses Haus geltenden Eintrittskartenordnung dokumentiert.
Zieht man bezüglich der Art des Kartenerwerbs schließlich auch einen Vergleich zum Beginn dieses Jahrtausends, so lagen damals die Abonnements noch bei einem Anteil von 20 bis 25 % und die Besucherorganisationen noch bei 10 bis 15 %. Der freie Verkauf zum Vollpreis machte nur rd. 35 % aus. Man kann hier somit eine durchaus signifikante Verschiebung weg von der Nutzung des Abo-Systems und dem der Besucherorganisationen hin zum freien Verkauf erkennen. Während die Abonnementzahlen im Bundesdurchschnitt um rd. 5 Prozentpunkte zurückgegangen sind, liegt diese Zahl bei den Besucherorganisationen bei dramatischen 10 Prozentpunkten. Der Kartenvertrieb über die Besucherorganisationen ist in diesem Zeitraum also um ca. zwei Drittel massiv zurückgegangen, um nicht zu sagen eingebrochen. Der Freiverkauf ist im selben Zeitraum von rd. 35 % um 10 Prozentpunkte auf ca. 45 % gestiegen. Diese Veränderung entspricht dem Trend auch in anderen Bereichen wie z.B. dem Zeitungs- und Zeitschriften-Markt, der auch einen starken Abonnement-Rückgang zu verzeichnen hat. Ähnliches gilt auch für Vereinsmitgliedschaften. Der Trend, sich nicht längerfristig binden zu wollen, sondern frei zu sein und spontan Entscheidungen treffen zu können, hält weiter an.
Interessant ist auch die Verteilung der Besucher auf die Angebote der öffentlichen Theater. Diese lässt erkennen, welche Theatersparten bzw. welche Arten von Veranstaltungen welchen Zuschauerzuspruch haben.
Die meisten Zuschauer verzeichnet das Sprechtheater mit ca. einem Viertel aller Theaterbesucher, gefolgt von der Oper mit rd. einem Fünftel. Musical-Vorstellungen besuchen knapp 10 % der Theatergänger, die Operette liegt bei unter 5 %. Das Konzertpublikum macht knapp 10 % der Gesamtbesucher aus. Ballett- und Tanztheatervorstellungen werden von 5 bis 10 % der Zuschauer frequentiert. Kinder- und Jugendtheater-Vorstellungen haben einen Anteil von rd. 15 %. Auch hier ist wieder festzuhalten, dass ein großer Teil der Besuche auf das „Weihnachtsmärchen“ zurückzuführen ist. Der Besuch von Vorstellungen des Figurentheaters, einer Tradition, die vor allem in den ostdeutschen Bundesländern weitergeführt wird, liegt bei 1 % – gering auch aufgrund des nur begrenzten Angebots und der genreerforderlich eher geringen Zuschauerzahl pro Vorstellung. Die sogenannten Sonstigen Veranstaltungen liegen bei 5 bis 10 %. Hierunter fallen Liederabende, Kabarettprogramme u.ä. Das Theaternahe Rahmenprogramm wird von rd. 5 bis 10 % der Theaterbesucher angenommen. Hierbei handelt es sich um alle, in der Regel unentgeltlich angebotenen Veranstaltungen rund um das Theater. Die Breite und Vielfalt ist groß: Von theaterpädagogischen Veranstaltungen und Workshops über Matineen, Stückeinführungen und Probenbesuchen bis hin zu Theaterführungen, Theaterfesten und Tagen der Offenen Tür wird von den Theatern ein umfangreiches Zusatzprogramm für ihr Publikum angeboten.
1.5 Veranstaltungen
Die Aufteilung der Veranstaltungszahlen erfolgt in der Theaterstatistik nach einem fast identischen Schema wie die der Besucher auf die einzelnen Sparten/Arten von Veranstaltungen. Die meisten Veranstaltungen verzeichnet ebenso wie schon bei den Besuchern das Schauspiel mit 25 bis 30 % aller Vorstellungen. Dann folgt das Kinder- und Jugendtheater mit knapp 20 % Anteil. Erst dann ist hier die Oper mit knapp 10 % zu finden. Der Anteil der Ballett-/Tanztheatervorstellungen liegt ebenso wie der der Musical-Vorstellungen bei unter 5 %, die Operette kommt gar nur auf 1 %. Das Figurentheater liegt ebenfalls bei 1 %. Die Sonstigen Veranstaltungen – hierzu gehören beispielsweise Lesungen oder Liederabende – kommen auf 5 bis 10 %. Das Theaternahe Rahmenprogramm liegt bei rd. 20 % aller Veranstaltungen, seit Jahren steigend, da die Theater neben dem reinen Vorstellungsbetrieb verstärkt den Fokus auch auf die Vermittlungsarbeit richten. Auch wenn die Theater regelmäßig fast ausschließlich ihre eigenen Produktionen spielen, so laden sie auch fremde Ensembles zu Gastspielen ein, z.B. im Rahmen von Festivals oder um ihrem Spielplan noch eine zusätzliche Note zu geben. Die Gastspiele machen im Durchschnitt 5 bis 10 % aller Veranstaltungen aus. Diese Zahl kann aber von Theater zu Theater stark schwanken, je nachdem, wie diese Möglichkeit im Einzelfall genutzt wird. Kommunale Schauspielhäuser ohne eigene Musiktheateroder auch Tanztheatersparte wie z.B. das Theater Heilbronn bieten ihrem Publikum so ein Dreispartenprogramm an, auch wenn sie selbst am Haus fest nur ein Schauspielensemble engagiert haben.
1.6 Personal
Mit der Personalstruktur und den einzelnen Beschäftigungsgruppen befassen sich in ausführlicher Weise die Kapitel 5.1 und Kapitel 6, erstes aus aufbauorganisatorischer Sicht und zweites aus arbeitsrechtlicher Perspektive. Dennoch erfolgen an dieser Stelle einige Ausführungen zu quantitativen Aspekten des Personals.
Die in den öffentlichen Theatern festbeschäftigten Personen lassen sich grundsätzlich in drei Bereiche aufteilen:
Das künstlerische Personal, das sich aus den Ensembles – je nach Struktur des Theaters Schauspiel, Musiktheater, Ballett, Kinder- und Jugendtheater –, im Musiktheater darüber hinaus aus den Kollektiven (Orchester und Opernchor) sowie schließlich dem nicht darstellenden künstlerischen Personal, den Inspizienten, den Regieassistenten, den Dramaturgen etc., zusammensetzt, macht im Bundesdurchschnitt rd. 50 bis 55 % der Theaterbeschäftigten aus.
Das technische Personal ist grundsätzlich unterteilt in die bühnentechnischen Abteilungen, die den Proben- und Vorstellungsbetrieb betreuen und die handwerklich produzierenden Abteilungen. Der technische Bereich umfasst durchschnittlich 35 bis 40 % der Belegschaft eines Theaters.
Die dritte Säule bildet die Verwaltung. Wie jedes Unternehmen benötigt auch ein Theater kaufmännische Abteilungen wie das Rechnungswesen, die Personalabteilung, eine IT-Abteilung und eine Poststelle/Registratur. Und natürlich darf auch die Theaterkasse nicht fehlen. Zur „Zwitterstellung“ der Marketing-Abteilung wird auf das Kapitel 5.1 verwiesen. Die Mitarbeiter der Verwaltungsbereiche machen rd. 10 % der Theaterbeschäftigten aus.
Ergänzend ist festzuhalten, dass in Theatern mit einer Musiktheatersparte der Anteil der künstlerisch Beschäftigten tendenziell aufgrund der in der Regel großen Kollektive Orchester und Chor höher als in einem reinen Schauspielhaus ist.
Neben den Festbeschäftigten gibt es darüber hinaus im öffentlichen Theaterbetrieb noch eine große Gruppe an Akteuren, die nur zeitweise an einem Theater engagiert wird, nämlich die der Gäste des künstlerischen Betriebs, so die Regieteams und die Darstellergäste (siehe hierzu die vertiefenden Ausführungen des Kapitels 5.1).
Theater gehören zu den sogenannten Live Performing Arts. Somit ist es selbstredend, dass die Personalkosten5 im Theater bei weitem den größten Kostenblock darstellen. Im Bundesdurchschnitt machen sie derzeit knapp 75 % der Gesamtkosten aus. Die einzelnen Beschäftigungsgruppen wurden ja bereits im vorangegangenen Kapitel vorgestellt. Die Sachkosten liegen dementsprechend bei gut 25 %. Zu letzteren zählen die Kosten des Spielbetriebs wie z.B. Urheberabgaben, Material für Bühnen- und Kostümbild, Reisekosten für die Gäste, Ticketinggebühren, aber auch die Kosten für die Nutzung und Unterhaltung der Gebäude wie Energie oder Reparaturen und Wartung.
Weitergedacht bedeutet dieses, dass für den Fall, dass man im Theater Kosten senken will oder muss, signifikante Einsparungsergebnisse nur im Personalbereich möglich sind – durch Reduzierung des Mitarbeiterbestands oder durch das Absenken der Vergütungen oder der Lohnnebenkosten.
Öffentliche Theaterbetriebe, seien es Mehrspartenbetriebe oder einspartige Opern- oder Schauspielhäuser, sind aufgrund ihrer auch kulturpolitisch gewünschten Organisations- und Produktionsstruktur stark defizitäre Betriebe. Die Theater spielen im sog. Repertoire-Betrieb eine Vielzahl verschiedener Werke in einer Spielzeit. Dieses Repertoire wird durch mehrere Neuinszenierungen pro Saison (an großen Mehrspartenhäusern zwanzig und mehr Neuproduktionen) ergänzt. So erhält der Besucher die Möglichkeit, eine große Bandbreite der Theaterliteratur in abwechslungsreicher Vielfalt kennenzulernen (zu verschiedenen Betriebsformen der Theater siehe Kapitel 5.2.3).
Das Repertoire-Angebot bedingt die Notwendigkeit, mit einem fest am jeweiligen Haus engagierten Ensemble zu arbeiten. Dieses versucht, gemeinsame künstlerische Prinzipien umzusetzen und ästhetische Ziele zu erreichen. Man spricht daher vom sog. Ensemble-Prinzip. Anders wäre die Stückvielfalt des Repertoires nicht zu realisieren. Dieses Ensemble prägt das unverwechselbare künstlerische Profil des Hauses. Gerade deshalb sind der Aufbau und Erhalt eines Ensembles für ein Theater besonders wichtig. Vor allem die Stadt- und Staatstheater sowie die Landesbühnen, aber auch einige Privattheater verfügen über einen festen Stamm von Schauspielern, Sängern und Tänzern, die meist für mehrere Jahre engagiert sind. Dasselbe gilt für die Kollektive Chor und Orchester. Auch hier ist eine feste Anzahl von Sängern resp. Musikern langfristig engagiert, deren Zusammensetzung das Profil und den speziellen Klang des Kollektivs prägen.
Im Bundesdurchschnitt erwirtschaften die öffentlichen Theater (lediglich) rd. 18 % ihres Etats durch eigene Betriebserlöse – zum allergrößten Teil durch den Verkauf von Eintrittskarten, aber auch durch die Akquise von Drittmitteln in Form von Sponsoring, Spenden und Projektkostenzuschüssen. Der restliche Finanzierungsanteil kommt von der öffentlichen Hand, den Theaterträgern, aber auch anderen in der Regel öffentlichen Zuschussgebern, als öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse. So erhält in den meisten Bundesländern ein kommunales Theater neben dem Zuschuss der Sitzkommune, die im Normalfall der Träger ist, auch vom jeweiligen Bundesland einen Zuschussanteil, ohne dass dieses in der Regel selbst Träger ist. Im Falle einer GmbH beispielsweise wäre das Land kein Mitgesellschafter. Umgekehrt bekommen Staatstheater zusätzlich zum Zuschuss ihres Trägers, also des jeweiligen Bundeslandes, in den allermeisten Fällen auch einen Zuschuss von der Sitzkommune, ohne dass diese sich dann ebenfalls in der Mitträgerschaft des Theaters befinden muss.
Die Betriebserlöse aller bundesdeutschen öffentlichen Theater liegen derzeit bei ca. 0,6 Mrd. €, die öffentlichen Zuweisungen und Zuschüsse bei ca. 2,7 Mrd. €. Somit sind die öffentlichen Theater bei weitem der größte Sektor der öffentlich geförderten Kunst und Kultur. Seine Unterstützung macht ein gutes Drittel der gesamten öffentlichen Ausgaben für Kultur aus.
Eng verbunden mit der Einnahmesituation ist das sogenannte Einspielergebnis, das das Verhältnis von Betriebseinnahmen zu öffentlichen Zuweisungen der Theater widerspiegelt. Es liegt im Bundesdurchschnitt aktuell bei rd. 18 %. Die Einspielergebnisse variieren jedoch ziemlich stark: von unter 10 % bis hoch zu teilweise über 50 %. Einerseits große Opernhäuser mit einem sehr hohen Eintrittspreisniveau und anderseits kleine Sprechtheater, insbesondere Landesbühnen mit einem sehr günstigen Personalkostenschlüssel, sind bei den Theatern mit den höchsten Einspielergebnissen zu finden.
Eine weitere in diesem Zusammenhang häufig angeführte Kennzahl ist der Betriebszuschuss je Besucher, der anzeigt, mit welchem Geldbetrag jeder Theaterbesuch öffentlich finanziert wird. Bundesweit beträgt der Durchschnitt bei den öffentlichen Theatern aktuell ca. 140 €.
Der durchschnittliche Erlös pro Besucher, also sozusagen der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte liegt im Bundesmittel bei ca. 30 €.
ÜBUNGSAUFGABEN:
1. Wer sind in Deutschland die Träger öffentlicher Theater?
2. Wie haben sich die Zuschauerzahlen der öffentlichen Theater seit den 1950er Jahren entwickelt? Was sind die Gründe für den Verlauf?
3. Wie kann die Personalstruktur im öffentlichen Theater beschrieben werden?
4. Wie stellt sich die Kostenstruktur im öffentlichen Theater dar? Was sind die Konsequenzen hieraus?
3 Die Grafiken, die den quantitativen Ausführungen zum Kapitel 1 zugrunde liegen, können für Zwecke der Lehre kostenlos beim Autor angefordert werden.
4 Compliance ist die betriebswirtschaftliche und rechtswissenschaftliche Umschreibung für die Regeltreue oder auch Regelkonformität von Betrieben, also die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes. Die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen eines Betriebes zur Einhaltung bestimmter Regeln und damit zur Vermeidung von Regelverstößen wird als Corporate Governance Kodex oder Compliance Management System bezeichnet.
5 Auf die unterschiedlichen Begrifflichkeiten Kosten - Aufwand - Ausgaben - Auszahlungen resp. Erlöse - Erträge - Einnahmen - Einzahlungen wird hier nicht näher eingegangen. Es wird diesbezüglich auf die einschlägige betriebswirtschaftliche Literatur verwiesen.