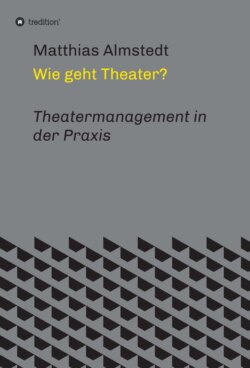Читать книгу Wie geht Theater? - Matthias Almstedt - Страница 9
Оглавление2 Zielsystem öffentlicher Theater
2.1 Grundlagen
Jedes wirtschaftliche Handeln erfordert ständiges Wählen zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Werden menschliche Wahlhandlungen bewusst vollzogen, so spricht man von Entscheidungen. Die Entscheidung für eine bestimmte Alternative richtet sich dabei an dem vom Handelnden verfolgten Ziel bzw. Zielbündel aus. In diesem Sinne stellen Ziele Aussagen über erwünschte Zustände dar, die als Ergebnis von Entscheidungen eintreten sollen.
Ziele werden von Zwecken abgegrenzt. Der Zweck eines Unternehmens, auch als Sachziel bezeichnet, besteht in der Erfüllung derjenigen Funktion, die die Umwelt von ihm erwartet oder ihm zugesteht. Das Sachziel der Unternehmung bezieht sich auf Art, Menge und Zeitpunkt der im Markt abzusetzenden Leistungen.
Neben den Sachcharakter bzw. den Inhalt des Handelns, der in den Sachzielen zum Ausdruck kommt, tritt die Form des Handelns, die durch sogenannte Formalziele ausgestaltet wird. Formalziele charakterisieren den Willen der Führung, stellen Imperative dar und dienen zur Lenkung des Unternehmens. Sie drücken aus der Sicht des Zielträgers den eigentlichen Sinn des Wirtschaftens aus und lassen sich aus den Wertvorstellungen und Normen der Zielträger ableiten. Die Formalziele beschreiben Kriterien, wie das/die Sachziel(e) zu bilden und zu erfüllen sind. Die Formalziele einer Unternehmung werden innerhalb des eigenen Ermessensspielraums von ihr selbst festgelegt. Durch die Nutzung dieser Freiheitsgrade wird die Güte der Sachzielerreichung beeinflusst. Die Gesamtheit der Ziele einer Organisation setzt sich somit aus Sachzielen (Zwecken) und Formalzielen (Zielen) zusammen, die maßgeblich die Funktionen der einzelnen Unternehmensbereiche und deren Beziehungen bestimmen.
Ungeachtet der Fixierung klassischer Formalzielparadigmen auf monetäre Aspekte, z.B. Gewinn oder Rendite, spricht – logisch gesehen – nichts dagegen, auch nicht monetär dimensionierte Lenkungskriterien als Formalziele zu unterstellen. Damit können auch qualitative Ziele Formalziele sein, wenn durch sie die Ausgestaltung des Sachcharakters der Leistungserbringung bzw. eine nähere Bestimmung des Inhalts des Wirtschaftens erfolgt.
Im Allgemeinen wird das ökonomische Handeln nicht durch ein einzelnes Ziel, sondern durch ein mehrfaches (pluralistisches, multiples) Ziel bzw. eine Vielfalt von Zielen bestimmt. Eine solche Menge an Zielen, die durch Beziehungen miteinander verbunden sind, bezeichnet man als Zielsystem. Miteinander verbunden gelten Ziele dann, wenn sie in eine gleichgeordnete oder hierarchische Beziehung gesetzt werden. Mittels einer Einteilung in Ober-, Zwischen- und Unterziele können hierarchische Mittel-Zweck-Beziehungen, bei denen Ziele unterschiedlichen Ebenen zugeordnet werden, zum Ausdruck gebracht werden. Diese Unterteilung, in die auch die Sach- und Formalziele einzuordnen sind, stellt einen möglichen Ansatzpunkt zur Strukturierung einer Menge ungeordneter Ziele dar.
Die Koalitionstheorie der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre bildet einen weiteren Ansatzpunkt zur Gliederung von Zielen. Sie interpretiert die Zielbildung als einen umfassenden Verhandlungsprozess der verschiedenen an einer Organisation beteiligten Anspruchs- und Interessengruppen. Insbesondere der Zielbildungsprozess öffentlicher Betriebe wie der öffentlichen Theater wird von den Zielvorstellungen einer Vielzahl unterschiedlicher Anspruchsgruppen geprägt, weshalb eine Analyse der Ziele und Zielstrukturen öffentlicher Betriebe eng mit der Identifikation und Analyse der Zielvorstellungen der einzelnen Koalitionsteilnehmer verknüpft ist.
2.2 Bildung von Sachziel und Formalzielen
Die korrekte Auswahl und Formulierung der Ziele ist von entscheidender Bedeutung für ein erfolgreiches Handeln. Überträgt man die Unterteilung in Sach- und Formalziele auf das öffentliche Theater, so lässt sich Folgendes feststellen: Das Sachziel, der Zweck des öffentlichen Theaters, besteht in der Präsentation, also in der Aufführung von Bühnenwerken. Man kann dieses Sachziel insofern erweitern, als sie die Produktionsleistung des Theaters mit einbeziehen, so dass das Sachziel des Theaters in der Produktion und Präsentation, also in der Inszenierung und Aufführung von Bühnenwerken besteht. Die Einschränkung der zweiten Definitionsvariante besteht darin, dass Theater, die selbst keine Stücke inszenieren, sondern lediglich Stücke z.B. in Form von Gastspielen anderer Ensembles aufführen (lassen), nicht miterfasst werden.
Die Formalziele, die Lenkungsziele, die der Ausgestaltung des Sachziels (Produktion und) Präsentation von Bühnenwerken dienen, sind im öffentlichen Theater wie generell im öffentlichen Bereich vielschichtiger als bei erwerbswirtschaftlich orientierten Unternehmungen. Letztere verfolgen nämlich primär das Ziel der Gewinnmaximierung oder daraus abgeleitete Ziele, wie das Erreichen einer angemessenen Rendite oder eines bestimmten Umsatzes oder Marktanteils. Sie sind also vorwiegend – fast schon in monistischer Weise – monetär ausgerichtet. Man spricht hier auch von einer Formalzieldominanz. Das Formalziel der Gewinnmaximierung steht im Vordergrund und letztlich sogar über dem Sachziel. Dieses bedeutet in der Konsequenz, dass ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen sein Produktportfolio ändern und sogar die Branche wechseln würde, wenn es mit anderen Produkten oder Dienstleistungen mehr Gewinn erzielen könnte.
Anders sieht es jedoch im öffentlichen Sektor aus. Das erwerbswirtschaftliche Formalziel Gewinnmaximierung wird aufgelöst in das allgemeine Ziel Wirtschaftlichkeit bzw. Effizienz, das inhaltlich eine möglichst wirtschaftliche bzw. effiziente Realisierung des Sachziels fordert. Zu diesem Wirtschaftlichkeitsziel tritt in der Regel noch ein weiteres Bündel von Zielen, das sich z.B. aufgrund des mit der Installation des Betriebs verfolgten öffentlichen Auftrags ergibt. Somit ist hier die traditionelle Einengung der Formalzielparadigmen auf rein monetäre Aspekte aufzugeben.
Abbildung 2-1: Die Zielsystemstruktur im öffentlichen Theater
Für das öffentliche Theater können die Formalziele aus den individuellen, kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Zielen der Koalitionsteilnehmer am Theater abgeleitet werden. Im Wesentlichen lassen sich vier (formale) „Zielkomponenten“ identifizieren:
die Verwirklichung von Kunst6
die Erfüllung des öffentlichen Auftrags7
die Berücksichtigung der Publikumsbedürfnisse8
die wirtschaftliche Realisierung des Sachziels9
Die Abbildung 2-1 zeigt diese im Gesamtzusammenhang der Zielsystemstruktur.
Im Folgenden werden die vier Formalziel-Komponenten des Zielsystems näher beschrieben, da diese für die Festlegung der theaterspezifischen Aktionsparameter von entscheidender Bedeutung sind.
2.3 Die Formalziele des öffentlichen Theaters
2.3.1 Kunst
Die Verwirklichung von Kunst wird regelmäßig an erster Stelle genannt, wenn es um die Ziele des Theaters geht. Häufig wird das künstlerische Ziel – obwohl gemäß den vorangegangenen Ausführungen nicht unbedingt korrekt – in das Sachziel des Theaters integriert. Die Bedeutung des künstlerischen Ziels verdeutlicht auch der zwischen dem Theaterträger und dem Theaterleiter zu schließende Vertrag, für den der Deutsche Bühnenverein ein Muster entworfen hat. § 2 Abs. 1 dieses Intendantenmustervertrags bestimmt:
Der Intendant ist verpflichtet, sich dem Theater mit ganzer Kraft zu widmen und seine Tätigkeit nach bester künstlerischer Überzeugung und nach wirtschaftlichen Grundsätzen im Rahmen des geltenden Rechts auszuüben.
Das Theater als Kulturbetrieb darf und muss somit stets den künstlerischen Anspruch wahren und ist in diesem Sinne als eine Produktionsstätte zu verstehen, die künstlerisch Wertvolles und Hochwertiges hervorbringt.
Doch was ist unter Kunst bzw. künstlerisch Wertvollem oder Hochwertigem zu verstehen? Ganz allgemein ist die Freiheit, sich künstlerisch zu betätigen, im Grundgesetz garantiert (Begriff der Kunstfreiheit).10 Liest man in der Brockhaus-Enzyklopädie nach, so findet man dort, dass sich der Begriff Kunst aus Wissen, Weisheit, der Kenntnis oder auch der Fertigkeit, etwas zu können, ableitet. Weiter heißt es, dass unter Kunst somit „im weitesten Sinne jede auf Wissen und Übung gegründete Tätigkeit“ verstanden werden kann. Jeder Versuch allerdings, das abstrakte Problem der Definition von Kunst zu lösen, endet regelmäßig in ebenso abstrakten Antworten, die letztlich zum Inhalt haben, dass eine inhaltliche Präzisierung von Kunst oder gar eine intersubjektiv nachvollziehbare Bewertung eines Objektes11 in künstlerischer Hinsicht wohl auszuschließen ist. Im engeren Sinne existiert somit keine abgeschlossene und allgemein akzeptierte Definition des für den mit Kunst bezeichneten Komplex von Erscheinungen. Auch gibt es kein Maß, mit dem der künstlerische Wert eines Objektes erfasst werden könnte. Um dennoch eine Aussage über diesen treffen zu können, ist ein anderer, weiter gefasster Ansatz zu wählen. Die Bewertung geht dabei weniger vom Kunstobjekt selbst als vielmehr von den Subjekten, die mit dem Objekt zu tun haben, aus. In diesem Sinne kann man Kunst als einen im Dialog zwischen Herstellern und Empfängern ermittelten vorläufigen und widerrufbaren Vereinbarungsbegriff auffassen: Kunst ist, was (irgendwann einmal) für Kunst gehalten wurde. In diesem weit gefassten Sinne ist also alles das als Kunst zu verstehen, was erstens der einzelne Betrachter als Kunst empfindet, bzw. zweitens alles das, was auch immer ein Künstler als solche ansieht.
Die Kunst des Theaters baut, dieser Definition folgend, auf zwei Säulen auf:
auf dem, was der Betrachter oder Konsument der Kunst – im Theater also der Zuschauer – als Kunst empfindet (externe Komponente) und
auf dem, was der Erzeuger der Kunst, im Theater also der Schöpfer einer Inszenierung bzw. die am kreativen Entstehungsprozess einer Inszenierung Beteiligten, für Kunst halten (interne Komponente).
Das Theater ist – wie dürfte es nach dieser Definition von Kunst und der grundgesetzlich verankerten Kunstfreiheit auch anders sein – in seinem künstlerischen Wirken kaum eingeschränkt. Im Intendantenmustervertrag sind lediglich Rahmenrichtlinien zur künstlerischen Führung eines Theaters – wie die oben zitierte – zu finden. Der öffentliche Träger ist nur dazu berechtigt, dem Intendanten eine grobe Zielrichtung bezüglich der Kunst vorzugeben. Die einzigen (indirekten) Einflussmöglichkeiten des Trägers auf die künstlerische Gestaltung beziehen sich somit zum einen auf die Bestimmung eines aus seiner Perspektive geeigneten Intendanten sowie darauf, den Zuschussforderungen des Theaters Sach- und Finanzzwänge entgegenzusetzen.
2.3.2 Öffentlicher Auftrag
Öffentliche Theater stehen in rechtlicher und wirtschaftlicher Trägerschaft staatlicher Gebietskörperschaften. Somit haben sie ihrer Instrumentalfunktion12 hinsichtlich der Erfüllung des ihnen vorgegebenen öffentlichen Auftrags gerecht werden. Zur Legitimation der Institution Theater müssen die sich aus dem öffentlichen Auftrag ergebenden Vorgaben im Theater-Zielsystem wiederzufinden sein.
Unter einem öffentlichen Auftrag ist im allgemeinen die Übernahme von Aufgaben eines Trägers, auch Auftraggeber genannt, durch den beauftragten öffentlichen Betrieb zu verstehen. Der öffentliche Auftrag wird je nach Rechtsform des Betriebs (siehe Kapitel 3) in der Regel in Errichtungsgesetzen, Satzungen oder Gesellschaftsverträgen formuliert und gibt dem Betrieb eine Richtschnur für das Handeln vor. Am Grad der Erfüllung des öffentlichen Auftrags misst der Träger den Grad der Aufgabenerfüllung. Die vielfältigen Motive, die Länder und Gemeinden mit der Unterhaltung öffentlicher Theaterbetriebe verfolgen, finden sich somit im öffentlichen Auftrag wieder. Für das Deutsche Theater in Göttingen ist dieser z.B. folgendermaßen formuliert:
Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Führung eines Theaters in Göttingen auf der Grundlage des Schauspiels und des musikalischen Theaters … Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken, nämlich der Volksbildung und Vermittlung wertvollen Kulturgutes an die Bevölkerung.
Die Vielzahl der Antriebe zur Unterhaltung öffentlicher Theaterbetriebe gibt auch die große Zahl unterschiedlicher Ansatzpunkte zur Definition des theaterspezifischen öffentlichen Auftrags wieder. So kommt dem Theater die Aufgabe zu, der kulturellen Bildung und Entwicklung der Bevölkerung zu dienen und dabei eine möglichst große Öffentlichkeit zu erzielen. Auch die Erfüllung des Kulturell-edukativen spielt eine große Rolle. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung weist dem Theater zwar auch einen kulturpolitischen Auftrag zu, betont aber insbesondere die Versorgungs-/Bedarfsdeckungsfunktion des öffentlichen Theaters. So hat es vor allem die Aufgabe, die Bevölkerung mit Theater zu versorgen. Auch wird die kulturelle Zielsetzung des Theaters in einen Unterhaltungsaspekt, einen Bildungsaspekt und einen politischen Aspekt segmentiert. Im Rahmen der sogenannten Bertelsmann-Studie zu „Wirkungsvollen Strukturen im Kulturbereich“ wird ganz allgemein von einem gesetzlichen Auftrag des Theaters gesprochen.
Öffentliche Betriebe können grundsätzlich immer dann vom Staat eingesetzt werden, wenn eine Versorgung mit dem entsprechenden Grundgut durch die Privatwirtschaft als nicht gewährleistet erscheint. Das Angebot an Theater ist in Teilen zumindest zeitweise durchaus marktgängig, wie der wirtschaftliche Erfolg der Stella AG mit ihren kommerziellen Musical-Betrieben in der Vergangenheit gezeigt hat. Die Zielsetzungen und das Angebot öffentlicher Theaterbetriebe sind jedoch vielschichtiger und weitreichender als eine reine Gewinnorientiertheit. Würde die Versorgung der Gesellschaft mit Theaterleistungen allein dem erwerbswirtschaftlichen Bereich überlassen, käme ein der öffentlichen Hand unerwünschtes Ergebnis heraus. Es würde zu einer Beschränkung des Theaterangebots auf diejenigen Genres kommen, die einer erwerbswirtschaftlichen Zielsetzung genügen. Ergebnis wäre sicherlich eine Verflachung des Angebots. In diesem Sinne handelt es sich bei den Theaterleistungen um meritorische Güter. Diese Güter sind zwar prinzipiell marktgängig, aber der Staat ist trotzdem der Meinung, dass aufgrund einer ausschließlich dem Markt überlassenen Lösung keine – aus gemeinwirtschaftlicher Perspektive betrachtet – optimale Versorgung gewährleistet ist. Die Kunst gehört allgemein zu jenen Gütern, die vom Staat als meritorisch angesehen werden. Ihre Bereitstellung ist somit durch budgetäre Maßnahmen, also öffentliche Transfers, auszudehnen. In diesem Sinne ist gibt es trotz unterschiedlicher Definitionsansätze darüber einen Konsens, dass das Theater einen öffentlichen Kulturauftrag hat.
2.3.3 Publikumsbedürfnisse
Kundenorientierung, die Ausrichtung eines Unternehmens am Konsumenten, ist im erwerbswirtschaftlichen Bereich für jede Organisation ein existenzieller, überlebensentscheidender Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Zunehmender Wettbewerb macht es in immer stärkeren Umfang notwendig, dem einzelnen Kunden maßgeschneiderte Produkte anzubieten. Auch der öffentliche Bereich hat dies mittlerweile erkannt, ist aber in der Umsetzung kundenorientierter Konzepte noch nicht durchgängig so weit fortgeschritten, wie dies im erwerbswirtschaftlichen Sektor der Fall ist. In diesem Licht ist auch die Forderung nach einer Berücksichtigung der Publikumsbedürfnisse im öffentlichen Theater zu sehen. Im Rahmen der erwähnten Bertelsmann-Studie wird dies durch das für Theater als notwendig erachtete Streben nach Kundenzufriedenheit ausgedrückt.
Für das öffentliche Theater ergibt sich die Bedeutung des Publikums allein schon aus der Definition des Theaters heraus per se. Diese Bedeutung findet darin ihre Ursache, dass das Theater nicht allein das Geschehen auf der Bühne, sondern dass ein konstitutiver Teil ebenfalls die Anwesenheit des Publikums ist (coram publico). Ein Theater, das die Bevölkerung nicht mehr erreicht, verliert somit seinen Existenzgrund. Zwar hängt die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit eines Theaters nicht in erster Linie vom Publikumszuspruch und den damit verbundenen Einnahmeerlösen ab, sondern eher von der Einstellung des Trägers und den mit dieser korrespondierenden öffentlichen Zuweisungen. Jedoch stellt die Anwesenheit von Publikum eine notwendige Bedingung zur Erreichung sozial- und bildungspolitischer Ziele dar. Das Vorhandensein von Publikum ist die Voraussetzung für den Wirkungsprozess des Theaters. Zwischen dem Theaterspiel und dem Publikum besteht eine dialektische Spannung, aus der heraus sich die Theaterhandlung erst ereignet. Öffentliche Theater haben demnach nicht nur für ein Angebot von Bühnenaufführungen zu sorgen, sondern auch für eine entsprechende Nachfrage nach diesen.
Dass das Interesse des Publikums den Theaterverantwortlichen nicht egal ist, zeigt eine Vielzahl von diesbezüglichen Aktivitäten im Theaterbereich:
So hat beinahe jedes öffentliche Theater in der Vergangenheit schon einmal eine Publikumsbefragung durchgeführt.
Der Deutsche Bühnenverein hat als Bundesverband der deutschen Theater gemeinsam mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf einen umfassenden Leitfaden zur Durchführung von Besucherbefragungen durch Theater und Orchester entwickelt und veröffentlicht. Dieser steht allen Theatern und Orchestern sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.
Gleichwohl darf man bei aller Wichtigkeit des Publikums nicht aus den Augen verlieren, dass dieses (nur) eine Komponente des theaterspezifischen Zielsystems darstellt. Auf einen „Verkauf“ des Theaters an sein Publikum – wie manchmal von den künstlerisch Verantwortlichen im Theater befürchtet – darf das Theaterspielen nicht hinauslaufen.
2.3.4 Wirtschaftlichkeit
Öffentliche Betriebe sind generell dazu verpflichtet, die Ihnen zufließenden Mittel wirtschaftlich und sparsam einzusetzen. Dies geht aus den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes hervor: „Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.“ (§ 6 Abs. 1 HGrG) sowie „Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher geleistet werden, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind.“ (§ 19 Abs. 2 HGrG). In diesem Sinne verpflichtet sich der Intendant bei seiner Einstellung aufgrund von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 Intendantenmustervertrag auch zu einer Leitung des Theaters nach wirtschaftlichen Grundsätzen.
Für das Theater fordert dies eine möglichst wirtschaftliche Realisierung seines Sachziels, der (Produktion und) Präsentation von Bühnenwerken. Von den beiden grundsätzlichen Varianten des Wirtschaftlichkeitsprinzips, dem Maximum- und dem Minimumprinzip, findet regelmäßig das erste Anwendung. Denn die Theater bekommen zu Beginn jedes Geschäftsjahres ein festes Budget in Aussicht gestellt, in dessen Rahmen sie Ausgaben tätigen können. Sie haben also mit einem vorgegebenen Geldbetrag eine möglichst gute Realisierung ihres Sachziels anzustreben.
Wirtschaftliches Handeln im Theater wird immer wieder gefordert. So möchte die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung mit dem von ihr herausgegebenen Gutachten zur Führung und Steuerung des öffentlichen Theaters ein wirtschaftlicheres Verhalten des Theaters in Angemessenheit zum künstlerischen Auftrag und zu den übrigen öffentlichen Aufgaben bewirken. Ebenso fordern viele Autoren die konsequente Anwendung des ökonomischen Prinzips wirtschaftlicher Mittelverwendung sowie eine Steigerung der ökonomischen Effizienz der Leistungserstellung im Theater. In der Bertelsmann-Studie wird die Bedeutung einer wirtschaftlichen Zielkomponente hervorgehoben, indem betont wird, dass Theater mit öffentlichen Mitteln unterhaltene Betriebe sind und sie daher – wie jede mit öffentlichen Mitteln geförderte oder unterhaltene Institution – die Pflicht haben, mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Gleichzeitig wird die Bedeutung des ökonomischen Handels in der Studie allerdings relativiert. Denn es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wirtschaftlichkeit in dem Zielkonzept des öffentlichen Theaters eine Dimension und nicht alleiniges Kriterium für die Zielerreichung ist. Denn öffentliche Theater nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten, würde nahelegen, diese zu schließen.
Handeln nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip bedeutet also letztendlich nichts Anderes als die Nichtverschwendung von Ressourcen. Dies impliziert für das Theater einen zielgerichteten und koordinierten Einsatz aller Einsatzfaktoren, die für die Erstellung von Inszenierungen und Aufführungen notwendig sind. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip steht damit in keinem grundsätzlichen Widerspruch zu den sonstigen Zielen des Theaters. Eine solche Aussage konkretisiert sich u.a. auch im häufig vertretenen sogenannten Konzept der Eigenwirtschaftlichkeit in sachgerechter Form.
2.4 Zielbeziehungen
Die gefundenen Ziele sind nun zu ordnen und zueinander in Beziehung zu setzen. D.h., aus der erst einmal ungeordneten Menge an Zielen ist ein für unternehmerische Entscheidungen relevantes Zielsystem zu entwickeln. Im Rahmen der Analyse von Zielbeziehungen unterscheidet man Mittel-Zweck-Beziehungen und entscheidungsfeldabhängige Beziehungstypen.
2.4.1 Mittel-Zweck-Beziehungen
Mittel-Zweck-Beziehungen überprüfen Ziele daraufhin, inwieweit sie Mittelcharakter für die Verwirklichung eines oder mehrerer anderer Ziele im Zielsystem aufweisen. Dabei kann sich eine mehrstufige Zielhierarchie aus Oberzielen und daraus ableitbaren Zwischen- und Unterzielen ergeben. Die Oberziele stellen die oberste Zielsetzung des Unternehmens dar, welche nur über die Erfüllung der Zwischenstufen, also der Unter- und der Zwischenziele, verwirklicht werden kann. Dies verdeutlicht den Mittelcharakter der Zwischen- und Unterziele. Gleichzeitig können die Zwischenziele auch als Oberziel eines in der Hierarchie nachgeordneten Ziels interpretiert werden.
2.4.2 Entscheidungsfeldabhängige Beziehungstypen
Bei entscheidungsfeldabhängigen Beziehungstypen handelt es sich um Ziele, die – vereinfacht ausgedrückt – denselben übergeordneten Knoten besitzen. Sie beschreiben die Wirkung eines Ziels auf die Zielerreichung eines oder mehrerer anderer Ziele. Die Wirkung kann komplementär, konkurrierend oder indifferent sein. Komplementäre Ziele liegen dann vor, wenn durch die Erhöhung des Erreichungsgrads eines Ziels auch der eines oder mehrerer anderer Ziele positiv beeinflusst wird. Konkurrenz dagegen bedeutet, dass die Verbesserung des Erreichungsgrads eines Ziels den eines oder mehrerer anderer vermindert. Der Extremfall der Zielkonkurrenz ist die Zielantinomie. Sie liegt vor, wenn sich die simultane Realisation zweier oder mehrerer Ziele gegenseitig ausschließt. Als Indifferenz bezeichnet man schließlich eine Situation, in der die Erfüllung einer Zielsetzung keinen Einfluss auf die Erreichung der anderen Zielsetzung hat. Beim Aufbau eines Zielsystems sollten – idealtypischerweise – konkurrierende oder gar antinomische Ziele ausgeschlossen werden. In der Regel sind Zielsysteme jedoch durch zumindest partielle Zielkonkurrenz geprägt. Um rationales Handeln auf der Grundlage konfliktärer Zielvorgaben zu ermöglichen, ist es erforderlich, den Stellenwert der einzelnen Ziele innerhalb des Zielbündels genau zu bestimmen. Dies kann z.B. über die Gewichtung der Ziele erfolgen.
Die Entwicklung einer Zielhierarchie geht regelmäßig mit der Operationalisierung der Oberziele einher, die auf der Analyse der Mittel-Zweck-Beziehungen aufbaut. Sie ist jedoch zu umfangreich, als dass sie hier im Einzelnen behandelt werden könnte. Der Schwerpunkt der Ausführungen soll im Folgenden daher auf der Analyse der entscheidungsfeldabhängigen Beziehungen zwischen den vier „Ober(formal)zielen“ des Theaters liegen, und hier insbesondere auf konkurrierenden Zielen, die zu potenziellen Zielkonflikten führen können.
Einen Überblick über die beiden Beziehungsarten von Zielen gibt die Abbildung 2-2.
Abbildung 2-2: Die Zielbeziehungen im Zielsystem in allgemeiner Form
2.5 Potenzielle Zielkonflikte
Bei einer ersten oberflächlichen Betrachtung der vier Ziele könnte man den Eindruck gewinnen, dass hinsichtlich der Zielbeziehungen die vier Ziele in zwei Gruppen einteilbar sind: auf der einen Seite die zueinander komplementären Komponenten Kunst, öffentlicher Auftrag und Publikumsbedürfnisse und auf der anderen Seite das diesen Komponenten entgegengesetzte Ziel Wirtschaftlichkeit. Bei genauerer Analyse wird jedoch klar, dass eine solche Dichotomisierung nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Beziehungen zwischen den Teilzielen sind differenzierter zu sehen. Absolut vorgetragene Formulierungen wie „Die wirtschaftliche Führung des Theaters konkurriert immer mit der künstlerischen Qualität.“ oder „Je höher der künstlerische Anspruch des Theaters ist, desto besser wird auch der öffentliche Auftrag erfüllt.“ kann man nicht gelten lassen.
Im Folgenden wird daher anhand ausgewählter Beispiele für die insgesamt sechs13 möglichen, in der Abbildung 2-3 dargestellten Zielkonflikte im Zielsystem des Theaters gezeigt, dass eine differenzierte und auf die Situation des jeweiligen Theaters abgestimmte Betrachtung erforderlich ist.
Abbildung 2-3: Potenzielle Zielkonflikte im Zielsystem des öffentlichen Theaters
Wirtschaftlichkeit Kunst
Einerseits können ökonomische Restriktionen zur Folge haben, dass Inszenierungen nicht in einer Weise realisiert werden können, die dem künstlerischen Anspruch der Theaterleitung oder des Regisseurs gerecht wird. Z.B. kann eine bestimmte Rolle nicht mit einem Star besetzt werden, weil dies das vorgesehene Budget überschreitet, oder das Bühnenbild kann aufgrund wirtschaftlicher Zwänge nicht so opulent ausfallen, wie es dem Wunsch des Regisseurs entspricht.
Andererseits kann aber auch keine allgemeingültige positive Korrelation zwischen dem Aufwand zur Realisierung eines Bühnenstückes und dessen künstlerischen Wert abgeleitet werden. Ein effizienter Mitteleinsatz kann eventuell sogar dazu führen, dass eine Inszenierung überhaupt erst dem Anspruch der künstlerischen Hochwertigkeit gerecht wird. Man denke hier nur an eine effiziente ablauforganisatorische Gestaltung des Probenbetriebs, die letztendlich zu einem höherwertigen Ergebnis führen kann als ein „künstlerisch-kreatives Chaos“.
Wirtschaftlichkeit Öffentlicher Auftrag
Zur wirtschaftlichen Führung des Theaters gehört u.a. auch eine entsprechende Ausgestaltung des Absatzbereiches. Ein Instrument hierfür ist die Preispolitik. Die Preise wären aus rein ökonomischer Perspektive beim öffentlichen Theater so zu gestalten, dass sie in der Regel zumindest Kostendeckung erreichen. Dies würde eine starke Erhöhung der Eintrittspreise zur Folge haben und stünde jedoch insoweit zum öffentlichen Auftrag des Theaters in Konkurrenz, als es dann einen Großteil der Bevölkerung schon allein deshalb nicht mehr erreichen könnte, weil dieser nicht mehr in der Lage wäre, sich den Besuch einer Theateraufführung finanziell zu leisten.
Eine wirtschaftliche Theaterführung kann aber auch dazu führen, dass aufgrund des geringeren Ressourcenverbrauchs pro Inszenierung oder Aufführung eine größere Anzahl unterschiedlicher Bühnenstücke aufgeführt werden kann. Dadurch könnte ein größerer Teil der Bevölkerung angesprochen werden, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass „für jeden Geschmack“ etwas im Programm ist und somit der öffentliche Auftrag, die Bevölkerung mit Theater zu versorgen, besser erfüllt wird. In diesem Zusammenhang sprechen viele Theaterleute auch nicht von dem Publikum, sondern von vielen unterschiedlichen Publika.
Wirtschaftlichkeit Publikumsbedürfnisse
Eine an ökonomischen Gesichtspunkten ausgerichtete Theaterführung kann den Wünschen des Theaterpublikums entgegenstehen. So ist z.B. ein elitäres Theaterpublikum, das aufwendige Inszenierungen mit bekannten und dementsprechend teuren Regisseuren und/oder Gastschauspielern schätzt, nicht mit kostengünstigeren, aber unter Umständen nicht weniger künstlerisch wertvollen Inszenierungen zufriedenzustellen.
Andererseits könnten aufgrund kostengünstigerer Produktionen die Eintrittspreise gesenkt oder mehr Inszenierungen hergestellt werden. Dadurch wäre ein insgesamt größeres Publikum erreichbar, und das Theater könnte besser auf die Bedürfnisse des potenziellen Publikums in seiner Gesamtheit eingehen.
Kunst Öffentlicher Auftrag
Künstlerisch hochwertige Inszenierungen müssen nicht immer im Sinne des öffentlichen Auftrags sein. Künstlerisch Hochwertiges kann, wenn es sehr komplex, abstrakt und von außen schwer nachvollziehbar ist, bildungs- oder sozialpolitische Ziele des Theaters verfehlen. Inszenierungen, die vom Publikum nicht verstanden werden, verfehlen bei diesem ihre Wirkung. Die Stücke können selbst vom interessierten Zuschauer nicht decodiert werden. Sie bieten den Besuchern keine Anregungen zum Nachdenken und keinen Ansatzpunkt zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen. Ohne das nötige Verständnis wird der Bildungsauftrag des Theaters nicht erfüllt.
Andererseits ist die künstlerische Qualität ein wesentliches Merkmal für ein Theater. Qualitativ hochwertiges Theater hebt das Image und die Attraktivität der Kommune bzw. der gesamten Region. Image-Ziele des Trägers werden hierdurch unterstützt. Ebenso können auf diese Weise ökonomische Verbesserungen erreicht werden. Zum einen steigt die Nachfrage nach dem Besuch des Theaters – insbesondere auch von außerhalb des eigentlichen Einzugsgebietes – und führt zu einer ökonomischen Belebung der regionalen Wirtschaft, z.B. beim Gaststätten- und Hotelgewerbe. Zum anderen hat die Qualität der Kulturlandschaft einen großen Einfluss auf die Bedeutung als Wirtschaftsstandort und auf den Zuzug qualifizierter und in der Regel kulturinteressierter Arbeitskräfte. Der öffentliche Auftrag, in den auch ökonomische Interessen integriert sind, wäre besser erfüllt.
Kunst Publikumsbedürfnisse
Die Aufführung künstlerisch hochwertiger Inszenierungen muss nicht immer komplementär zu den Motiven sein, die das Publikum zu dem Theaterbesuch veranlasst haben. Komplexes und schwer zu begreifendes Theater kann Publikum abschrecken. Aspekte wie Unterhaltung oder das Bedürfnis, einfach nur einen entspannten Theaterabend zu verleben, finden so keine Berücksichtigung.
Künstlerische Aspekte und die Befriedigung von Publikumsbedürfnissen können jedoch auch verstärkend zueinanderstehen. So ist dies dann der Fall, wenn das Niveau der Inszenierungen auf das intellektuelle Niveau und den Bildungsstand der Zuschauer abgestimmt ist. Dies innerhalb einer einzelnen Inszenierung zu realisieren, ist häufig schwierig, aber der Spielplan als Gesamtheit könnte diese unterschiedlichen Ebenen berücksichtigen.
Öffentlicher Auftrag Publikumsbedürfnisse
Auch der öffentliche Auftrag des Theaters und die Bedürfnisse des Publikums können miteinander konkurrieren. Das Theater soll zwar unterhalten, aber es hat auch bildungs- und sozialpolitische Ziele zu verfolgen. Diesem Anspruch kann ein Publikum gegenüberstehen, das eher konsumorientiert ist, zumal häufig traditionell „leichte Muse“ gegenüber anspruchsvollen Stücken präferiert wird. Dies wird z.B. am Publikumserfolg der privatwirtschaftlichen Musical-Produktionen sichtbar.
Der öffentliche Auftrag des Theaters und die Ansprüche des Publikums können sich jedoch auch gegenseitig positiv beeinflussen. Dies kann dann der Fall sein, wenn es der Theaterleitung gelingt, sozialpolitischen Stoff in Inszenierungen zu integrieren, die den Geschmack des Publikums treffen.
ÜBUNGSAUFGABEN:
1 Welches ist das Sachziel eines öffentlichen Theaters? Welche Formalziele sind die Grundlage des Theater-Zielsystems?
2. Welche Arten von Zielbeziehungen findet man in einem Zielsystem?
3. Wo liegen mögliche Zielkonflikte zwischen den einzelnen Formalzielen des öffentlichen Theaters?
4. Wie könnte man das Zielsystem eines öffentlichen Theaters z.B. auf ein öffentliches Museum oder eine staatlich getragene Universität übertragen?
6 Im Folgenden vereinfacht als Kunst bezeichnet.
7 Im Folgenden vereinfacht als öffentlicher Auftrag bezeichnet.
8 Im Folgenden vereinfacht als Publikumsbedürfnisse bezeichnet.
9 Im Folgenden vereinfacht als Wirtschaftlichkeit oder Ökonomie bezeichnet.
10 Art. 5 Abs. 3 GG lautet: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei …“
11 Unter dem Begriff künstlerisches Objekt werden sowohl materielle (Kunst-)Werke wie Gemälde, Skulpturen etc. (sogenannte bildende Kunst) als auch immaterielle (Kunst-)Werke wie Theateraufführungen, Konzerte etc. (sogenannte darstellende Kunst) verstanden.
12 Unter der Instrumentalfunktion versteht man den durch die öffentliche Hand initiierten Einsatz öffentlicher Verwaltungen und Unternehmen zur Erreichung wirtschafts-, sozial-, gesundheits-, bildungs- oder kulturpolitischer Ziele.
13 Zwischen den vier Komponenten des Theater-Zielsystems bestehen maximal sechs Beziehungen zwischen jeweils zwei Komponenten.