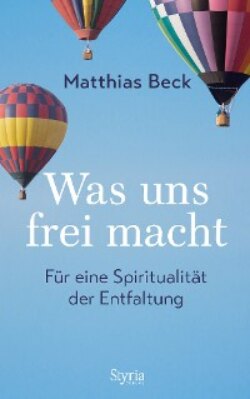Читать книгу Was uns frei macht - Matthias Beck - Страница 5
ОглавлениеHinführung
Manche Menschen assoziieren mit dem Begriff „Ethik“ etwas Positives, manche aber auch eine Fülle von Verboten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, so steht es in den Zehn Geboten. Von einer christlichen Ethik meinen manche sogar, dass sie das Leben blockiere. Für viele Menschen hat das katholische Christentum nichts Befreiendes. Dieses Buch will ein anderes Bild zeichnen. Es widmet sich der Darstellung eines Weges zur Befreiung des Menschen hin zu seiner individuellen Selbstentfaltung. Diese ist keine reine Selbstverwirklichung oder Egoismus, sondern Verwirklichung des innersten Wesens des Einzelnen,2 die Verwirklichung des Göttlichen in ihm. Dieses übersteigt das Ich des Menschen „um ein Unendliches“.3 Jeder Einzelne kann in seinem tiefsten göttlichen Grund zu sich selbst und zum anderen finden.
Die Begriffe Ethik und Moral werden oft synonym verwendet. Sie sind aber zu unterscheiden. Moral bezieht sich eher auf das gelebte Leben. Ethik hingegen ist die wissenschaftliche Reflexion auf die gelebte Moral. In der Ethik als wissenschaftliche Reflexion wird gefragt, warum wir so handeln. Ethik liefert Begründungen. Es geht dabei unter anderem um das tiefere Verständnis von inneren Haltungen (Tugenden) und menschlichen Handlungen (Normen). Ethik ist die Lehre vom guten Handeln und richtigen Leben. Eine „gute“ Ethik soll dem Leben des Menschen in seiner Verbundenheit mit anderen dienen. Sie hilft, dass Menschen ihr Glück finden und das Leben gelingt. So sollte auch eine christliche Ethik zur Freiheit, zum Glück und zu einem Leben in Fülle führen. Eine „gute“ Ethik ist außerdem universal, wie Immanuel Kant es formuliert hat. Sie gilt für alle Menschen.
Die inneren Haltungen werden auch als Tugenden bezeichnet. Der Begriff „Tugend“ hat mit „Tauglichkeit“ zu tun. Richtige innere Haltungen sollen tauglich sein für das Leben. Aristoteles postuliert im Anschluss an Plato vier derartige Tugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Klugheit meint dabei, langfristig zu planen und das Ende von Handlungen zu bedenken.4 Gerechtigkeit heißt, dass man den anderen Menschen gerecht werden soll (personale Gerechtigkeit), jedem das Seine gibt, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt, dass man faire Geschäfte macht (Tauschgerechtigkeit) und sich um eine gerechte Verteilung der endlichen Güter dieser Welt kümmert (Verteilungsgerechtigkeit).
Tapferkeit ist ein Begriff aus dem Militär und meint die rechte Mitte (Maß) zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Der feige Soldat bleibt im Schützengraben, der tollkühne rennt blind ins Feld. Die rechte Mitte ist die Tapferkeit: Der Tapfere überwindet etwa seine Feigheit und handelt klug und überlegt. Tapferkeit ist heute wohl eher mit Zivilcourage oder Mut zu übersetzen. Die Tugend des Maßes durchzieht alle anderen Tugenden. Sie ist nicht das Mittelmaß, sondern die rechte Mitte zwischen zwei Extremen.
Für die Medizin heißt die rechte Mitte die richtige Dosis: nicht zu viel, nicht zu wenig. „Die Dosis macht das Gift“, heißt es bei Paracelsus. Tugenden lernt man nicht aus Büchern, sondern man muss sie täglich einüben und vollziehen. Ein gerechter Mensch wird man dadurch, dass man sich jeden Tag bemüht, gerecht zu entscheiden und zu handeln. Dieses ständige Üben formt langsam den Charakter. Goethe hat es so zusammengefasst: „Es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt.“5
Ethik bezieht sich also auf innere Haltungen und äußere Handlungen des Menschen. Zum richtigen Handeln bedarf es einiger Regeln, Normen genannt. Diese Regeln kann sich der Mensch selbst ausdenken oder sie kommen aus einem religiösen Hintergrund. Erstere führen zu einer philosophischen Ethik, Letztere zu einer theologischen, wie zum Beispiel zu den Zehn Geboten. Als philosophische Ethik ist die erwähnte Tugendethik von Aristoteles zu nennen oder die philosophische Reflexion über den Begriff der Menschenwürde bei Immanuel Kant. Oft durchdringen sich philosophische und theologische Zugänge.
Um genauer zu verstehen, was theologische Ethiken sind, muss kurz über die Frage nachgedacht werden, was Religionen sind. Vergleicht man die fünf großen Weltreligionen, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam, zeigen sich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede: Der Hinduismus hat – ebenso wie in anderer Weise die griechische Philosophie – einen Vielgötterhimmel im Hintergrund. Von diesem würde der Philosoph Ludwig Feuerbach vermutlich sagen, dass diese Götter Projektionen des Menschen seien. Diese Götter stehen oft als Chiffren für das Unerklärliche wie Naturkatastrophen, die das Leben zerstören, aber auch für erhaltende Kräfte, die das Leben fördern. In der hinduistischen Ethik geht es unter anderem darum, ob angesichts des Kastenwesens – wenngleich politisch abgeschafft – alle Menschen gleich sind oder ob die unterschiedliche Kastenzugehörigkeit auch zu einer unterschiedlichen Bewertung des jeweiligen Menschen führt.
Der Buddhismus ist zum Teil eine Religion ohne personalen Gott. Er ist eher eine Lebensphilosophie. Hier geht es unter anderem um die Frage nach der Herkunft des Leidens und dass dieses Leiden vor allem durch die Anhaftung des Menschen an innerweltliche Dinge entsteht. Die Aufgabe des Menschen ist es, sich langsam aus diesen Anhaftungen zu lösen. Schrittweise kann er so aus dem Leidensprozess und dem Kreislauf der Wiedergeburten herauskommen. Hinduismus und Buddhismus haben eine Reinkarnationsvorstellung im Hintergrund, die ihrerseits zu bestimmten Ethiken führt.6
Erst mit dem Judentum ändert sich etwas Grundlegendes in der Religionsgeschichte: Das Judentum geht davon aus, dass der Gott, den es Jahwe nennt, von sich selbst sagt, dass er „Da ist“. „Ich bin Da“ (Ex 3,14)7. Er sagt von sich, dass es ihn „gibt“. Man nennt das die Selbstoffenbarung Gottes. Das Judentum ist somit eine Offenbarungsreligion. Der Gott Jahwe zeigt sich in dieser Welt. Er spricht und handelt am Volk Israel. Das Volk spürt, dass die vielen Götter, die es auch in Israel gab, keine Kraft haben. Jahwe aber erfahren sie als einen machtvollen Gott, der das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Diese Befreiung feiert es jedes Jahr beim Pessach-Mahl.
Damit die Menschen die erlangte Freiheit nicht wieder verlieren, gibt Gott ihnen die Zehn Gebote. Sie sind ein Regelwerk, das kein Selbstzweck ist, sondern dem Menschen und seiner Freiheit dienen soll. Das Christentum setzt die Dynamik des Judentums mit der Auffassung eines sprechenden Gottes fort. Das Sprechen Gottes wird in Jesus Christus Mensch.8 Das göttliche Sprechen kommt dem Menschen auf menschliche Weise entgegen. Das Wort Gottes ist ein Gegenüber, wirkt aber auch im Menschen. Göttliches und Menschliches verbinden sich. Das Göttliche wird innerweltlich begreifbar9 und – teilweise – verstehbar. Der Mensch darf und soll Gott verstehen lernen. So kann sein Leben Frucht bringen. „Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt“ (Joh 15, 16). Für das vorliegende Buch sind verschiedene Aspekte aus der ethischen Debatte von Bedeutung. Aus dem Judentum kommen Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe, aus der griechischen Philosophie – vor allem der Nikomachischen Ethik des Aristoteles – Reflexionen über das Glück des Menschen10 und aus dem Christentum die „Dreifaltigkeit“ der Liebe mit Gottesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe bis hin zur Feindesliebe sowie die Hinführung zu einem Leben in Fülle (Joh 10,10).11 Im Christentum wird die äußere Befreiungsbewegung des Judentums zur inneren Befreiung des Menschen fortgesetzt. Jeder Mensch soll zu sich selbst hin befreit werden.12 Es geht um die äußere Freiheit (Handlungsfreiheit), die innere Freiheit (Willensfreiheit) hin zur Wesensfreiheit, die besagt, dass der Mensch befreit werden soll dazuhin, sein eigenes Wesen zu finden.13 Dazu sollte er den Anregungen des guten Geistes in seinem Inneren folgen (dem Heiligen Geist, der heilend und heilbringend wirkt), damit sein Leben heil und ganz wird.
Dieser „Stimme“14 des göttlichen Geistes zu folgen ist keine Fremdbestimmung, sondern Hinführung zur Selbstbestimmung. Der Mensch kann sich erst vom anderen Größeren her selbst finden. Er soll sich immer wieder neu übersteigen, transzendieren. Das führt aus christlicher Sicht zur Fülle des Lebens, zum Glück, zur Vollendung, zum Fruchtbringen, zur Entfaltung. Eine „gute“ religiöse Erziehung sollte dieser Entfaltung des Menschen dienen, allerdings immer mit dem Hinweis auf die Benachteiligten, Armen, Kranken, Gefangenen, denen auch geholfen werden muss. Diese Entfaltung geht nie geradlinig vonstatten, sondern immer auch durch die Gebrochenheit, Endlichkeit, Schuldverstrickung und das Leiden hindurch. Das ist das Kreuz der Welt. Daher sind auch Leid und Tränen unvermeidlich. Aufs Ganze gesehen sollte aber die Fülle des Lebens entstehen. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10).
Zur Frage von Müssen, Sollen und Wollen
Eines sei noch für alle Überlegungen eingefügt: Es kommen in diesem Buch immer wieder Begriffe vor, wie „du sollst“, „du musst“, „du darfst“, „du willst“, „Gott will“. Das klingt nach Zwang, aber es soll um Freiheit gehen – um einen Zusammenfall der Gegensätze. Nikolaus von Kues verwendet dafür den Begriff der coincidentia oppositorum:15 In Gott fallen die Gegensätze zusammen. Für den hier vorliegenden Kontext heißt das zum Beispiel: Das Wollen und das Müssen fallen in bestimmten Bereichen zusammen. Wenn du leben willst, musst du essen und trinken. Wenn du die Autofahrt überleben willst, musst du in der Kurve die Geschwindigkeit reduzieren. Wenn du als Musiker deine Talente entfalten willst, musst du üben. Wenn du einmal frei einen Beruf ergreifen willst, musst du lesen und schreiben lernen. Die Beispiele kann man fortsetzen. In einer Bemerkung über Nikolaus von Kues heißt es: „Aus seiner Sicht sind die Gegensätze in Gott eingefaltet (Hervorhebung d. Verf.), in der Welt ausgefaltet (Hervorhebung d. Verf.).“16 Für dieses Buch gilt: Jedes Sollen oder Müssen ist ein Müssen in Freiheit. Der Mensch kann es auch lassen. Wenn er aber die Freiheit erlangen will, muss er manches tun: „Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht“17, heißt es bei Goethe. Aber es ist ein Müssen oder Sollen, das von innen herandrängt, weil es dem Wesen des Menschen entspricht, und kein von außen aufoktroyiertes Müssen oder Sollen. Ideal wäre es, wenn aus dem Sollen langsam ein Wollen würde.
Und noch etwas anderes: Es wird sehr viel von Entfaltung und erfülltem Leben gesprochen. Aber es gibt leider auch den geschundenen und unterdrückten Menschen, den Armen und den Analphabeten, es gibt das große Leid und das Kreuz in der Welt. Es gibt Menschen, die äußerlich nie in ihrem Leben zur Entfaltung kommen. Dies wirft all die Fragen auf, die mit dem Theodizee-Problem zusammenhängen: Wie kann der gute und allmächtige Gott dieses große Leid in der Welt zulassen? Wenn er es verhindern könnte und es nicht tut, wäre er nicht gut, und wenn er es nicht verhindern kann, ist er nicht allmächtig. Auch dies hat letztlich mit der Freiheit des Menschen zu tun. Gott will den Menschen frei, und das beinhaltet das Risiko, dass der Mensch sich von Gott abwendet. So geschah es im Paradies und so geschieht es immer wieder. Dies ist eine der Ursachen für das große Leid in der Welt. Zu all diesen Fragen will dieses Buch keine Stellung nehmen, sie wurden an anderer Stelle bearbeitet.18