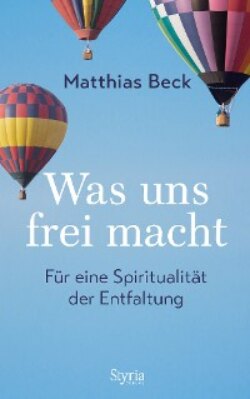Читать книгу Was uns frei macht - Matthias Beck - Страница 9
Du sollst mehr Frucht bringen – Vom Guten zum Besseren
Оглавление– Die bessere Alternative –
Ein Apfelbaum kann einhundert Äpfel hervorbringen oder zweihundert. Zweihundert ist besser als einhundert. So würde eine innerweltliche Philosophie argumentieren. Man kann mehr Menschen damit ernähren. Wie bringt der Baum mehr Frucht? Vielleicht durch bessere Düngung, bessere Wasserversorgung, mehr Licht, Genmanipulation? Aber geht es um mehr Quantität (mehr Äpfel) oder um mehr Qualität (bessere Äpfel)? Wie kann der Mensch mehr Frucht bringen? Und um welche Früchte geht es?
Oft wird in der Ethik unterschieden zwischen „Gut und Böse“ oder gut und schlecht. Hier geht es um „gut“ und „besser“. Immer wieder geht es im Neuen Testament um dieses Verhältnis: „Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr kümmert es dich nicht, daß meine Schwester die ganze Arbeit mir alleine überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere (Hervorhebung d. Verf.) erwählt, das soll ihr nicht genommen werden“ (Lk 10, 38-42).
„Besser“ heißt in diesem Fall, dass Maria zuerst auf das Wort Jesu hört und dann erst wieder zu arbeiten beginnt. Es ist die Priorität, um die es hier geht: erst das Hören, dann das Tun. In der Sprache der Mönche: erst das Beten, dann das Arbeiten – ora et labora. Oder wie es bei Ignatius von Loyola heißt: contemplativus in actione – betend in der Arbeit. Das bedeutet nicht – wie noch im Mittelalter –, dass das kontemplative Leben in einem Kloster als höherwertig eingestuft wird als das aktive Leben draußen in der Welt, sondern im Alltag die richtige Priorität zu wählen: aus der Stille in die Arbeit, aus dem Sonntag in den Alltag.
Es geht um eine Ethik der Komparative, um eine Ethik des „Mehr“. Für einen Franz von Assisi wäre es gut gewesen, das Geschäft seines Vaters zu übernehmen. Viele Menschen tun dies. Für ihn war es aber besser, auf alles zu verzichten, in Armut zu leben und einen Orden zu gründen. Besser heißt in diesem Fall, dass er erst so seinen inneren Frieden und die Erfüllung seines Lebens gefunden hat. Christlich gesprochen ist er einem persönlichen Anruf Gottes gefolgt. Das Geschäft des Vaters zu übernehmen wäre gut und das „Normale“ gewesen, für ihn persönlich aber ein Irrweg. Er wäre damit dem An-Ruf Gottes ausgewichen, hätte sich abgesondert vom konkreten Willen Gottes. Wahrscheinlich wäre er schrittweise in eine Traurigkeit verfallen und hätte sein Leben verfehlt.
Das Bessere anzunehmen oder abzulehnen ist ein Akt der Freiheit, aber dennoch nicht beliebig. Der Mensch soll das Bessere wählen, weil es für ihn und die Welt das Bessere ist. Das Bessere ist hier, dem konkreten Willen Gottes zu folgen und nicht nur allgemeinen Gesetzen oder dem Angebot des Lebens und der Familie. Dies hat wiederum zwei Effekte: Zum einen findet der Mensch durch sein Jawort seinen inneren Frieden, seine tiefste Mitte und Identität. Wenn er so mit sich selbst (in Gott) eins ist, kann er sich und den anderen besser annehmen und lieben. Er kann damit Gott, sich selbst und den anderen Menschen mehr dienen und besser zur größeren Liebe unterwegs sein. Zum anderen fügt er sich besser in den Gesamtplan Gottes für die Welt ein und dient so auch der Gesellschaft. Der göttliche Plan ist allerdings kein starrer Plan im Sinne einer Vorherbestimmung, sondern abhängig von der Mitwirkung des Menschen. Auch Maria, die Mutter Jesu, musste ihr Jawort geben zum Plan Gottes und ihrer Berufung, den göttlichen Sohn zur Welt zu bringen. Das Ja des Menschen zum göttlichen Ruf dient auch der Verbesserung der Welt.
Die Theologie drückt dieses Wählen des Besseren so aus: „Von da aus ist, dort wo das ‚bessere Mittel‘ konkret angeboten wird und als solches wirklich und zwar für hier und jetzt erkannt wird, mit ihm nicht nur eine sittliche Möglichkeit, sondern eine sittliche Forderung für den betreffenden Menschen gegeben (und gleichzeitig ermöglicht), obwohl der andere Weg an sich auch einen positiven sittlichen Wert darstellt.“30 Auch hier fallen das Sollen und das „Müssen“ mit einer freien Entscheidung zusammen und münden – wenn es gut geht – in ein eigenes inneres Wollen. Dieses innere Wollen ist ein Wollen, das der Mensch wirklich aus seinem tiefsten Wesen heraus will und nicht nur oberflächlich. Das tiefste Wollen führt auf Dauer zu tiefer Freude, das andere womöglich nur zu kurzfristigem Spaß. Am Ende will der Mensch das, was er soll, weil es gut ist und ihm selbst und anderen guttut.
Biblisch ist dieses Bessere immer wieder an anderen Stellen erwähnt: Ein reicher Jüngling fragt Jesus, was er tun muss, um in das Himmelreich zu gelangen. Er erhält die Antwort: „Halte die Gebote.“ Der Jüngling sagt, das habe er ein Leben lang getan. Und jetzt erhält er die Antwort für das Bessere: „Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmelreich haben; dann komm und folge mir nach“ (Mt 19, 21). Leider konnte der junge Mann dem nicht folgen. Er war sehr reich und konnte sich davon nicht trennen. Er geht traurig davon. Dieses „Wenn du vollkommen sein willst …“ wird in der Bergpredigt noch zu einem Sollen weitergetrieben: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer Vater im Himmel ist“ (Mt 5, 48).
Der Mensch soll und darf an seiner Vervollkommnung und der Vervollkommnung der Welt mitwirken. Dieser ist im Letzten der Ruf zur Vollkommenheit in der Liebe, sogar bis hin zur Feindesliebe: „Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen“ (Mt 5, 44). Das ist das Tiefste und letztlich Erlösende, was eine Religion dem Menschen „anbieten“ kann, dass er seine natürliche Abwehr gegen den Feind überwindet und versucht, ihn zu lieben und für ihn zu beten. Das durchbricht den Rachegedanken, die Vergeltungsspirale und das „Aug um Aug“- und „Zahn um Zahn“-Prinzip. Jesus Christus hat genau das durchbrochen und die Liebe durchgehalten bis zum Ende. Er wurde dafür gekreuzigt. Darin besteht die Erlösung: in der gegen alle Widerstände durchgehaltenen Liebe. Durch diesen „Gehorsam der Liebe“ wurde die Absonderung (Sünde) der ersten Menschen im Paradies überwunden.
Im Blick auf die Weigerung, diesem besseren Weg zu folgen, spricht Karl Rahner – das wird manchen überraschen – sogar von Sünde. Der Begriff Sünde wird ja nicht so gerne gehört. Man assoziiert damit immer, dass jemand etwas falsch gemacht hat, niedergedrückt ist, bereuen, wiedergutmachen, beichten muss. Es geht aber um etwas Tieferes, nämlich dass der Mensch etwas unterlässt, was ihm zum größeren und erfüllteren Leben gedient hätte: „Eine Weigerung ihm gegenüber (dem besseren Weg, Anm. d. Verf.) wäre die ausdrückliche Verweigerung des Willens zum größeren Wachstum in der Liebe Gottes und also Schuld, Sünde.“31
Sören Kierkegaard drückt noch genauer aus, worum es geht: um die Angst, nicht zur eigenen Größe, Wahrheit und Berufung durchzustoßen. Dies nennt er Sünde: „Sünde ist: vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen oder vor Gott man selbst sein wollen“32 und an anderer Stelle: „Sünde ist Verzweiflung“33 und schließlich: „Diese Form von Verzweiflung ist: verzweifelt nicht man selbst sein wollen, oder noch niedriger: verzweifelt nicht ein Selbst sein wollen, oder am allerniedrigsten: verzweifelt ein anderer sein wollen als man selbst, ein neues Selbst sich wünschen.“34 Schließlich kommt Kierkegaard zu dem Schluss, „daß der Grund, warum der Mensch eigentlich am Christentum Ärgernis nimmt, darin liegt, daß es zu hoch ist, … weil es den Menschen zu etwas Außerordentlichem machen will.“35
Es geht also um die Größe des Menschen, die dieser nur von Gott her einlösen kann. Das Nichteinlösen führt zur Selbstentfremdung, zum Nicht-Selbstsein. Diese persönliche Berufung des Einzelnen geht weit über die Erfüllung allgemeiner Normen hinaus.36 Dazu noch einmal Rahner: Vom Grundphänomen einer ganz persönlichen Berufung müsse deutlicher werden, „daß die Sünde über ihre Eigenschaft als Verstoß gegen das Gesetz Gottes hinaus auch und ebenso ein Verstoß ist gegen einen ganz individuellen Imperativ des individuellen Willens Gottes, der Einmaligkeit begründet. Wäre von da Sünde nicht deutlicher erkennbar als Verfehlen der persönlich-individuellen Liebe Gottes?“37
Warum ist Sünde Sünde, könnte man fragen? Oder: Was ist so schlimm an der Sünde? Sie ist letztlich so schlimm, weil der Mensch sich selbst verfehlt. Er lebt an seiner Berufung vorbei und verfehlt seine eigene Mitte und Identität. Er wird sich selbst fremd und damit auch den anderen. Er verliert seine innere Einheit, seine Ganzheit, sein Heilsein. Er verliert schließlich seine Liebesfähigkeit. Es geht im Christentum nicht primär darum, dass Sünde ein Verstoß gegen ein Gesetz oder gegen das System der katholischen Kirche ist, sondern dass es im Letzten um die Selbstverfehlung geht. Das ist ja das „Schlimme“ und Tragische an der Sünde, dass der Mensch sich selbst zerstört. So bringt die Sünde den (inneren) Tod. Aus der Sünde als dem Absondern folgt, dass der Mensch sich selbst, dem anderen und letztlich auch Gott etwas schuldig bleibt. Schließlich fällt er womöglich auch in Schuld im Sinne der Übertretung einer Norm.38
Leider ist in der Geschichte das Phänomen der Schuld oft „nur“ als Normübertretung oder als die Verletzung eines Systems gesehen worden und nicht als die tiefer liegende und folgenreichere Beziehungsstörung zu Gott, die den Menschen sich selbst entfremdet und innerlich tötet. Das Zerstörende der Sünde wird ihres Ernstes beraubt und verharmlost, wenn die Sünde im Sinne der Schuld nur in der Übertretung von Normen gesehen wird. Selbst wenn der Mensch äußerlich alle Normen erfüllt, ist er noch kein guter Mensch. Denn jeder soll ein „positiv Einmaliger“ (Rahner) werden, sich selbst finden und die Liebe umsetzen. Mancher findet sich sogar erst durch die Verfehlung hindurch und manch liebloser Gesetzestreuer, der vermeintlich alles richtig macht, ist ein herzloser Mitmensch. Die erkannte und bereute Verfehlung kann demütiger, bescheidener, verständnisvoller und liebevoller machen. Da es gerade im Christentum um die Vervollkommnung in der Liebe geht und diese Liebe nicht nur die Nächstenliebe meint, sondern auch die Selbstliebe, Selbstfindung und Selbstannahme, ist die Anbindung an den letzten Seinsgrund, an den Weinstock, von zentraler Bedeutung. Denn die richtige Selbstliebe (die kein Narzissmus ist) hat ihre Basis in der Gottesliebe. Die Selbstliebe ist geradezu Voraussetzung und „Maßstab“ für die Nächstenliebe: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist die Gottesbeziehung (Gottesliebe) gestört, sind es auch die Selbstbeziehung (Selbstliebe) und die Beziehung zum Nächsten (Nächstenliebe).
Vielleicht noch ein anderer Zusammenhang: Auf dem Weg zur Vollkommenheit in der Liebe ist es zunächst von untergeordneter Bedeutung, welchen Beruf der Mensch ergreift. Allerdings findet der Mensch besser seine innere Mitte und seinen Frieden, wenn er auch seine „richtige“ Berufung findet und ihr folgt. Insofern hängen das Finden der Berufung und die Liebesfähigkeit zusammen. Wer ständig an sich vorbei lebt und innerlich zerrissen ist, wird auch nicht lieben können: weder sich selbst noch den anderen, geschweige denn den Feind. Nur wer mit sich selbst im Einklang ist, kann sein Glück finden. Immanuel Kant meint sogar, dass es eine Verpflichtung zum Glück gibt, da der Unglückliche meistens auch seine Umgebung unglücklich macht.
– Die Reinigung –
Der Satz „Ihr sollt mehr Frucht bringen“ kann auch etwas ganz anderes besagen. Denn das Gleichnis vom Fruchtbringen beginnt so: „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt (Hervorhebung d. Verf.) er, damit sie mehr Frucht bringt“ (Joh 15,1-2). Dieses Gleichnis kann in zwei Richtungen interpretiert werden. Zum einen, dass diejenigen Menschen, die keine Frucht in ihrem Leben bringen, vom Weinstock abgeschnitten werden und – wie es später heißt – verdorren. „Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen“ (Joh 15, 6).
Die Zielrichtung des Evangeliums ist aber so, dass Gott genau das nicht will. Er will nicht, dass überhaupt ein Mensch verloren geht. Von Jesus heißt es, dass er zu unserem Heil und zu unserer Heilung auf diese Welt gekommen ist und nicht für unser Verderben. Er ist der Heiland. Er soll die Welt nicht richten, sondern retten. „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird“ (Joh 3,17). An anderer Stelle heißt es: „Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist“ (Lk 19,10). Er sagt zu seinem Vater, dass niemand verloren gegangen sei (außer Judas), den er ihm anvertraut habe. „Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt“ (Joh 17,12).
Hans Urs von Balthasar meint, die Hölle sei leer, es sei denn, jemand wolle hinein. Und das ist wohl der Ernst des Lebens, der im vorliegenden Gleichnis ausgesprochen werden soll. Einen Automatismus der Rettung, dass am Ende des Lebens schon alles gutgehen wird, gibt es nicht. Dann würde Gott die Freiheit des Menschen nicht wirklich ernst nehmen und am Ende wäre alles gleichgültig. Gott nimmt aber den Menschen sehr ernst und will seine freie Entscheidung. Das beginnt schon in der Paradiesgeschichte und zieht sich durch das ganze Neue Testament. Der Mensch ist aufgefordert, an seinem Heil, seiner Rettung, seinem Glück und seinem gelingenden Leben mitzuwirken: „Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil!“ (Phil 2,12) Der Mensch kann es nicht aus eigener Kraft, er muss es auch nicht. Diese Aussage soll ihn nicht entmutigen, sondern entlasten. Aber der Weg gelingt nach diesem Gleichnis nur, wenn er angebunden bleibt an den Quell des Lebens, an den Weinstock. Er soll sich daher nicht von der Kraftquelle des Weinstockes abkoppeln, denn getrennt vom Weinstock kann er nichts tun. Es ist wohl eher als Mahnung zu verstehen denn als ein endgültiges Urteil.
Der „Aufwand“, an diesem Weinstock dranzubleiben, ist relativ gering, verglichen mit den Anstrengungen der Menschen, ohne diese Anbindung aus sich heraus Frucht bringen zu wollen. Sie versuchen dies oft mit allen Möglichkeiten der Lebensverbesserung, mit dem, was die Medizin Enhancement nennt: mehr Leistungsfähigkeit durch Genmanipulation, Doping, Medikamente, Wellness und vieles mehr. Hier geht es um Selbstoptimierung. Das aber meint das Evangelium genau nicht.
Der Christ weiß, dass er sich nur sehr begrenzt selbst optimieren kann. Er wird optimiert durch das göttliche Wirken. Daran kann er teilnehmen. Dazu braucht er zunächst nur eines: eine gute Verbindung zum Weinstock, dann wird ihm alles andere dazugegeben. „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit; dann wird euch alles andere hinzugegeben“ (Mt 6,33). Er soll den Kontakt nicht abreißen lassen, damit er Frucht bringen kann. So kann für den Christen eine Art Gelassenheit entstehen, dass er das Fruchtbringen nicht selber machen muss, sondern „nur“ zulassen soll, dass der Durchfluss der Kraft, die vom anderen kommt, nicht behindert wird. Dann kann er mit dieser Kraft mitwirken. In der Heiligen Messe heißt es: „Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit“. Dies steht im krassen Gegensatz zur ständigen Überforderung im innerweltlichen Wettlauf, der ohne die Anbindung an den Weinstock aus sich heraus nach Verbesserung und Fruchtbringen sucht. Nicht selten endet dies in der Situation des Ausgebrannt-Seins (Burnout). Die vom Weinstock abgeschnittenen Reben verbrennen (Mt 15, 6). Davor will das Gleichnis warnen.
Zusammengenommen mit dem zweiten Teil des Gleichnisses, dass diejenige Rebe, die Frucht bringt, gereinigt wird, um noch mehr Frucht zu bringen, sieht man wohl die ganze Richtung des Gleichnisses: Gott will, dass das Leben des Menschen zur vollen Entfaltung kommt und mehr Frucht bringt. Da im Leben nie alles geradlinig verläuft und jeder Mensch (außer Maria, die Mutter Jesu) von Schattenseiten, Fehlern, Schuldverstrickungen betroffen ist, müssen diese Verstellungen im Lauf des Lebens aufgearbeitet, „gereinigt“ und erlöst werden. Nur so kann der Mensch ganz zu sich selbst heranreifen. Es ist wie im Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Jedes Leben enthält beides. Nichts ist rein in dieser Welt, sondern immer auch „verunreinigt“ und von Unkraut durchsetzt. Man soll das Unkraut nicht sofort herausreißen, damit nicht auch der Weizen mit herausgerissen wird (Mt 13, 24). Auf die Frage, ob das Unkraut ausgerissen werden soll, wird geantwortet: „Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus“ (Mt 13, 29). Beides soll und darf wachsen und langsam wird sich das eine vom anderen trennen.
So auch beim Weinstock. Die Rebe soll wachsen und im Laufe des Wachstums wird sie befreit von Verunreinigungen. Der Winzer selbst nimmt diese Reinigung vor. Auf das Leben übertragen könnte man es so interpretieren: Da ist jemand gut unterwegs im Leben, bringt durchaus Frucht, wird aber wegen seiner Erfolge hochmütig und übermütig. Hier kann es sein, dass ihn womöglich Einbrüche im Leben, Leidensprozesse oder Krisen demütiger machen. Krisen des Lebens – aber auch positive Erfahrungen – können durchaus die Reben reinigen, damit sie mehr Frucht bringen. Die Kirchenväter haben von der Pädagogik Gottes gesprochen. Nun greift Gott ja meistens nicht aktiv in das Leben ein. Er wirkt – wie die Theologie sagt – durch Zweitursachen, also durch Ereignisse des Lebens und durch Menschen hindurch. So könnte man auch von der Pädagogik des Lebens sprechen. Wenn man hier das Wort Jesu ernst nimmt: „Ich bin … das Leben“ (Joh 14,6) und so nahezu von einer Gleichsetzung der Person Jesu mit dem Leben ausgeht, könnte man sagen, dass die Pädagogik Gottes mit der Pädagogik des Lebens zusammenfällt oder zumindest Ähnlichkeiten aufweist. Das Leben hat seine eigene Pädagogik und Logik. Es „enthält“ den Logos Gottes. Der Mensch, der sich zu weit vom wahren Leben entfernt, kommt womöglich zu Fall. Wie der Volksmund sagt: Hochmut kommt vor dem Fall.
Die Reinigung der Reben am Weinstock könnte auch noch anders gedeutet werden. Es kann bedeuten, dass der Mensch sich im Lauf seines Lebens – spätestens in der Lebensmitte – auch seinen Schattenseiten stellen muss sowie dem, was bisher verdrängt wurde.39 Das Dunkle des Unbewussten sowie das Tote im Inneren kommen langsam ans Licht. Augustinus hat es in etwa so formuliert: Die Wahrheit bricht sich Bahn, dem, der sich ihr öffnet, eröffnet sie sich, dem, der sich ihr verschließt, verschließt sie sich. Der griechische Begriff für Wahrheit heißt a-letheia (wörtlich: das Unverborgene). Das Verborgene, das oft unangenehm ist, tritt langsam ans Licht. Es kommt an die Oberfläche, kann angeschaut und erlöst werden. Auch in ihm stecken kreative Kräfte. Der Mensch kann sich diesem oft schmerzhaften und tränenreichen Prozess der Bewusstwerdung stellen und ihm zustimmen. Dies ist zum einen notwendig, damit das Unbewusste nicht zerstörerisch im Menschen wirkt und womöglich zu Depressionen führt. Zum anderen schlummert auch im Verdrängten und in den Schattenseiten noch kreatives Potenzial. Wenn das ans Licht kommt, kann mehr Frucht daraus werden. Der Weg der „Wahrheitung“ und der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten, die nicht gerne angeschaut werden und vielleicht Erschrecken auslösen, ist oft ein schmerzlicher und lebenslanger Prozess. Er muss oft mehr erlitten werden, als dass er gewollt ist. Er wird dem Menschen quasi von innen her „aufgedrängt“. Aber es gibt eine Zusage, wenn man sich ihm stellt: „Die Wahrheit wird euch freimachen“ (Joh 8,32) und: „Ihr werdet mehr Frucht bringen“. (Joh 15,2)