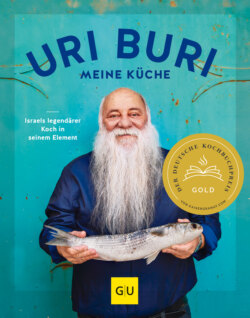Читать книгу Uri Buri - meine Küche - Matthias F. Mangold - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWahre Liebe zum Detail: Dem Original wurde hier wieder auf die Sprünge geholfen.
HOTEL »EFENDI«
Uri ist ein umtriebiger Mensch, der sich mit vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig beschäftigen will und kann. Ein Projekt, das ihm schon lange im Kopf herumgegangen war, war die Idee eines eigenen Boutique-Hotels. Das durfte natürlich nicht nur ein schicker Neubau sein – es sollte etwas Besonderes werden. Ein Ort, der den Besucher zum Staunen bringt und ihn überrascht, bei größtmöglichem Wohlfühlfaktor selbstverständlich. Bedingungen: Es musste in Akkos Altstadt sein, und am besten ein Gebäude mit Charakter, das sich entsprechend umgestalten ließ.
Auf der Suche danach stieß Uri zunächst auf ein Haus, gleich hinter dem Restaurant gelegen, das schon 17 Jahre lang leer stand. Fünf Zimmer wollte er dort unterbringen, doch der Kauf war partout nicht möglich. Kurz darauf wurde ihm, nur wenige Straßen entfernt, im Jahre 2001 quasi ein Doppelobjekt angeboten: zwei benachbarte Gebäude, die zu osmanischer Zeit im 19. Jahrhundert als »Effendi-Häuser« bekannt waren. Alte Paläste, die auf den Trümmern ihrer Vorgänger errichtet worden waren. In diesen Steinen lebte Geschichte, die ältesten Mauern konnten byzantinischer Architektur aus dem 6. Jahrhundert zugeordnet werden. Ein Kellergewölbe stammte nachweislich aus der Kreuzfahrerzeit im 12. Jahrhundert, und natürlich fanden sich Zeugnisse aus den Zeiten türkischer Herrschaft. Insgesamt konnten bei den beiden Gebäuden sieben verschiedene Bauschichten klassifiziert werden. Zudem belegten Funde wie ein großer, inzwischen wieder zusammengesetzter Krug, Münzen, Teller und Gläser aus Zypern sowie weitere Relikte die reiche Vergangenheit.
Die noch vorhandene Architektur der Häuser war von einem französischen Stil geprägt, wie bei den meisten Gebäuden Akkos üblich. Die Besitzer waren stets äußerst wohlhabend. Allerdings war es erst ab 1840 möglich Eigentümer zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt gehörten nämlich alle prächtigen Häuser auf dem Papier dem Sultan, der Wohnerlaubnisrechte vergab. Als dieser dann dringend Geld brauchte, durften die Bewohner endlich Eigentümer werden. Die neuen Hausherren investierten zuhauf und es gab einen regelrechten Bauboom. Doch in Akko fehlte es an Handwerkern. Diese kamen samt vieler Architekten und Künstler aus dem Libanon, das unter französischem Mandat stand. Und darum wurde in Akko so gebaut, wie die Zuwanderer es kannten und mochten.
Insgesamt genau das Richtige für Uri – denn auch die Restaurierung sollte sich zur echten Herausforderung entwickeln. Die beiden Gebäude waren unter eigenen Namen bekannt. Das eine nannte man Afifi-, später Wizo-Haus, das andere war das Hamar- oder Shukri-Haus. Doch beide verband eine Gemeinsamkeit: Es waren heruntergekommene Ruinen, die Dächer teilweise eingestürzt. Solange sich eines der Häuser noch in halbwegs intaktem Zustand befand, war darin ein Kindergarten untergebracht. Als es aber irgendwann zu gefährlich wurde, ließen die städtischen Behörden alles verrammeln, der Zutritt war strengstens untersagt.
»Was jetzt ein einheitliches, verbundenes Haus ist, war in einem furchtbaren Zustand, als ich es gekauft habe. Die intensiven Umbau- und Restaurierungsarbeiten entwickelten sich zu einer Art Konvent der Ingenieure. Es ist das Haus mit dem höchsten Konservierungslevel in ganz Israel, sprich: Nirgendwo sonst hat man so überaus pingelig und gewissenhaft versucht, es in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Das kann man etwa an den Malereien, an den Wandbespannungen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehen. Die Teppiche, das sind echte Ziegler-Teppiche. Philipp Ziegler, eigentlich ein Schweizer Unternehmer, der aber eine Tuchfirma in Manchester betrieb, baute sich damals in Persien ein weiteres Standbein mit einer Teppichmanufaktur-Kooperation auf. Merino Wolle wurde dafür nach Persien exportiert. Ich habe gekauft, was ich davon noch finden konnte. Einerseits wegen der Entstehungszeit, die passt auch gut zum Haus, andererseits weil diese Teppiche keine Konkurrenz für die Kunst an den Wänden ist. Sie haben saubere, klare Farben, sind viel in Beige gehalten und schön strukturiert. Im Grunde haben wir, was die Architektur angeht, also die ganzen Räumlichkeiten, fast nichts neu gemacht – aber wir haben alles auseinandergenommen, gesäubert, repariert, wo es etwas zu reparieren gab, und dann wieder zusammengesetzt. Fast alle Fenster wurden dem ursprünglichen Stil nachempfunden und zudem dreifach verglast, doch zwei große Fenster des Saals, durch die man hinaus zur Terrasse schauen kann, sind tatsächlich noch original. Man muss schon einen ganz besonderen Idioten finden, der sich diese ganze Arbeit macht.«
»DIE KERAMISCHEN ELEMENTE, DIE MAN IM HAUS SIEHT, MACHT DIE FRAU MEINES COMPAGNONS IN HANDARBEIT.«
Tatsächlich sprechen wir hier nicht von der bloßen Wiederinstandsetzung eines Gebäudekomplexes. Bei jedem Schritt, bei jeder Drehung des Kopfes fallen Details auf, die einfach nicht neu sein können, sondern die in mühevollster Kleinarbeit restauriert wurden – von einem riesigen Heer an Experten und Künstlern. Besonders auffällig ist das an den Decken- und Wandmalereien zu sehen. Italienische Kunsthandwerker waren gefühlte Ewigkeiten damit beschäftigt, die vorhandenen Farbmuster, Bordüren oder auch Stuckarbeiten originalgetreu wiederaufleben zu lassen. Ein Fresko konnte freigelegt und rekonstruiert werden. Es zeigt eine Stadtansicht Istanbuls und wurde 1878 von Johannes Saliba zur Grundsteinlegung der Istanbuler Endstation des Orientexpress erschaffen. »Saliba hatte wohl noch nie zuvor eine Eisenbahn gesehen, was man dem Fresko auch anmerkt«, schmunzelt Uri, »er hat sie so gezeichnet wie die Karren der Templer.«
Nach 1918 wurde in einem Gang offenbar der Fußboden neu verlegt und man musste mit zusätzlichem Material ausgleichen. Dafür hat man in Haifa Steinplatten geklaut. Und auf einer dieser Platten ist das eingraviert, denn da steht »Haifa War Cemetery«, mit der Jahreszahl 1918. Jemand wollte es wohl wegschlagen, hat es aber nicht gut genug gemacht.
Man möchte manches Zimmer am liebsten einpacken und mit nach Hause nehmen …
»Das ›Efendi‹ ist sehr großzügig angelegt, was die einzelnen Lebensräume angeht, also nicht nur die Zimmer an sich, sondern auch die frei zugänglichen Bereiche. Wir waren mit Investoren im Gespräch, die alle meinten, dass es unter 20 Zimmern nicht gehen würde, das lohne sich nicht. Wir haben jetzt zwölf. Ich habe immer gesagt, die Speisestärke dieses Hauses ist die Authentizität, und darum war es so wichtig für mich, das auch entsprechend zu halten. Das Haus von damals war unglaublich weitläufig angelegt – und ist es jetzt eben auch noch. Und man kann die Geschichte weiter erzählen. Genau deshalb haben wir etwa die alten Malereien an den Decken, die noch bruchstückhaft vorhanden waren, bewahrt und nachgemalt.«
Überall sind, während man durchs Haus schlendert, Leute am Ausbessern, am Putzen, am Nachmalen. Es ist ein beständiger Prozess. Was die Hotelzimmer angeht, gibt es kein Standardmaß. Das kleinste hat 24, das größte 51 Quadratmeter. Manche besitzen Holzdecken, andere Decken aus Stein mit Stuck. Die Einrichtung besteht aus Unikaten, von den Betten und Sesseln bis hin zu den Badewannen und Waschbecken oder Spiegeln. »Setz dich mal in diesen Sessel da – er ist 112 Jahre alt! Bequem, oder nicht?« Die Zimmertüren sind akustische Türen. Sind sie zu, hört man absolut keine Außengeräusche. Es gibt nirgends eine sichtbare Klimaanlage. »Die war aber tatsächlich sehr schwer zu verstecken«, verrät Uri.
In einem weiteren Raum sind die Stoffe aus ägyptischer Baumwolle. Die Kerzenhalter (die früher eigentlich Öllampen waren) sind, wie man es damals hatte, mit 22 Karat Gold veredelt. Der Tisch, der in einem Saal vor dem Ausgang zu einem Balkon steht, stammt aus einem Kloster, ist uralt und wiegt eine Tonne. Die Keramiken auf den Wandvorsprüngen und Tischen sind von der Frau seines Compagnons angefertigt, die meisten anderen Dinge gesammelt aus Liebhaberei, über Jahrzehnte hinweg.
Der großzügige Lobbybereich des Hotels war nach einem Brand lange eine Ruine gewesen. Heute blickt man an die Decke und kann wieder staunen über feinsäuberlich ausgebesserte Kreuzgewölbe, wobei die Reparaturen kaum merklich ins Gesamtgefüge eingebracht wurden. An einer Wand verdeckt eine Verkleidung den Notausgang. Sie ist in einem orientalischen Muster gelasert, die je nach einfallendem Licht ihre Farbe zwischen Grau, Gold, Braun oder Beige changieren lässt. Ein Nebenraum diente einst als Kirche, das Gewölbe aus der Kreuzfahrerzeit mit seinen fast 1000 Jahre alten Mauern ist heute eine Weinbar. In die oberen Zimmer gelangt man, wenn man möchte, auch über einen Aufzug. Uri weist nach links, in einen Gang: »Das ist der ottomanische Teil«, und dann auf den Lift, »und das der automatische.«
Eine Treppe hoch sind ein Tagungsraum sowie ein kleiner Spa-Bereich mit Hamam und Massageanwendungen, individuell, aber auch für Paare. Erneut ist das Private, das Persönliche betont. Man darf als Gast ruhig das Gefühl haben, fast zu Hause zu sein – vielleicht sogar mit mehr Annehmlichkeiten. Wer hat schon ein eigenes Dampfbad?
»Der Pascha von Akko, der vom Sultan als Statthalter eingesetzt worden war, verliebte sich in eine junge Frau, die als Masseurin arbeitete. Er baute ihr den Hamam, wo er sie oft besuchte und sich verwöhnen ließ. Ständig erfand er Ausreden, um sich von zu Hause wegzuschleichen und zu ihr in den Hamam kommen zu können. Mit der Zeit kam ihm seine Frau aber auf die Schliche. Als ihr Mann wieder einmal geschäftlich in die Türkei reisen musste, ging sie mit ihren Leuten zur Masseurin und jagte sie aus der Stadt. Sie sagte ihr, wenn sie je zurückkehren würde, würde sie geschlachtet werden«, erzählt Uri.
Achteinhalb Jahre hat Uri an dem Haus gearbeitet, bis es eröffnet werden konnte. Es ist ein Haus für Menschen, die wie er viel reisen, und die einen Ort wie diesen zu schätzen und zu würdigen wissen. Da sind es die Kleinigkeiten, die viel zählen und den Unterschied ausmachen, nie die großen Dinge. Alle Getränke im Zimmerkühlschrank sind gratis, ebenso – überall im Haus – der Kaffee, der Tee, die Säfte und Softdrinks. Und die Medjoul-Datteln in den Keramikschalen – »die besten Datteln, die es gibt!«
Hat sich Uri mit dem »Efendi« einen Traum erfüllt?
»Nein, ich glaube nicht an Träume. Aber wenn du einen Traum wahr machen möchtest, muss du erst einmal aufwachen. Alles, was man macht, muss auch einer logischen Überprüfung standhalten. Es ist für mich komisch zu denken, da ist ein Engel herbeigeflogen und hat mir etwas ins Ohr geflüstert. Man sollte auch keine Ziele festsetzen, sonst ist der Weg ja bereits vorgegeben. Einer Idee zu folgen und jeden Tag flexibel zu bleiben, zu lernen, nichts in der kürzesten Zeit oder am billigsten machen zu wollen, das führt zu den besten Ergebnissen.«
Das Hotel »Efendi« hat sofort richtig eingeschlagen und ist zu einem gastlichen Haus geworden, das jetzt schon weltweit seine Fans hat. Es war, wie Uri es ausdrückt, der »game changer« von Akko. Nie zuvor hat jemand in der jüngeren Geschichte in dieser Stadt privat so viel investiert. Dieses Hotel ist der Luxus einer Auszeit wie in der Vergangenheit, verbunden mit den Annehmlichkeiten des Jetzt. Es ist von außen so unspektakulär und unscheinbar, dass man gar nicht erkennt, was sich dahinter verbirgt. Auch das ist eine Nuance, die Uri bewusst so gehalten hat. Innen mehr zu sein, was das Äußere verspricht, ist ganz sein Stil.
»MEIN VATER MEINTE BEI SEINEN SCHÜLERN IN DER LANDWIRTSCHAFTSSCHULE, DAS WERDEN ALLE MAL PFIRSICHBAUERN. JEDER BAUT FÜR SICH.«