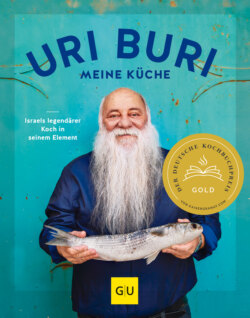Читать книгу Uri Buri - meine Küche - Matthias F. Mangold - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHandeln und Wohnen sind in Akko nicht immer scharf zu trennen.
AKKO UND DIE KOEXISTENZ
Uri und Akko, das ist keine zufällige Verbindung, beileibe nicht. Es ist vielmehr der Schlüssel zu allem, was Uris Denken und Handeln ausmacht. Er spricht dabei oft von der Koexistenz, also vom Zusammenleben, und er macht es vor, privat wie geschäftlich. »Um mich und meine Arbeit zu verstehen, muss man Akko verstehen«, so Uri. Und deshalb werfen wir zunächst einen tiefen Blick in die Vergangenheit.
Akko ist nicht irgendeine Stadt, sie ist eine der ältesten Städte der Welt. Eine Besiedlung lässt sich bis zur Bronzezeit nachweisen, vor mehr als 5000 Jahren also. »Noch heute kommen jedes Jahr amerikanische Archäologen mit ihren Studenten für Grabungen und entdecken dabei jedes Mal noch ältere historische Schichten.«
Ägyptische und mesopotamische Schriften heben Akkos Bedeutung als wichtige Hafenstadt hervor. Phönizier, Perser, Griechen, Römer – sie alle gaben sich in dieser westgaliläischen Stadt die Klinke in die Hand, sogar in der Bibel wird sie im Buch Richter erwähnt. Akkos Lage war schon immer perfekt: ein wichtiger Posten zwischen Europa, Afrika und dem Osten auf dem Landweg. Umgeben von fruchtbarem Land und jeder Menge Frischwasser. Und weil das antike Akko wie eine Halbinsel geformt war, ließ sie sich auch gut verteidigen. Der Hafen war Vorbild für Rhodos, Valetta oder auch Dubrovnik.
Mit dem Jahr 638 n. Chr. kam die Stadt unter arabische Herrschaft, was für die wirtschaftliche Blüte insofern von Wichtigkeit war, als dass der ohnehin natürlich geschützte Hafen so ausgebaut wurde, dass bei jedem Wetter Schiffe einlaufen und Waren gelöscht werden konnten – als einzige Stadt in der gesamten Region. Das wiederum lockte die Kreuzfahrer an, die 1104 die Stadt einnahmen. Nun war Akko ein Zentrum für Pilger, Händler und die Kreuzritter und erblühte vollends. Zwar eroberte Sultan Saladin Akko kurzzeitig zurück, doch der dritte Kreuzzug unter Richard Löwenherz und Philipp II. stellte das alte Machtgefüge wieder her. Angeblich soll auch die österreichische Flagge genau zu dieser Zeit ihren Ursprung in Akko haben: Herzog Leopold V. von Österreich, der Richard Löwenherz begleitete, habe nach einer Verletzung sein blutiges Hemd ausgezogen und am Fahnenmast aufgehängt. Das Hemd, sonst durchweg rot, hatte nur dort einen weißen Streifen, wo der Gürtel verlaufen war. Weil Richard sich empörte, dass Leopold sein Hemd als Fahne gleichberechtigt mit England und Frankreich sehen wollte, warf er es in den Burggraben …
Ein Besuch in Akko ist eine Zeitreise …
… mit eingebauter Entschleunigung.
Johanniter- und Templerorden hatten ihre Sitze nach Akko verlegt, der Deutschorden wurde durch Kaufleute aus Lübeck und Bremen gegründet. Zahlreiche Bauten, darunter das Franziskanerkloster – gestiftet von Franz von Assisi und noch heute vorhanden – oder auch das Hospitaliter-Krankenhaus zeugen von dieser Phase Akkos. 1229 kam es zum Frieden von Jaffa, bei dem sich Kaiser Friedrich II. und der ayyubidische Sultan al-Kamil unter anderem darauf einigten, die Stadt unter die Verwaltung des Johanniterordens zu stellen. Es begann eine lange, ja sogar bis heute währende Verschmelzung und Koexistenz arabischer und westlicher Werte, auch wenn das Hickhack der Gegner noch eine Weile weiterging. 1799 versuchte Napoleon mehr als zwei Monate lang vergeblich, Akko einzunehmen. Der Legende nach zog er sich resigniert mit den Worten »Wer Akko erobert, erobert die Welt!« zurück. Zumindest seine zurückgelassenen Kanonen sind noch heute auf dem Festungswall zu besichtigen. 1920 wurde Akko den Briten zugeschlagen, die ohnehin das Mandat für Palästina hatten, seit Mai 1948 ist die Stadt Teil des Staates Israel.
Ja, und dann gibt es noch die Bahai, eine Religionsgemeinschaft, die die heiligen Schriften anderer Weltreligionen mit einbezieht und die Unterschiede zwischen den Religionen eher als Ausdruck verschiedener Bedürfnisse und kultureller Prägungen begreift. Was auch auf die Sufis und Jeshruti zutrifft, die ebenfalls in Akko präsent waren und sind.
»HEBRÄISCH, DEUTSCH UND ENGLISCH SPRECHE ICH NATÜRLICH, DANEBEN HABE ICH GRUNDKENNTNISSE IN ARABISCH, NIEDERLÄNDISCH, FRANZÖSISCH. UND EIGENTLICH IN ALLEN SPRACHEN. WENN DU LANGSAM SPRICHST, VERSTEHE ICH SCHNELL.«
Wir sind auf der Terrasse des Hotel »Efendi«, um uns herum Häuser der Bahai. Und ganz nahe ein Gebäude, das einst als Gefängnis genutzt wurde, und in dem Baha’ulla eingesperrt war, der Gründer und Religionsstifter der Bahai. Uri erklärt: »Sein Sohn, Abbas Effendi, kaufte ein Haus gegenüber dem Gefängnis, damit er seinen Vater jeden Tag wenigstens sehen konnte, von Fenster zu Fenster. Baha´ullas Lehrer Bahá sagte einmal, er habe einen Traum gehabt. Er hätte Baha´ulla auf einem Berg sitzen und in ein fruchtbares Tal hinunterblicken sehen. Das war in diesem Traum Akko, das er vom Berg in Haifa aus gesehen hat. Als Bahá starb, wurde er zunächst in Persien begraben, seinem Heimatland, aus dem ihn zuvor die Türken verjagt hatten, weil er ihnen zu mächtig geworden war. Später hat man darum gebeten, ihn wegen der Vision seines Lehrers in Akko bestatten zu dürfen. Die israelische Regierung hat es erlaubt, und dann hat man diesen berühmten Garten drüben in Haifa gebaut.«
All diese Verwerfungen in der Geschichte, dieses Wirrwarr, der Zoff der Kulturen haben ihre Spuren hinterlassen, mit Sicherheit. Vor allem bei den Mächtigen und im geopolitischen Gefüge der jeweiligen Zeiten. Ein kompletter Austausch der Bevölkerung ist damit nie wirklich einhergegangen, auch wenn immer Akzente und Impulse durch Neuankömmlinge hinzugekommen sind. Man hat sich angepasst, eingebracht, miteinander und untereinander arrangiert. Vor 1948 war Akko lange Zeit arabisch geprägt. Heute ist die Stadt zwar mehrheitlich zu etwa 65 Prozent von Juden bewohnt, in der Altstadt (2001 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben) sind es aber 95 Prozent israelische Araber. Ein Rundgang durch diese Altstadt zeigt wesentlich mehr orientalisches Flair als in den meisten anderen Städten des Landes, allenfalls die Altstadt Jerusalems setzt noch einen oben drauf. Die Läden werden von Handwerkern und Kleingewerbebetreibenden geführt. Salim etwa ist ein Steinmetz, der seine Skulpturen ausschließlich mit mechanischen Werkzeugen wie Hammer und Meißel herstellt. Er arbeitet mit Sandstein, Basalt oder Marmor, alles Bruchstücke von altem Mauerwerk, die vor langer Zeit einmal hierher gebracht worden waren. Der Pita-Bäcker Fakhri ist schon über 80 Jahre alt, lässt es sich aber nicht nehmen, noch jeden Tag selbst die Brote in den Ofen zu schieben, den seine Familie vor etlichen Generationen selbst gemauert hat. Auch einen leicht verschrobenen Künstler lernen wir kennen, der die Altstadt mit plastischen Bildwerken aus alten Schuhen, Gießkannen oder auch mal einem Gartenstuhl als großes Outdoor-Atelier belebt.
»ES IST SCHLIMM, WENN DU IN EINEN APFEL BEISST UND ES IST EIN WURM DRIN. ABER WAS IST NOCH SCHLIMMER? ES IST NUR NOCH EIN HALBER WURM DRIN.«
Über allem liegt eine lässige Unaufgeregtheit. Selbst in den Marktgassen geht es weit weniger aufdringlich zu, als man es beispielsweise von Jerusalem her kennt. Es leben keine wohlhabenden Menschen in diesem Teil der Stadt. Viele Jugendliche sind tagsüber auf sich gestellt, da ihre Eltern arbeiten müssen. Lieber hängen sie herum, anstatt Hausaufgaben zu machen. Da gibt es dann Leute wie Tarschichani, der am Ende einer versteckten Seitengasse eine Boxschule betreibt. Er holt die Kids von der Straße und gibt ihnen eine Zukunft. Ein improvisierter Ring, selbstgebaute Fitnessgeräte, Gewichte und ein paar Plastikstühle sind die Ausstattung eines Raumes, der zuvor eine Werkstatt war. Einer seiner Schützlinge, gerade 15 Jahre alt, flog am Tag nach unserem Besuch für einen Kampf nach Berlin.
»Heute funktioniert hier das Zusammenleben der Menschen problemlos«, sagt Uri. »Und ich rede nicht nur von Juden und Arabern, sondern auch von allen anderen: Christen, Drusen, Sufis, Homosexuellen, Alten, Jungen, … Man lebt zusammen, feiert die Feste der Stadt gemeinsam, hat Achtung voreinander. Das geschieht aber nicht von selbst, alle müssen daran arbeiten. Unser jüdischer Bürgermeister Shimon Lankri hat sich etwa einen arabischen Vize genommen, obwohl er das nicht musste. Es gibt regelmäßige Treffen der Führer aller wichtigen Gruppierungen, damit Probleme gelöst werden, bevor sie sich hochschaukeln. Die Leute begegnen sich mit Respekt und geben ein Beispiel für andere ab. Das ist für mich Koexistenz. Und vielleicht sind das die Gründe, warum die Polizei hier nicht so starke Präsenz zeigen muss wie an anderen Orten.«
Künstler verwandeln Akko nachhaltig. Ein Spaziergang durch die Altstadt ist eine Entdeckungsreise.
Parallel dazu spinnt Uri den Faden der Koexistenzen noch weiter, indem er das Personal des Restaurants und des Hotel aus beiden Glaubensrichtungen – jüdisch wie arabisch – zusammensetzt und auch sonst allerlei individuelle Charaktere beschäftigt. Koexistenz ist für ihn das Hauptelement zum echten Miteinander in gegenseitiger Wertschätzung. »Wer mit dem anderen spricht, lernt ihn kennen, verliert die Angst vor ihm und muss ihn nicht bekämpfen. Es ist im Grunde völlig einfach, wenn man sich nicht über seine Mitmenschen stellt«, sagt er. Im »Uri Buri« und auch im »Efendi« klappt das wirklich ganz ausgezeichnet. Und womöglich wäre das im Laufe der Jahrtausende in Akkos Geschichte ab und an auch schon ratsam gewesen.