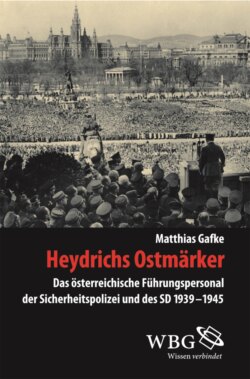Читать книгу Heydrichs Ostmärker - Matthias Gafke - Страница 10
II. Typologie der österreichischen Funktionselite von Sicherheitspolizei und SD Generationen
ОглавлениеUnter welchen Voraussetzungen der Generationsbegriff in der Historiografie zu verwenden ist, wurde in der Forschung breit diskutiert. Andreas Schulz gibt zu bedenken, Generationen würden nicht als universales Erklärungsmodell für geschichtliche Entwicklungen taugen. Kapriziert man sich aber auf eine eng umrissene Gruppe, so Schulz, wie dies Ulrich Herbert mit der Funktionselite von Sipo und SD in seiner biografischen Studie zu Werner Best getan habe, sei ein fruchtbarer Ansatz durchaus gegeben: „Innerhalb einer Generation im biologischen Sinne – einer Alterskohorte in der demografischen Terminologie – herrschen keine homogenen Verhältnisse oder Auffassungen. Sie lassen sich in diesem Sinne auch nicht als ‚Kollektivsubjekte‘ deuten. In einer Generation können sich hingegen Gemeinschaften oder Gruppen bilden, deren innerer Zusammenhalt durch die beschriebenen Merkmale – Abgrenzung zur älteren Generation, Prägung durch gemeinsame Zeit-Erfahrungen und Zeiterleben, Übereinstimmung in Sprache, Gestus, Habitus – begründet wird.“1 Hans Jaeger konstatierte bereits in seinem 1977 erschienenen Aufsatz Generationen in der Geschichte, bei Kriegen, Revolutionen und wirtschaftlichen Krisen großen Ausmaßes komme es zu besonders deutlichen Generationsbrüchen.2
Der Erste Weltkrieg steht für eine Zäsur, die nur schwer überschätzt werden kann. Nach vier Jahren Blutvergießen gehörte die k. u. k. Monarchie ebenso der Vergangenheit an wie das zaristische Russland und das Deutsche Kaiserreich. Schon den Zeitgenossen war bewusst, dass die Zerstörung der alten Ordnung mit mehreren Generationsbrüchen einherging. In dem 1932 veröffentlichten Buch Die Sendung der Jungen Generation stellt E. Günther Gründel drei Generationen vor, die das Ergebnis des Weltkriegs gewesen seien. Dieses überzeugende Modell ist eins zu eins auf die Ostmärker übertragbar, die bis auf den SD-Führer Karl Gelb und den Kripo-Beamten Oswald Tschepper alle nach 1890 geboren wurden und sich somit der jungen Frontgeneration, der Kriegsjugendgeneration oder der Nachkriegsgeneration zuordnen lassen.3 Ein Viertel der österreichischen Funktionselite von Sipo und SD erlebte den Ersten Weltkrieg an der Front.4 Im Schnitt feierten diese „Männer“ 1916 ihren 21. Geburtstag. Als Pifrader 1915 zu den Fahnen eilte, war er noch keine 15 Jahre alt. Den Negativrekord hielt allerdings Rudolf Mildner, der sich mit 13 zum Kriegsdienst meldete. Da das selbst dem Heer zu jung erschien, wurde er abgelehnt und an die k.u.k. Kriegsmarine verwiesen, die ihn dann im Oktober 1916 einberief. Fritz Weber, der wohl am besten als das österreichische Pendant zu Ernst Jünger, dem rechten Wortführer der deutschen Frontsoldatengeneration, beschrieben werden kann, erschien die Rekrutierung von Minderjährigen nicht einmal fragwürdig: „Der Kaiser hat keine Soldaten mehr? Wir werden sie ihm stellen! Und sind es nicht Männer wie die, mit denen wir zweimal schon die Reihen unserer Regimenter füllten, so werden es Buben sein […] so werden es die sein, die freiwillig von den Almen niedersteigen, aus den Schulen davonlaufen, die Lehrstellen verlassen …“.5 Gründel schätzt die Auswirkungen des Kriegserlebnisses auf die junge Frontgeneration, worunter er die zwischen 1890 und 1900 Geborenen versteht, drastisch ein: „sie waren blutjung, noch tief empfänglich für alles und am tiefsten für das Große und Furchtbare. Sie waren noch keine fertigen Männer, Weltanschauung und Mensch waren noch im Werden. Sie sind als begeisterte, aber durch das Übermaß des allzu starken und furchtbaren Erlebens vielleicht sehr bald entwurzelte Jünglinge hinausgetaumelt.“6
Das Massensterben auf einem industrialisierten Schlachtfeld lernten die Ostmärker an der Ostfront in Russland und auf den Kriegsschauplätzen in Italien, Albanien und Galizien kennen. Josef Auinger, ein Linzer Gymnasiast, stand kurz vor seinem 18. Geburtstag, als er im Oktober 1915 freiwillig zur k. u. k. Armee einrückte. Auch ihn beseelte die Abenteuerlust, welche die Jugend seit dem Kriegsausbruch im Sommer 1914 in ihren Bann schlug:
„Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren in kurzen Ausbildungswochen zu einem großen, begeisterten Körper zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit, fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg mußte es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Er schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützenfest auf blumigen, blutbetauten Wiesen. ‚Kein schönrer Tod ist auf der Welt …‘ Ach, nur nicht zu Haus bleiben, nur mitmachen dürfen!“7
Diese jungen Männer fürchteten nichts mehr als ein schnelles Ende des Krieges. Das „Augusterlebnis“ berauschte auch den jungen Hitler, der sich freiwillig zum Dienst in einem bayerischen Regiment meldete und seiner „Feuertaufe“ entgegenfieberte.8 Aber weder der ebenfalls in Linz zur Schule gegangene Hitler noch Auinger trafen zu spät an der Hauptkampflinie ein. Auingers Fronterlebnis währte allerdings nur kurze Zeit. Im Juni 1916 an die Ostfront abgerückt, geriet er im August desselben Jahres in russische Kriegsgefangenschaft, die fünf lange Jahre währen sollte: „Während meiner Kriegsgefangenschaft nahm ich an den Kämpfen im russischen Bürgerkriege mehrmals aktiven Anteil“, so Auinger in seinem 1938 für die SS geschriebenen Lebenslauf.9 Dass er nicht auf der Seite der Bolschewiki gekämpft hatte, erachtete er als so selbstverständlich, dass er es nicht extra ins Feld führte. In der Kriegsgefangenschaft, von der wir aufgrund fehlender Quellen nicht mehr als das eben Zitierte wissen, radikalisierte er sich offenbar. Im Jahr 1923 trat Auinger in die Wiener Sicherheitswache ein. Nachdem er sich als Werkstudent das Jurastudium finanziert hatte, machte er eine Karriere als Polizist. In Arbeiterkreisen galt er als ein zu Gewalttätigkeiten neigender Ordnungshüter, der weibliche Häftlinge ausschließlich als „Rote Huren“ beschimpfen würde. Auch Frauen, so die Arbeiter-Zeitung 1937, müssten bei ihm mit Schlägen rechnen. Die Rote Fahne, das Zentralorgan der österreichischen Kommunisten, warnte im selben Jahr ebenfalls vor dem braunen „Prügel-Kommissar“. Dort war zu lesen, Auinger hätte ein junges Mädchen gegen die Wand geschleudert und an den Haaren wieder nach oben gezerrt. Untersuchungshäftlinge erklärten, dass ihr Geständnis nur unter seinen Schlägen zustande gekommen sei. Einem Opfer war angeboten worden, zwischen einer russischen und einer europäischen Verhörmethode zu wählen.10 Aus den Unterlagen von SS und NSDAP geht hervor, dass der promovierte Jurist zu Recht als Illegaler beleumundet war. Als er am 1. April 1934 Angehöriger der SS wurde, gehörte er der Partei schon fast ein Jahr an.11
An der italienischen Front, an der im Laufe des Krieges Pifrader, Berger, Brichta, Delphin, Fuhrmann, Leo, Ulbing und Witiska kämpften, dominierte das Erleben von Materialschlachten, wie sie wohl von den meisten mit dem Sterben an der Somme oder dem Ringen um Verdun und die Forts Douaumont und Vaux in Verbindung gebracht werden. Ungeachtet der Tatsache, dass im Ersten Weltkrieg neue Waffensysteme zum Einsatz kamen, für die die militärischen Termini U-Boote, Kampfflugzeuge, Tanks, Flammenwerfer und Giftgas stehen, wurde die Masse der von 1914 bis 1917 an der Westfront eingesetzten Truppen durch die konventionelle Artillerie getötet oder verwundet.12 Ohnmächtig waren die Soldaten dem „Feuer“ ausgeliefert, das im Landser-Jargon das Zusammenspiel von Handfeuerwaffen und Artilleriebeschuss bezeichnete. Wie intensiv dieses Erlebnis war, dokumentiert die Diaristik Ernst Jüngers, der von 1914 bis 1918 im Westen an der Front stand, siebenmal verwundet wurde und vom Kaiser den höchsten deutschen Orden, den Pour le Mérite, verliehen bekam.13 In seinen Tagebüchern entfaltet er eine Feuer-Metaphorik, welche die Impressionen der Materialschlachten besonders plastisch macht: „rote Glut“, „brennender Ozean“, glühheißer Atem“, „mechanischer Tod“, „speiender Krater“, „flammender Hochofen“, „loderndes Meer“, „rotglühende Landschaft eines Jüngsten Gerichts“.14
Abb. 1: Dr. Josef Auinger (BAB, BDC, SSO-Akte Auinger)
Ein erschreckendes Beispiel für die destruktive Kraft der eingesetzten Industriepotentiale liefert die Somme-Offensive von 1916. Eine Woche lang deckten die Briten den deutschen Frontabschnitt mit rund 1,5 Millionen Granaten ein – das entsprach circa einer Tonne Granaten pro Quadratmeter –, ehe sie am 1. Juli aus ihren Stellungen stiegen und in das Abwehrfeuer der Deutschen liefen. Den Maschinengewehren der Verteidiger, die den Feuersturm in ihren bis zu zehn Meter unter der Erdoberfläche liegenden Unterständen ausgesessen hatten, fielen am ersten Tag der Offensive 60.000 britische Soldaten zum Opfer, wovon 20.000 Gefallene waren. „Für die Briten bedeutete die Somme-Schlacht ihre größte militärische Tragödie im 20. Jahrhundert, ja in ihrer Geschichte überhaupt.“15 Verdun, die „Menschenmühle an der Maas“ (Paul C. Ettighoffer), kostete beide Seiten bis Ende Juni 1916 mehr als 200.000 Tote oder Verwundete. Rund 20 Millionen Granaten hatten dort reiche Ernte gehalten.16
Die Daheimgebliebenen besaßen mitunter präzise Vorstellungen vom Leben und Sterben an der Front. Stefan Georges 1917 fertiggestelltes Gedicht Der Krieg spiegelt dies exemplarisch wider: „Zu jubeln ziemt nicht: kein triumf wird sein ·/Nur viele untergänge ohne würde …/Des schöpfers hand entwischt rast eigenmächtig/Unform von blei und blech · gestäng und rohr./Der selbst lacht grimm wenn falsche heldenreden/Von vormals klingen der als brei und klumpen/Den bruder sinken sah · der in der schandbar/Zerwühlten erde hauste wie geziefer…/Der alte Gott der schlachten ist nicht mehr.“17
Die Kämpfe auf dem südosteuropäischen Kriegsschauplatz standen dem Gemetzel im Westen in nichts nach. Lutz Musner kommt gar zu dem Urteil, für die Zeitgenossen habe das Ringen im Karst und an den Ufern des Isonzo Verdun an Schrecken bei weitem übertroffen. Ein Blick auf den Blutzoll, den Italiener und Österreicher für zwölf Isonzo-Schlachten zwischen Mai/Juni 1915 und Oktober/November 1917 entrichteten, lässt das ungeheure Ausmaß der Tragödie erahnen: Nicht weniger als 800.000 Soldaten verloren ihr Leben. Dazu kam die Zahl der Verwundeten, die offiziell bei rund 1,5 Millionen lag. Verantwortlich für dieses Inferno waren die Alpen, aus denen die Geschosse messerscharfe Gesteinssplitter herausschlugen, die viele Karstkämpfer am Kopf und an den Augen trafen.18 Der Fels erschwerte obendrein den Bau von Stellungen, welche Schutz vor dem feindlichen Feuer boten:
„Was diesen Kampfboden aber erst in eine unvorstellbare Hölle verwandelt, das ist der Stein. Er verwehrt dem Kämpfer den letzten Trost, die Zuflucht in den Schoß der Mutter Erde. Er fesselt ihn an die mühselig gebaute Stellung, zwingt ihn, dort zu bleiben, wo die Sturzflut der Granaten am ärgsten niederdonnert. Dieser Boden aus hartem Muschelkalk verhundertfacht die Wirkung des Feuers. Er reißt nicht in Trichtern auf, sondern zersplittert zu Geröllhalden; er schmettert in Schottergarben hoch, die die Menschen zu unförmigen Klumpen schlagen; er säuft das Wasser des Himmels in sich und gibt keinen Tropfen davon her; er glüht unter den Strahlen der Sonne und läßt die Bora, den eisigen Sturm der Berge, ungehemmt toben. Dieser Boden ist von allen Martern des Krieges die schrecklichste.“19
Dank eines weichen Bodens kannten die 1916 an der Somme oder bei Verdun eingesetzten Soldaten diese Widrigkeiten nicht. Ein Spezifikum der Alpenfront war überdies das archaisch anmutende Duellieren mit Steinen und Fäusten, wenn in Höhenlagen von bis zu 4000 Metern die Waffen versagten oder vor lauter Hass einfach so aufeinander eingeschlagen wurde, um dem Gegner beim Kampf auf Leben und Tod in die Augen zu sehen:
„Mit Kolben und Bajonett, mit Messer und Spaten stürmen sie den Angreifern entgegen, treiben sie den Hang hinunter. Da gibt es keine Führung, keinen Plan, keine Methode. Knäuel von Kämpfenden, Keuchenden, Röchelnden wälzen sich im Schotter. Todesschreie gellen. Nur mehr vereinzelt fallen Schüsse, krachen Handgranaten. Der Großteil der Blutarbeit wird durch Hieb und Stich, durch würgende Fäuste und geworfene Felsblöcke getan.“20
Ansonsten ähnelten sich die europäischen Schlachtfelder in bemerkenswerter Weise. Hüben wie drüben Gräben, Trichter und Maschinengewehrnester, Drahtverhaue, Flammenwerfer und Gasangriffe. Am unerträglichsten schienen den Soldaten allerdings die unbeerdigten Leichen, die dem Atem des Todes gleich, einen widerlich süßlichen Geruch verströmten. Der Isonzo-Kämpfer Fritz Weber glaubte, das „Golgatha der Menschheit“ gesehen zu haben:
„Glutheiße Tage kamen. Der poröse Boden hatte längst jede Spur von Feuchtigkeit in sich gesogen. […] Dort lagen, vielfach unbeerdigt oder von wühlenden Granaten immer wieder der Erde entrissen, die Gefallenen aus zehn Schlachten, die Toten unzähliger Gefechte, zu Skeletten verwest und gebleicht, zu unförmigen Kugeln aufgequollen, Klumpen von Uniformresten, Knochen und Maden. Man hatte Naphtha aus den Stellungen gespritzt und angezündet, Karbolsäure über die Leichen gegossen. Umsonst. Jedesmal, wenn nach Regentagen wieder Sonne kam, wehte der Pesthauch herüber und würgte die Überlebenden mit Ekel und Grauen.“21
Aber wie bei Jünger hinterließen diese apokalyptischen Szenarien nicht nur Desillusionierung. Im Dunst der Handgranaten entstand der Mythos von in Stahlgewittern22 gehärteten Frontsoldaten, die sich als exklusiv verstanden, weil sie die Materialschlachten überlebt hatten. In der Retrospektive konstruierten beide Autoren den Typus eines neuen Menschen, eine Spezies gezeugt durch Feuer und Blut: „Hier wurde eine neue, durch die harte Zucht des Krieges selbst gebildete Rasse sichtbar – erzogen in der Schule der Schlachten und mit dem Handwerkszeug vertraut, mit dem die tödliche Arbeit verrichtet wird. Hier hatte sich der Wille mit der Verwendung der Mittel durchdrungen zu einer Einheit von höchstem kriegerischem Rang.“23 Die Lendenfrucht des mechanischen Todes stand erhaben und nüchtern in der erbarmungslosen Welt seines Vaters, des glühenden Elements.24 Etwas weniger wortgewaltig Weber: „Der Krieg in der Karstöde des Monte Sabotino und Santo, des Doberdo und der Hermada schuf neue Methoden und neue Menschen – Menschen, in denen sich alle Begriffe von Gefahr und Sicherheit, von Leidertragen, Aushaltenkönnen und Tapfersein ins Ungeheuerlichste verschoben. Dieser Kampf erforderte Menschen ohne Nerven. Wer Nerven besaß, dem wurden sie erst aus dem Leib gerissen, ehe er sich einen echten Isonzokämpfer nennen durfte.“25
Die Menschwerdung in Kugelgüssen und Granathagel erlebten besonders intensiv Pifrader, Brichta und Fuhrmann. Alle drei kämpften im Alpenkrieg und gaben an, durch eine Verschüttung verwundet worden zu sein. Am heftigsten traf es den im September 1942 an die Spitze der Königsberger Kripo gestellten Brichta, dessen Kriegserlebnis nicht gerade einem Bad in Drachenblut gleichkam. Liest man in seiner Krankengeschichte von einem Lungenriss und einer Herzmuskelschwäche, die aus einer Verschüttung im Weltkrieg resultierten, fühlt man sich eher an Erich Maria Remarques Worte von einer zerstörten Generation erinnert.26 Verstärkt wird dieser Eindruck noch durch die Erfrierungen, an denen Brichta seit dem Krieg im Gesicht und an den Händen litt. Fortan lebte er damit, dass sein Gesicht und die Hände bei Wärme dunkelrot anliefen und heiß wurden.27 Besser erwischten es da Fuhrmann und Pifrader, die ihre Verschüttung und den Krieg ohne bleibende äußere Schäden überstanden.28
Beheimatet war die „Front der Unzerstörten“ (Carl Zuckmayer) in der oft beschworenen Schützengrabengemeinschaft, die eine Art Volksgemeinschaft im Kleinen darstellte: „Auf allen Postenständen sitzen junge Menschen mit kühnen, vom Kampf gehärteten Gesichtern und mit Augen, die groß und dunkel sind. […] Jeder Einzelne fühlt sich in die Gemeinschaft hineingewachsen wie in einen festen Ring. Das sind Augenblicke, in denen man sich des Glückes bewußt wird, das in solchen Bindungen liegt – in der Blutsbrüderschaft auf Leben und Tod.“29
Die Heroisierung der Soldaten, die von den Granaten nicht zerfetzt wurden, muss als eine Sinnstiftung für das eigene Überleben verstanden werden. Die Stahlgewitter bildeten den gemeinsamen Nenner, auf den sich die Frontschriftsteller beriefen, wenn sie an die Veteranen appellierten: „Und wir sind, das fühlen wir jeden Tag mit fester Gewißheit, eine neue Generation, ein Geschlecht, das durch alle Stichflammen und Schmiedehämmer des größten Krieges der Geschichte gehärtet und im Innersten verwandelt ist.“30 Jünger schwebte damit die Politisierung des Frontgedankens zur Errichtung eines modernen nationalistischen Staates vor. Dieser Staat, so Jünger, müsse wehrhaft, sozial und autoritativ sein.31
Die Nationalsozialisten instrumentalisierten das Kriegserlebnis der jungen Frontgeneration ebenfalls. Als Anwälte der Gefallenen stilisierten sie die toten Kameraden zu Blutzeugen des kommenden Reiches:
„Sie sind allgegenwärtig, und die Zeit haben sie abgetan mit ihren Leibern. Ihre Füße sind kalt von fernster Eiszeit, und ihre Häupter flammen von den Sternen fernster Zukunft. Sie wissen, was sie der Welt geschenkt haben, das Beispiel eines unerhörten Opfers die Jahrtausende hinauf. Sie wollen keinen Dank, sie sind unsterblich. So summen und sagen sie unhörbar vom unsichtbaren deutschen Reiche, das seine Wurzeln hat in ihren Wunden. Und sie wissen, daß dieses Reich unsterblich ist mitten unter sterbenden Völkern.“32
In der nationalsozialistischen Exegese des Ersten Weltkriegs wird der Geist der Front zum Träger des Augusterlebnisses verklärt. Den Frontgeist in die Heimat zu tragen, erhoben die Nazis zur höchsten Pflicht, um die Spaltung des deutschen Volkes in Klassen und Parteien ein für alle Mal zu überwinden: „Der Krieg ist aus. Der Kampf um Deutschland geht weiter! Freiwillige vor die Front! Denn wir müssen ja das Licht in die dunkle Welt tragen.“33 Und wer legitimierte da die Braunhemden besser als ein namenloser Feldgrauer, für dessen Bad in Stahlgewittern das Eiserne Kreuz I. und II. Klasse bürgten?
Das Gros der Ostmärker lernte die Front aber nicht mehr kennen. Drei Viertel von ihnen erblickten erst nach 1899 das Licht der Welt, womit sie der Kriegsjugend beziehungsweise der Nachkriegsjugend angehörten:
Tabelle 1: Die Geburtsjahrgänge der Untersuchungsgruppe
Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen von Michael Wildt, der für 77 Prozent des RSHA-Führerkorps ein Geburtsjahr nach 1899 ausmacht.34 Sebastian Haffner resümierte denn auch, die Nazis „sind die in der Dekade 1900 und 1910 Geborenen, die den Krieg, ganz ungestört von seiner Tatsächlichkeit, als großes Spiel erlebt haben.“35 So schlagend es auch ist, dass das Kriegserlebnis nicht als Erklärungsmodell für den Nationalsozialismus taugt, so kann dennoch nicht in Abrede gestellt werden, dass die Stahlgewitter verrohten, Gewaltakzeptanz beförderten und hartgesottene Nazis wie Pifrader und Mildner hervorbrachten. Vom Weltkriegsgefreiten Hitler und seiner frühesten Entourage – Max Amann, Ernst Röhm, Christian Weber oder Hermann Göring – ganz zu schweigen.
Was die nach 1899 Geborenen für den Nationalsozialismus so empfänglich machte, war also etwas anderes. Deshalb wird hier, noch bevor die Politisierung der Ostmärker in Bünden und Korporationen ins Licht gesetzt wird, ein allgemeiner Blick auf die Formationsjahre dieser Jahrgänge geworfen. Zu den positiv besetzten Erlebnissen der zwischen 1900 und 1909 zur Welt gekommenen Kriegsjugend ist die euphorische Stimmung von 1914 ebenso zu rechnen wie die Siegesschulferien, Heeresberichte und Arbeitseinsätze. Negativ konnotiert hingegen war die Erfahrung von Hunger, Not und Elend. Dies bewusst erlebt zu haben, tat einen tiefen Graben zu der nach 1909 geborenen Nachkriegsjugend auf, die höchstens vage Erinnerungen an die Welt der Väter besaß.36 Mit Blick auf die Weimarer Republik erübrigt sich für Detlev Peukert eine solche Differenzierung. Kriegs- und Nachkriegsjugend in einen Topf geworfen, spricht er von einer im mehrfachen Sinne überflüssigen Generation. Diese Jugendlichen, so Peukert, seien nach 1918 auf einen überfüllten Arbeitsmarkt gestoßen und besonders stark von der Massenarbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise betroffen gewesen. Zudem hätten sie schmerzlich das Fronterlebnis vermisst, „durch das“, so wiederum Gründel, „viele ihrer älteren Brüder tiefer, härter und radikaler geworden sind“.37
Peukerts Urteil stützt sich zwar auf die Krisenjahre der Weimarer Republik, was aber nicht heißt, im Nachkriegsösterreich hätte es die Jugend leichter gehabt. Das Gegenteil ist der Fall. Das Auseinanderbrechen der k. u. k. Monarchie stürzte die Wirtschaft Deutschösterreichs in eine tiefe Krise. Was eben noch Binnenhandel war, wurde nun zum Exportgeschäft, das Zollschranken zu überwinden hatte. Dass die Erste Republik Nahrungsmittel und Rohstoffe importieren musste, erwies sich als nicht weniger fatal. Und als ob dies nicht genug Wackersteine für den demokratischen Aufbruch gewesen wären, hatten die Österreicher ab 1920/21 mit einer Inflation zu kämpfen. Von der „Krise in Permanenz“ (Fritz Weber) zeugt ebenfalls die Zahl der Arbeitslosen, die in der Alpenrepublik zwischen 1923 und 1929 durchschnittlich bei neun Prozent lag. Die Jugendarbeitslosigkeit dürfte allerdings wesentlich höher gewesen sein. Grund zu der Vermutung geben die Arbeitslosenstatistiken der 1920er Jahre, die diejenigen nicht erfassten, die noch nie gearbeitet hatten. Norbert Schausberger spricht in diesem Zusammenhang von einer Massenarbeitslosigkeit, die selbst in den Konjunkturjahren zu den höchsten in Europa gehört habe. Ursächlich dafür war, dass noch vor der Weltwirtschaftskrise 1929 eine große Börsenkrise das Wirtschaftsleben der Republik lähmte. Österreichische Banken hatten sich mit Aktien- und Franc-Spekulationen verzockt, was 1924 für zahlreiche Unternehmen das Aus bedeutete, die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen ließ und das Vertrauen in die Demokratie nachhaltig erschütterte.38