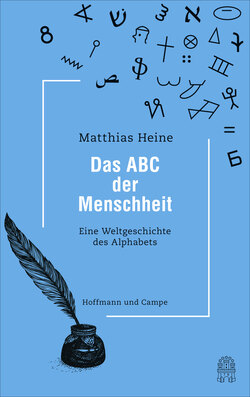Читать книгу Das ABC der Menschheit - Matthias Heine - Страница 7
Die purpurroten Buchstaben
ОглавлениеAls Phönizier bezeichneten die Griechen fremde Händler, die aus der Levante zu ihnen kamen und Luxuswaren anboten, beispielsweise solche wie den wertvollen Krater – ein Gefäß zum Mischen von Wein –, den Achill in der Ilias als Preis für den Sieger des von ihm veranstalteten Wettrennens aussetzt. »Sidoner voller Kunstsinn hatten’s schön gefertigt. Phoiniker aber hatten’s mitgebracht über das dunkle Meer hin« (XIII, 741–745, Übersetzung Joachim Latacz).
Ihren Namen Phoinikes (»die Purpurroten«) trugen sie, weil sie mit Purpur (phoinix), dem Sud der Purpurschnecke Hexaplex trunculus, gefärbte Stoffe verkauften, die kostbarer als Gold waren. In die gleiche Richtung weisen die Wörter Kanaan und Kanaaniter, die aus der Bibel bekannt sind. Dieser Volksname existierte schon in der Bronzezeit und leitet sich wahrscheinlich vom akkadischen Wort kinahhu ab, das – wie das griechische phoinix – »purpurrot« bedeutete. Gemeint waren das westliche Syrien und Palästina. Die Phönizier im engeren Sinne lebten in der Küstenebene des heutigen Staates Libanon, ihre Städte waren Sidon, Arados, Berytos (das heutige Beirut), Tyros und Byblos. Von dort legten diese innovativen Seeleute mit rundbauchigen Schiffen zwischen dem Persischen Golf und dem Atlantik große Entfernungen zurück. Sie kauften Waren aller Art, die sich anderswo mit Gewinn verkaufen ließen. Aus eigener Produktion konnten die Händler nicht nur Purpurstoffe und feinstes Kunsthandwerk anbieten, sondern auch den Mangelrohstoff Holz. Sie waren schon fähig, sich an den Sternen zu orientieren; so war die Navigation auch auf hoher See möglich. Dafür nutzten sie den zweithellsten Stern Kochab im Sternbild Kleiner Bär (oder auch Kleiner Wagen), der ihnen als Polarstern galt. Noch die Römer nannten ihn Stella Phoenicia.
Unser Bild von den Phöniziern ist durch die negativen Klischees der Griechen und vor allem der Römer geprägt, die einen langen Überlebenskampf gegen die Stadt Karthago ausfochten, die von jenen weit entfernt, am Südrand des westlichen Mittelmeers, gegründet worden war. Die Punier, wie die Römer sie nannten, galten schlimmstenfalls als verschlagen – punica fides (»punische Treue«) war ein Synonym für Unehrlichkeit –, bestenfalls als allzu geschäftstüchtig. Das Bild wird noch freundlich überspitzt gepflegt in der Karikatur des phönizischen Kaufmanns Epidemais aus Tyros in Asterix als Gladiator: Er nennt seine Ruderer »Gesellschafter«, die er mit einem Vertrag übertölpelt hat, und gesteht Asterix und Obelix später, dass er sie eigentlich im nächsten Hafen als Sklaven verkaufen wollte.
Der wesentliche Beitrag der Phönizier zur Weltkultur ist die Weiterentwicklung und Konsolidierung des Alphabets. Lange hielt man sie gar für die Erfinder der Buchstabenschrift, aber wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, ist diese Theorie mittlerweile gründlich widerlegt. Allerdings ist ihre Schrift möglicherweise auch nicht direkt aus der protosinaitischen Schrift entstanden, sondern die weite geographische Verbreitung der uralphabetischen Inschriften spricht dafür, dass man an verschiedenen Stellen mit leicht unterschiedlichen Varianten der Buchstabenschrift experimentierte.
Die ältesten phönizischen Schriftproben sind die Monumentalinschriften der Könige von Byblos aus den Jahren 1000 bis 900 v. Chr., da war das Alphabet schon tausend Jahre alt. Das berühmteste dieser steinernen Zeugnisse ist die Grabschrift auf dem 1923 entdeckten Sarkophag des Ahiram oder Ahirom (wir erinnern uns; die Semiten schrieben keine Vokale, deshalb ist die Aussprache des Namens nicht sicher), 38 Wörter im altbyblischen Dialekt, die beginnt: »Zum Sarkophag machte dies Ittobaal, Sohn Ahiroms, König von Byblos, für seinen Vater Ahirom; fürwahr, er setzte ihn damit ins Verborgene.«
Phönizisch ist eine von drei großen Schriftfamilien, die sich am Ende des 1. Jahrtausends v. Chr. auf allerlei undurchsichtigen Wegen aus dem protosinaitischen Alphabet oder ähnlichen Vorläuferschriften entwickelt hatten. Die beiden anderen sind Althebräisch, das nicht identisch mit der hebräischen Schrift der jüdischen Bibelüberlieferung ist (und das ich deshalb hier nur kurz erwähne), und Aramäisch, das sehr viele Tochterschriften in Asien zeugte – doch davon wird ein späteres Kapitel handeln.
Verglichen mit den vorangegangenen Schriften ist das Phönizische wesentlich mehr normiert, die Form der Buchstaben schwankt nicht mehr so stark. Ihre Zahl wird endgültig auf 22 Buchstaben reduziert. Die Schreibung in Linksrichtung wird festgelegt. Die phönizische Schrift ist gut überliefert: Insgesamt 500 Inschriften sind im eigentlichen Phönizien an der Ostküste des Mittelmeers erhalten. Wesentlich mehr – nämlich 6000 – fand man in Karthago, das am Ende des 9. Jahrhunderts v. Chr. als Kolonie von Tyros im Gebiet des heutigen Tunesiens gegründet wurde, und in den von Karthago abhängigen Orten. Unter den Funden sind vollständige schulartige Übungstafeln mit brauchbaren Buchstabenlisten in alphabetischer Reihenfolge.
© Hoffmann und Campe Verlag nach https://de.wikipedia.org/wiki/Phönizische_Schrift; Buchstabennamen nach Ludwig D. Morenz: Ägypten und die Geburt der Alphabetschrift, Rahden 2016, S. 36
Wegen der Ähnlichkeit zum Hebräischen kann man die Zeugnisse in phönizischer Sprache zuverlässig entziffern. Vom Hebräischen ausgehend, hat man auch die Bezeichnung der Buchstaben rekonstruiert. Es sind im Wesentlichen die Namen des frühen hebräischen Alphabets etwas angepasst an das, was man über die Aussprache des Phönizischen weiß. Die Bezeichnungen der hebräischen Buchstaben kennt man aus der Septuaginta, einer Übersetzung der hebräischen Bibel – also dessen, was im Christentum Altes Testament heißt – ins Griechische. Sie entstand im Jahre 200 v. Chr. und heißt so, weil angeblich 70 Weise sie direkt von Gott inspiriert übersetzten. In den Klageliedern des Propheten Jeremias nutzt die Septuaginta die hebräischen Buchstaben, um den Text zu gliedern. Die 22 Namen tauchen im Text mehrfach auf – geschrieben in griechischen Lettern.
Im Phönizischen gerät allmählich der Zusammenhang zwischen den Buchstaben und den Bildzeichen, aus denen sie ursprünglich hervorgegangen sind, in Vergessenheit. Das öffnet Perspektiven für die Zukunft sowohl für abstraktere Schreibweisen, die das Alphabet schließlich anschlussfähig an andere Sprachen machen, als auch für größere Schreibökonomie durch weitere Vereinfachung der Buchstaben.
Die Buchstaben der Phönizier symbolisierten eindeutig Lautelemente der gesprochenen Sprache: d, h, m, p und so weiter. Noch immer wurden ausschließlich Konsonanten geschrieben. Die Buchstaben hießen aleph (»Ochse«), bet (»Haus«), gimel (»Wurfstock«), daleth (»Tür«) etc. Das phönizische Alphabet enthielt schon die Keime von 19 unserer heute bekannten lateinischen Buchstaben, und an vielen Stellen standen sie auch schon in der heute noch üblichen Reihenfolge. Zum Beispiel ist chet (»Zaun«) ein Rachenlaut, aus dem später das H wurde; jod (»Arm und Hand«), der Vorläufer des I; kap (»Handfläche«) war schon damals das K; lamed (»Ochsengeschirr«) das L; mem (»Wasser«) das M; und nun (»Fisch«) das N. Das phönizische lamed stand nicht nur an der gleichen Stelle wie unser L – es sah sogar auch schon genau so aus.
Durch die Gründung von Kolonien, mit der die Phönizier im 9. Jahrhundert v. Chr. begannen – zu den wichtigsten neben Karthago gehörten Städte auf Sizilien sowie Gadir, das heutige Cádiz in Spanien –, verbreitete sich auch die Kunde von der neuen überlegenen Kulturtechnik, die sie beherrschten, bis in entlegene Gegenden des Mittelmeers. Irgendwo dort übernahmen die Griechen Idee und Form des Alphabets von den Phöniziern. Die geniale Erfindung, die so lange im Besitz von Wüstenvölkern in Randlage der zivilisierten Welt gewesen war, verließ den Kreis der semitischen Kultur und trat ihren globalen Siegeszug an.