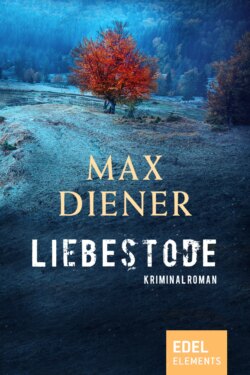Читать книгу Liebestode - Max Diener - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеFlacher Nebel über dem Wasser. Der Sonnenball aus geschmolzenem Glas, das kurz gemähte Gras links und rechts des Wegs feucht vom Tau. Die wenigen Läufer, denen er am See begegnet, in Trainingsanzügen versteckt. Einer wie der andere geschlechtslos, blicklos, jeder wie festgeklebt an den Rändern nächtlicher Träume.
Bereits nach wenigen Schritten bricht dem Läufer der Schweiß aus. Er weiß, was in diesem Moment mit seinem Körper geschieht: Das LDL-Cholesterin im Blut verringert sich, die Mitochondrien in den Muskelgewebezellen nehmen zu, die Sauerstoffversorgung nähert sich mit jedem gelaufenen Meter ihrem Optimum. Am Ende werden die Endorphine zusammen mit den bestens durchbluteten Organen und Muskeln eine perfekte Sympathikolyse bewirkt haben. Medizinische Laien würden es eine Harmonisierung des vegetativen Nervensystems nennen. Oder kurz: Laufen macht gute Laune. Mit diesem Satz hat er einmal – erfolglos – seinen schwergewichtigen Chef von den gesundheitlichen Segnungen regelmäßigen Joggens überzeugen wollen.
Wäre da nur nicht der verdammte Schweiß. Der Läufer hasst die olfaktorische Beleidigung, er hasst die feuchte Nässe, die Hemd und Hose schon nach einigen Hundert Metern am Körper kleben lässt. Wäre es möglich, würde er aus seiner Haut schlüpfen, würde die stinkende Hülle aus Epidermis und Corium hinaus in die Weite werfen und zusehen, wie sie zwischen den Wasserpflanzen versinkt, die große Teile des Sees bedecken.
Wie immer beschleunigt der Läufer unter der Autobahnbrücke. Genau an dieser Stelle hat sich vor einigen Wochen einer aufgehängt. Schwebte in der Frühe gut zwei Meter über dem asphaltierten Spazierweg. Das zum Himmel gewandte Gesicht entspannt, fast friedlich, die Zunge kaum zu sehen. Ein junger Mensch, vielleicht zwanzig, höchstens fünfundzwanzig Jahre alt. Gelbe Turnschuhe, gelbes Sweatshirt, goldene Ringe in beiden Ohren. Der Mann schien an alles gedacht zu haben, als er beschlossen hatte, sich das Genick zu brechen, statt qualvoll zu ersticken: an Beschaffenheit und Länge des Seils, an die Position des Knotens in seinem Nacken, an die Absprunghöhe. Ein Jogger mit Handy hatte damals die Rettung alarmiert. Der Läufer hatte sich davongemacht.
In der Nähe der Anlegestelle für die Ausflugsboote am Südufer des Sees kommt ihm eine Frau mit Hund entgegen. Es ist ein junger Foxterrier, das Tier sucht im Gras und Unterholz nach Maulwurfslöchern und Kaninchenverstecken. Der Hund kümmert sich nicht um ihn, wie es aussieht, scheint er an die flüchtigen Gestalten gewöhnt zu sein.
Der Läufer mag noch zwanzig Schritte entfernt sein, da schaut die Frau ihn an. Ein hübsches Gesicht, wie es die meisten joggenden Männer gern in den Tag mitnehmen: schräg stehende Augen, deutlich asiatisch, und eine längliche Narbe wie die Spur eines Messers auf der ungewöhnlich hohen Stirn. Die Spaziergängerin hat Ähnlichkeit mit einer alten Schulfreundin des Läufers. Anne hieß sie. Anne Kötter. Sie hatte Schauspielerin werden wollen, er hat nie erfahren, was daraus geworden ist. Kann sein, sie ist inzwischen eine brave Hausfrau mit vier Kindern und Gattin eines Oberstudienrats für Deutsch und Erdkunde, der wenig inspiriert die Theater-AG des örtlichen Gymnasiums leitet. Oder verwechselt er Anne Kötter mit Helen? Helen Riedmöller, die sich besonders gern und in der Regel erfolgreich an schüchterne Referendare herangemacht hatte? In der letzten Zeit fällt es ihm zunehmend schwer, sich zu erinnern, es erschöpft ihn wie das Laufen bei Gegenwind. An manchen Tagen breitet sich das Vergessen wie ein nasser, nach Verfall stinkender Mantel über seine Vergangenheit.
Jetzt lächelt die Frau. Wendet ihren Blick nicht ab, wie es viele Spaziergängerinnen und Läuferinnen tun, denen er um diese frühe Stunde am See begegnet. Du bist in Wirklichkeit gar nicht da, wollen sie mit ihrer Geste sagen. Wenn ich dich nicht ansehe, bist du nichts als der flüchtige Schatten eines Baums. Und wenn es dich nicht gibt, brauche ich mich auch nicht vor dir zu fürchten.
Aber die Frau mit dem Hund ist nicht so. Sie lächelt ihn an. Zaghaft zuerst. Unsicher. Mit einem fast unmerklichen Heben der Mundwinkel. Vielleicht soll das Lächeln ihre Angst vertreiben. Die Angst, die sie wie ein Hintergrundrauschen auf ihren Spaziergängen begleitet. Die Angst, die sie vor ein paar Jahren den Hund hat kaufen lassen. Die Angst vor dem, was sie sich nicht vorstellen will. Obwohl sie manchmal davon träumt. Das tun sie doch alle.
Mit jedem Schritt, den der Läufer näher kommt, wird das Lächeln breiter. Die Frau wirkt sicherer als in den Sekunden zuvor, befiehlt nicht einmal den Hund zu sich. „Guten Morgen“, ruft sie dem Läufer entgegen. Und: „Kalt heute, was?“
Er nickt und ist schon vorbei. Hinter einer lang gezogenen Linkskurve führt der Weg über eine kleine Brücke zurück zum Stauwehr. Der Läufer will nicht sprechen, schon gar nicht an diesem Morgen. Er will nicht stehen bleiben. Will nur laufen. Damit es endlich wieder still wird in ihm. Still wie der Tod.
Niemand sollte im Spätsommer sterben, nicht an einem Tag wie diesem: der Himmel über der Stadt blauer Samt, der Wind reine Seide, die Birnen- und Apfelbäume in den Vorgärten voll schwerer Früchte. Durch das offene Fenster dringt der Geruch frischer Erde herein, das Geräusch eines Baggers ist zu hören. Eine Frau, noch nicht alt, hat es geheißen, er ist mit ein paar Kollegen gleich hingefahren. Jetzt sitzt Castro im Schlafzimmer der Toten: den Kopf zur Seite geneigt, die Augen geschlossen, Kinn und Schläfe auf Daumen und Zeigefinger gestützt. Er denkt, sollte man meinen. Er grübelt über das nach, was er gerade zu sehen bekommen hat.
Castro denkt, das lässt sich nicht bestreiten. Oder besser: Er hat gerade damit angefangen – ungeordnet, sprunghaft, wie ein Motor, der nicht recht in Gang kommen will. Niemand in seiner Umgebung ahnt, dass er sich fürchtet, sobald es in ihm zu denken beginnt. Vor dem Unmöglichen, das möglich werden könnte. Vor den Antworten, für die er keine Fragen hat. Vor den Überraschungen, die keine wären, wären ihm nur beizeiten die richtigen Fragen eingefallen. Wenn Castro sich schließlich doch von seinen Gedanken treiben lässt, denkt er sogar die Satzzeichen mit. Dann fühlt er sich sicherer, irgendwie. Die eigentlichen Ermittlungen überlässt er gern den Kollegen von der Spurensicherung. Den Computerexperten. Den Gerichtsmedizinern. Den Madensuchern. Manchmal haben die Weißkittel die Fälle aufgeklärt, bevor er auch nur einen ersten vernünftigen Gedanken gefasst hat. Dann freut er sich. Dann geht es ihm gut.
Doch es gibt Tage – es sind übers Jahr gesehen nicht viele, aber es gibt sie –, da brennt es in Castros Kopf. Da muss er denken, vielleicht gerade weil er nicht will. Da hockt er in seinem Büro, die Augen geschlossen, das Kinn in die Hand gestützt, und brütet. Stundenlang. Auch wenn die anderen hereinkommen und sagen: Beweg deinen Arsch, Castro. Lass uns unsere Arbeit machen, wir kriegen das schon hin. Noch eine Woche, und du kannst den Fall zu den Akten legen. Routine, Castro, Routine ist alles, das weißt du doch mindestens so gut wie wir.
Man hat die Frau tot in ihrem Bett gefunden. Kostweg 3, zweiter Stock, erste Tür links. Von den bodentiefen Sprossenfenstern aus geht der Blick hinüber zu den Ausläufern des Stadtparks, zu den Jugendstil- und Gründerzeitvillen, zu der vom Rost gefärbten baumhohen Senna-Skulptur und den ehemals weißen Parkbänken. Es ist eine der besseren Gegenden der Stadt: edle Restaurants, Spezialitätengeschäfte, eine Buchhandlung für Kunst und Architektur, ein Laden mit ausgefallenen Wohnaccessoires. Obwohl das Stadtzentrum nur ein paar Steinwürfe entfernt liegt, herrscht in den Straßen rund um den Park eine angenehme Stille. Castros Frau hat davon geträumt, hierherzuziehen. Für eine Dreizimmerwohnung in einem der gepflegten Häuser ginge sie sogar putzen, hatte sie gesagt. Damals, als sie nach einer Bleibe für die nächsten Jahre gesucht hatten, als sie noch nichts von ihrer Krankheit wusste.
Bisher haben Castro und seine Kollegen keine Spuren einer gewaltsamen Auseinandersetzung entdeckt, auf den ersten Blick deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Natürlicher Tod, hat der Doktor nach einer ersten oberflächlichen Untersuchung gesagt. Passiert nicht oft in dem Alter, kommt aber vor. Die Putzfrau hat sie alarmiert, eine korpulente Moldawierin mit unvollständigem Gebiss und unbeholfener Zunge. Der Krankenwagen hat die Frau ins benachbarte Hospital bringen müssen. Der Schock hat sie versteinern lassen. Obwohl sich Castro bei der Vernehmung Zeit gelassen hat, ist sie zu keiner vernünftigen Aussage fähig gewesen.
Das breite Futon-Bett mit den glänzenden bordeauxroten Satinbezügen, auf dem sie die Tote gefunden haben, ist zerwühlt; Laufshirt, Lauf-BH und weiße Frotteesocken liegen auf dem Stuhl neben einer schwarz-blau lackierten Kommode. Über allem hängt der schwache Geruch frischen Schweißes. Oder doch nicht? Löst der Anblick der Laufsachen fast automatisch eine Geruchshalluzination aus? Es gibt Theorien, dass genau das geschieht. Castro schüttelt den Kopf. Es ist wie immer: Er beschäftigt sich mit Nebensächlichkeiten, anstatt systematisch vorzugehen.
Eine Läuferin also. Die Haut an Armen und Beinen bis zu Schultern und Gesäß gebräunt, die Muskulatur im Ober- und Unterschenkelbereich wie nicht anders zu erwarten gut entwickelt, der sehnige Körper leicht untergewichtig. Kurze blonde Haare, ein wenig dünn vielleicht. Das im Tod wie geschrumpft wirkende Gesicht bis auf die sternförmigen Falten an Mund und Augenwinkeln glatt, die geöffneten Lippen schmal über ebenmäßigen weißen Zähnen. Kleine Brüste, am Bauch eine Blinddarmnarbe. Die Scham sorgfältig rasiert, ältere blaue Flecken an den Knien, eine frische Blutblase am rechten großen Zeh, Hornhäute unter den Fußsohlen. Die Augen noch halb geöffnet, Castro glaubt in ihnen eine Mischung aus Verwunderung und Wut lesen zu können. Unsinn, denkt er dann, während er sich aufrichtet, wir sehen in den Gesichtern von Toten nur, was wir sehen wollen. Das wird immer so sein, sogar bei einem Profi wie ihm.
„Die Dame gefällt dir,“ stellt der Doktor fest, während er nach seiner Arzttasche greift. „Stehst auf Knochige, was, Castro? Möchte fast wetten, die Tote hatte eine nicht diagnostizierte Herzmuskelentzündung. Verschleppte Grippe oder so. Werden wir schon rauskriegen. Wäre besser zu Hause geblieben, die Schöne, hätte nicht laufen sollen. Sport ist Mord, findest du nicht auch? Und nichts für ungut, mein Lieber.“
Alle gehen mit dem Arzt hinaus, die beiden Bestatter mit der Leiche zuerst. Castro bleibt in der von einem Moment zum anderen wie ausgeweidet wirkenden Wohnung zurück. In der zum Esszimmer hin offenen Küche riecht es immer noch nach frisch aufgebrühtem Kaffee, getoastetem Brot und gebratenem Ei. Merkwürdig, dass die Frau vor ihrem Tod alle Spuren des Frühstücks beseitigt hat. Oder hat jemand aufgeräumt und abgewaschen, den die Frau vom Laufen mitgebracht hat? Die moldawische Putzfrau jedenfalls hat nichts angerührt, zumindest das hat Castro ihr entlocken können, bevor man sie ins Krankenhaus gebracht hat. In Anbetracht des Schocks, ihre Arbeitgeberin tot im Bett gefunden zu haben, glaubt er der Frau.
Die Möbel im Raum lassen die ordnende Hand eines Innenarchitekten erkennen: die meisten Stücke in modernem italienischem Design, dazu einige ausgewählte Antiquitäten; ein zierlicher Sekretär aus Kirschholz, ein Empire-Tischchen, eine Jugendstillampe über einem gläsernen Esstisch. Eine schöne Wohnung, eine Wohnung wie aus einer Wohnzeitschrift. Aber kalt – wie die Frau, die sie jetzt in die Pathologie bringen.
Castro greift in die Tasche seines Jacketts und zieht den Personalausweis heraus, den sie in der schwarzen Lackhandtasche neben der Garderobe gefunden haben: Felicitas Weinbrenner, 37 Jahre alt, 165 cm, Augenfarbe blau. Auf dem Passbild ist sie ungeschminkt und trägt die blonden Haare lang. Castro mag solche Frauen, die ihre Weiblichkeit nicht vor sich hertragen, der Doktor hat mit seiner Vermutung richtiggelegen.
Irgendwann – er könnte nicht sagen, ob zehn Minuten oder zwei Stunden vergangen sind, seit ihn seine Kollegen verlassen haben, in solchen Momenten verlässt ihn das Zeitgefühl – geht er ein letztes Mal durch die Wohnung. Siebzig Quadratmeter vielleicht, eher weniger. Weiße Marmorböden, elektrische Rollos, Fußbodenheizung, hochwertige Armaturen in Bad und Küche, eine offenbar neue schwarz-weiße Markise über dem Balkon. Accessoires, die gut und teuer sind. Felicitas Weinbrenner hat, wie es aussieht, allein gewohnt. Wenn Menschen allein sind, sterben sie früher, hat Castro neulich gelesen. Vielleicht hat es ihm auch jemand erzählt.