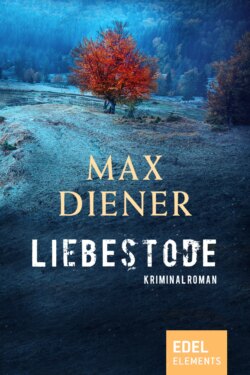Читать книгу Liebestode - Max Diener - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеDie Frau, die vor ihm auf dem OP-Tisch lag, hatte ein hageres Gesicht, daran erinnert sich der Läufer. Tiefe Falten zogen sich von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln, ungewöhnlich für einen Menschen Mitte dreißig. Sie habe Angst vor der Operation, hatte sie ihm am Abend zuvor erzählt, und ihre Stimme hatte dabei gezittert, sie werde bestimmt kein Auge zutun. Der Läufer hatte sich zu ihr ans Bett gesetzt, und sie hatten gemeinsam herausgefunden, dass sie in Wirklichkeit Angst vor der Narkose hatte. Angst, die Kontrolle über sich abzugeben; Angst, nicht mitzubekommen, was während der Operation mit ihr geschieht; ja, auch Angst, nicht wieder aufzuwachen. Er hatte die Frau beruhigen können, hatte ihr erzählt, dass er schon unzählige Male eine neue Herzklappe eingesetzt habe, dass es für ihn Routine sei, genau wie für den Anästhesisten und die anderen Mitarbeiter im OP. Während er geredet hatte, war sie von Minute zu Minute ruhiger geworden, und die Patientin hatte für die Nacht nicht einmal ein Beruhigungsmittel einnehmen müssen.
Die Frau atmete gleichmäßig, der Monitor zeigte eine Herzfrequenz von 68 bis 72 Schlägen, auch ihre sonstigen Körperfunktionen schienen in Ordnung zu sein. Wie schön sie jetzt war, wie entspannt. Die Strenge war aus ihrem Gesicht verschwunden, es hatte sich um Jahre verjüngt. Vielleicht hatte sie so ausgesehen, als sie sich das erste Mal verliebt hatte. Oder als sie schwanger war und jede Bewegung des wachsenden Wesens in ihrem Bauch ein Geschenk. Vier Kinder hatte sie geboren, das jüngste, ein Mädchen, war schwerbehindert auf die Welt gekommen. Sauerstoffmangel während der Geburt, eine tragische Geschichte. Folge war eine Tetraspastik mit massiven körperlichen und geistigen Einschränkungen, das Kind war ein Pflegefall ohne Chance auf grundlegende Besserung, sofern kein Wunder geschah. Und an Wunder glaubte der Läufer schon lange nicht mehr, spätestens seitdem ihn die Feuerwehr aus dem Blechhaufen herausgeholt hatte. Die Kinder warteten auf ihre Mutter, sie brauchten sie. Es würde nach der Entlassung keinen Tag dauern, bis das Gesicht der Frau wieder sein früheres Aussehen angenommen haben würde. Hager. Faltig. Gehetzt. Immer auf dem Sprung. Schade eigentlich, jammerschade.
„Herr Doktor“, hatte ihn die Stimme einer der OP-Schwestern aus seinen Überlegungen gerissen. Anne hatte sie geheißen oder Anna, eine hübsche Russlanddeutsche, die mit einem seiner Kollegen verbandelt war, die es auch schon bei ihm versucht hatte. „Herr Doktor, wir müssen anfangen.“
„Natürlich“, hatte er gemurmelt und hatte Schwierigkeiten gehabt, sich zurechtzufinden. Aber das war schnell vorübergegangen. „Checken Sie noch mal die Funktionen.“
Drei Stunden waren für die Operation angesetzt gewesen. Herzchirurgenalltag, unter Berücksichtigung aller Voraussetzungen nichts Spektakuläres. Die Aortenklappe war durch Infektionen vernarbt gewesen, sie schloss schon länger nicht mehr richtig. Bald wäre es gefährlich geworden, lebensbedrohlich sogar. Die Frau hatte sich nach Beratungen mit verschiedenen Spezialisten entschieden, sie durch eine biologische Klappe ersetzen zu lassen. In acht bis zehn Jahren würde deshalb eine neue Operation fällig werden, aber wenigstens würde sie bis dahin keine Medikamente einnehmen müssen, deren Nebenwirkungen ihren Alltag eingeschränkt hätten. Als vierfache Mutter, dazu mit einem behinderten Kind, konnte sie sich das nicht leisten.
Dann war es passiert. Sie hatten die Herz-Lungen-Maschine abgestellt, das Herz der Frau hatte wieder begonnen, selbstständig zu arbeiten, es war wie immer, es war, wie es sein sollte – da hatte der Muskel einfach aufgehört, Blut zu pumpen. Natürlich hatten sie die Frau sofort geschockt, hatten ihr, als das nichts nützte, Atropin direkt ins Herz gespritzt, schließlich noch eine Herzmassage gemacht. Der Läufer hatte sich an den Reanimationsversuchen beteiligt, wie hätte das sonst ausgesehen. Aber gleichzeitig hatte er in sich den starken Wunsch gespürt, die Frau möge nicht mehr zurückkehren. Als die Geräte dann tatsächlich abgestellt worden waren, als sie aufgegeben hatten, hatte er sich glücklich gefühlt, hatte sich zwingen müssen, das nicht zu zeigen. Die Tote hatte so schön ausgesehen, so unglaublich schön. Stille hatte im OP geherrscht, eine göttliche Stille. Und in seinem Kopf war endlich der Lärm verschwunden, der dort seit dem Unfall fast täglich und oft stundenlang getobt hatte. Seit dem verdammten Unfall, der seine Welt in einen hässlichen Blechhaufen verwandelt hatte.
Hinterher hatte ihn die alte OP-Schwester – Ingrid hieß sie oder Inge – gefragt: „Die erste Patientin, die Ihnen auf dem Tisch geblieben ist?“ Er hatte genickt, und sie hatte wissen wollen, ob er traurig sei. „Ja“, hatte er gelogen. Doch eigentlich hätte er schreien können vor Glück, ja, schreien.
Der Ehemann war, nachdem er vom Tod seiner Frau erfahren hatte, zusammengebrochen und hatte mit einer Anzeige gedroht. Aber ein langes Gespräch mit dem Chefarzt hatte ihn davon abgebracht. „Das passiert uns allen“, hatte der Chef einen Tag später zum Läufer gesagt, „nehmen Sie es nicht so schwer. Aber es sollte die Ausnahme bleiben. Checken Sie in Zukunft noch gründlicher alle Risikofaktoren, haben wir uns verstanden?“
Der Läufer greift nach der Tasse mit dem grünen Tee und klappt die Zeitung zu, die er während des Frühstücks gelesen hat. Damals hat es angefangen, denkt er. Im Augusta-Krankenhaus, OP II.
„Ich hab was für dich“, sagt Kaminski, als Castro nach dem Besuch bei Doktor Windgassen zurück in die Dienststelle kommt. „Wird dich interessieren.“
Norbert Kaminski gehörte zu dem Team, das Felicitas Weinbrenners Wohnung untersucht hat. Jetzt drückt der junge Kommissar dem älteren Castro zwei durchsichtige Beutel mit Haaren in die Hand. Die einen sind blond, die anderen schwarz. Beide scheinen sie ungefähr gleich lang zu sein.
„Und?“
„Die haben wir bei deiner Weinbrenner im Bett gefunden“, antwortet der junge Beamte.
Castro überhört die Ironie in Kaminskis Stimme. „Sie hat an dem Morgen mit jemandem geschlafen“, sagt er.
„Weiß ich“, sagt Kaminski. „Aber schau mal: Es sind mindestens zehnmal so viele schwarze wie blonde Haare.“
„Haarausfall“, gibt Castro zu bedenken. „Haben Männer öfter als Frauen. Solltest du wissen.“
Kaminski tippt auf den Beutel mit den schwarzen Haaren. „Das sind richtige Büschel. Eindeutig. Die Weinbrenner muss sie ihrem Lover ausgerissen haben.“
Castro schaut genauer hin. Tatsächlich – zwischen einzelnen Haaren entdeckt er drei oder vier Büschel. Das ist auffällig, da hat Kaminski recht.
„Manche Leute reißen sich beim Sex an den Haaren“, überlegt Castro.
„Wenn’s ihnen Spaß macht“, sagt Kaminski. „Aber hier war’s vielleicht eher der Versuch, sich zu wehren.“
„Gute Arbeit, Kaminski. Wie alt ist der Mann, dem die Haare gehören? Ist es überhaupt ein Mann?“, fragt Castro.
„Definitiv“, antwortet Kaminski. „Er muss zwischen dreißig und fünfzig sein.“
„Genauer geht’s nicht?“
„Nein.“
„Sonst noch was?“
„Jede Menge Fingerabdrücke im Bad“, antwortet Kaminski, dem es offenbar gefällt, sich die Informationen einzeln entlocken zu lassen. Er fühlt sich wichtig dabei. Bei Castro ist das in seinen ersten Jahren bei der Kripo genauso gewesen.
„Was sagt der Computer?“
„Negativ. Der Lover ist nicht verzeichnet. Die Weinbrenner auch nicht. Übrigens: Der Doktor hat angerufen. Er fragt, ob er die Leiche freigeben darf.“
Wieder zögert Castro. Schließlich nickt er. Der Doktor ist ein guter Pathologe. Wenn er nichts gefunden hat, kann man sich normalerweise darauf verlassen. Dann muss Castro die Antworten auf seine Fragen eben auf anderem Wege erhalten.
Er verwahrt die Beutel mit den Haaren in seinem Schreibtisch und fährt nach Hause. In das kleine Zechenhaus in der Regerstraße, das er und seine Frau vor Jahren Hals über Kopf gekauft haben. Hinter dem es einen Garten gibt, in dem alte Apfel- und Birnbäume stehen, ja, und Stachelbeerbüsche. Das Haus, in dem er noch immer ihre Schritte zu hören glaubt. Das Haus, das viel zu groß für ihn allein ist. Das er behalten hat, weil er nicht loslassen kann. Weil er es nicht einmal versucht hat.
Die Nachmittagssonne taucht den Friedhof in sattes goldenes Licht. Kein Beerdigungswetter, findet Castro. Oder vielleicht doch? Die Sonne als Symbol des Lebens? Eines Lebens, das mit dem Sterben nicht aufhört, wie noch der schäbigste Pfarrer predigen würde? War die Tote eigentlich religiös? Hätte sie sich einen solchen Tag für ihre Beerdigung gewünscht?
Die Trauergemeinde lässt sich an den Fingern einer Hand abzählen: Friederike Weinbrenner, der Filialleiter der Bank, seine Vorzimmerdame, die moldawische Putzfrau in schwarzem Kleid und ein Mann, den Castro nicht kennt. Er trägt einen dunklen Hut tief ins Gesicht gezogen, den er selbst in der Friedhofskapelle nicht abgesetzt hat. Die Farbe seiner Haare, falls er welche haben sollte, ist nicht zu erkennen.
In der Kapelle hat der Pfarrer eine Ansprache gehalten, die Castro mit wenigen Variationen schon oft gehört hat:
Es hat dem HERRN gefallen, unsere Schwester . .. seine Wege sind unerforschlich ... in der Blüte ihres Lebens ... auf dem Sprung in eine große berufliche Zukunft ... wir alle sind erschüttert ... aber wo der HERR nimmt, da gibt er auch ... unsere Zeit steht in seinen Händen. Hinterher haben sie die Kapelle stumm verlassen und stehen jetzt am Grab.
Nachdem der Pfarrer die Tote ausgesegnet hat, lassen die vier Träger den Sarg in das grün ausgeschlagene Loch hinunter, und Castro schließt die Augen. Seit dem Tod seiner Frau kann er diesen Moment kaum ertragen. Als er die Augen wieder öffnet, ist der Mann mit dem dunklen Hut verschwunden. Wahrscheinlich war er einer von Felicitas Weinbrenners Freunden, ein paar wird sie wohl gehabt haben. Hoffentlich war es nicht ausgerechnet der Mann, der in den Monaten vor ihrem Tod mit ihr zusammen, mit dem sie vielleicht in den USA gewesen ist.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitte ich Abstand zu nehmen, hat in der Todesanzeige gestanden. Deshalb wartet Castro, bis die Trauergäste gegangen sind und Friederike Weinbrenner allein neben der offenen Grube steht. Der stärker werdende Wind spielt mit ihren Haaren, bauscht den Rock auf, zerrt an dem dünnen schwarzen Seidenschal, den sie um den Hals gelegt hat.
Sie hält ihm einen der kleinen Blumensträuße entgegen, die in dem schwarz lackierten Ständer vor ihr liegen. „Wollen Sie?“, fragt sie.
Er nickt und wirft den Strauß mit einer, wie er findet, linkischen Bewegung zu den anderen Blumen und den weißen Handschuhen der Träger auf den Sarg. Wieder schließt er die Augen. Sieht die Tote vor sich. Wie sie auf dem Bett gelegen hat. Mit diesem Blick, in dem sich Wut und Erstaunen gemischt hatten. Vielleicht ist es ja der Blick gewesen, der ihn bis heute an den Ergebnissen der kriminaltechnischen und ärztlichen Untersuchungen zweifeln lässt.
„Kommen Sie“, sagt Friederike Weinbrenner. „Begleiten Sie mich zum Auto.“
„Wer war eigentlich der Mann mit dem Hut?“, fragt er, nachdem sie eine Weile schweigend in Richtung Ausgang gegangen sind.
„Sie glauben noch immer, dass es kein natürlicher Tod gewesen ist“, sagt sie. „Stimmt’s?“
Castro zögert. Dann nickt er. „Wer war der Mann mit dem schwarzen Hut?“, wiederholt er seine Frage.
„Ich weiß es nicht“, antwortet sie.
„Hat er sich nicht vorgestellt?“
Sie schüttelt den Kopf.
„Aber er muss doch was gesagt haben.“
„‚Mein Beileid.‘ Sonst nichts.“
„Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ein ungewöhnlicher Akzent zum Beispiel? Oder ein ausgeprägter Sprachfehler?“
„Nein.“
„Haben Sie seine Haarfarbe erkennen können?“
Friederike Weinbrenner denkt einen Augenblick nach. „Schwarz. Ja, der Mann hatte schwarze Haare.“
Verdammt, denkt Castro. Also doch. Felicitas Weinbrenners Liebhaber war bei der Beerdigung seiner Geliebten, und ich habe nicht zugegriffen.
„Hatte der Mann langes oder kurzes Haar?“, fragt er.
Über Friederike Weinbrenners Nasenwurzel erscheint eine ärgerliche Furche. „Ich habe gerade meine Zwillingsschwester beerdigt, und Sie verhören mich“, sagt sie.
„Entschuldigen Sie“, sagt Castro.
Sie zuckt mit den Schultern und reicht ihm die Hand. „Warum ist Ihnen Felicitas eigentlich so wichtig?“
„Fragen gehören zu meinem Job“, antwortet er.
Zurück in der Dienststelle lässt Castro Kaminski die Akten derjenigen Todesfälle aus dem Archiv holen, in denen es eine Obduktion gegeben hat. Es sind verhältnismäßig wenige, in dieser Stadt scheinen die allermeisten Menschen ohne Fragezeichen zu sterben.
Am Ende bleiben drei Fälle übrig, die ihm interessant erscheinen, die ihn vielleicht weiterbringen werden. Drei Fälle aus den letzten beiden Jahren:
Mirjam Lajewski, 37 Jahre alt, unverheiratet, allein lebend. Marketingchefin eines international tätigen Autozuliefererbetriebs. Starb wie Felicitas Weinbrenner an akutem Herzversagen nach einer nicht auskurierten Grippe.
Martina Emde, 39 Jahre alt, unverheiratet, allein lebend. Leiterin eines Reisebüros. Litt seit ihrer Kindheit an Diabetes und Asthma. Starb an akutem Herzversagen.
Charlotte von Winter, 36 Jahre alt, geschieden, kinderlos, allein lebend. Angesehene Vermögensverwalterin mit einer Vielzahl von Klienten im gesamten deutschsprachigen Raum. Starb an akutem Herzversagen als Folge einer Herzmuskelentzündung.
Alle drei Toten hatten nur wenige Angehörige und so gut wie keine engen Freunde. Sie hatten in den Wochen oder Monaten vor ihrem Tod mehrere starke Herzmedikamente eingenommen. Sie waren in ihren jeweiligen Berufen äußerst erfolgreich. Sie waren als langjährige Läuferinnen in einem ausgezeichneten Trainingszustand – zumindest weisen das die Obduktionsberichte aus. Alle drei hatten unmittelbar vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr, wobei ihre jeweiligen Liebhaber Kondome benutzten. Genau wie bei Felicitas Weinbrenner. Allerdings war keine der drei Toten Patientin bei Doktor Windgassen. Das rückt den Herrn mit den feuchten Händen vorerst aus dem Fokus der Ermittlungen. Aber er bleibt auf der Liste der Verdächtigen, noch ist der Arzt nicht aus dem Spiel.
Immerhin ein Anfang, denkt Castro. Es gab schon Fälle, in denen sie bedeutend weniger in der Hand, in denen sie sich über jede Spur gefreut hatten, auch wenn sie noch so abwegig erschien.
Jetzt läutet das Telefon. Es ist Overbeck. Der Chef wird ungeduldig, das war zu erwarten. „Ich warte noch immer auf deinen Abschlussbericht“, sagt er.
„Welchen Abschlussbericht?“
„Über den Tod dieser ... dieser ...“
„Felicitas Weinbrenner“, hilft ihm Castro.
„Genau. Die meine ich. Was ist nun?“
„Ich brauche noch ein bisschen Zeit“, antwortet Castro. „In Ordnung?“
„In Ordnung.“