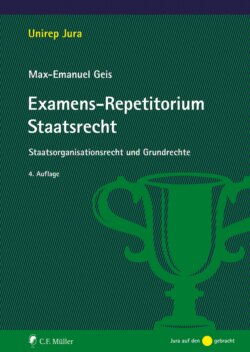Читать книгу Examens-Repetitorium Staatsrecht - Max-Emanuel Geis - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Im Bereich des Staatsorganisationsrechts lassen sich drei klausurrelevante Schwerpunkte kennzeichnen: (1) Geltung und Reichweite von Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen,[1] (2) Probleme um Status, Rechte und Pflichten von Staatsorganen sowie (3) – häufig als formelles Teilelement einer grundrechtlichen Fragestellung – Fragen des Gesetzgebungsverfahrens.
2
(1) Innerhalb der Staatsstrukturprinzipien nehmen das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das Bundesstaatsprinzip einen herausragenden Platz ein. Im Rahmen des Demokratieprinzips spielen wiederum Probleme der demokratischen Legitimationskette und des Wahlrechts einschließlich der Stellung von Parteien die dominierende Rolle. Zu den „klassischen“ Ausformungen des Rechtsstaatsprinzips gehören die Problemkreise: Gewaltenteilung, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, Rechtssicherheit und Bestimmtheit, Vertrauensschutz und Rückwirkungsverbot sowie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den man auch unmittelbar in der Grundrechtsdogmatik angesiedelt findet. Im Bundesstaatsprinzip finden in Klausuren vor allem Fragen der Kompetenzordnung ihre Grundlage. Während die Gesetzgebungskompetenzen vergleichsweise geläufig sind (obwohl ihre Systematik nach der Föderalismusreform 2006 trotz des Wegfalls der Rahmengesetzgebung unübersichtlicher geworden ist), wird die weit kompliziertere Verwaltungskompetenzordnung meist sträflich vernachlässigt. Dagegen spielt das Sozialstaatsprinzip – eine Staatszielbestimmung mit unmittelbarer Geltung[2] – in schriftlichen Prüfungsarbeiten infolge seiner inhaltlichen Weite jedenfalls als eigenständiger Prüfungsgesichtspunkt eine eher untergeordnete Rolle und ist hier daher nicht mit einem eigenen Fall vertreten. Meist wird es als gesetzeskonkretisierender oder ermessensleitender Gesichtspunkt in Grundrechtsfällen angesiedelt sein; Leitbild ist hier nach wie vor die Numerus-Clausus-Entscheidung des BVerfG,[3] die die Ausbildungsfreiheit des Art. 12 GG mit dem sozialen Recht auf Chancengleichheit gekreuzt hat. Gleiches gilt für das Republikprinzip, das eher in verfassungshistorischen und staatstheoretischen Fragestellungen von Bedeutung ist, die dem mündlichen Examen vorbehalten bleiben.[4] Gänzlich außer Betracht bleiben hier das Umweltstaatsprinzip aufgrund seiner mangelhaften, weitgehend „falluntauglichen“ Konstruktion in Art. 20a GG sowie das Kulturstaatsprinzip, dessen Geltung als ungeschriebene Staatszielbestimmung zwar in Rechtsprechung und Schrifttum bejaht wird,[5] dessen normative Verankerung aber über einen geplanten, doch bislang unrealisiert gebliebenen Art. 20b GG nicht hinausgekommen ist.[6]
3
(2) Im Bereich der Staatsorgane bieten die Rechte und Pflichten von Abgeordneten und die Stellung von Ausschüssen (insb. Untersuchungsausschüssen) einen reichen Fundus für Fragestellungen. Unabdingbar für den Examenskanon ist die altehrwürdige Frage nach der Prüfungskompetenz des Bundespräsidenten, die durch „aktive“ Vertreter dieses Amtes ganz neue Aktualität gewonnen hat; hierdurch können wiederum andere – materielle – verfassungsrechtliche Fragestellungen „eingekleidet“ werden. Schließlich wirft die Frage nach dem originären Machtbereich der Exekutive das Problem deren Organisationsgewalt und damit der Gewaltenteilung auf; gleichzeitig baut sie mit den Stichworten „Wesentlichkeitstheorie“ und „Parlamentsvorbehalt“ die Brücke zu den Staatsstrukturprinzipien.
4
(3) Als Verfahren zur Kreation von Normen stellt das Gesetzgebungsverfahren einen Prototyp staatlichen Handelns dar; es birgt nicht nur viele Ansatzpunkte relevanter und irrelevanter Verfahrensfehler, sondern zeigt auch das föderativ geprägte Zusammenspiel von Bundestag und Bundesrat. Gerade deswegen scheint die Aufnahme eines Falles sinnvoll.
Im Folgenden wird versucht, den klausurrelevanten Stoff repräsentativ in examenstypischen Fällen zu erfassen: Die genannten drei „fallfreundlichen“ Staatsstrukturprinzipien sind mit je zwei Fällen vertreten, die Fragen um die Staatsorgane mit insgesamt vier Fällen (zwei „legislative“ und zwei „exekutive“ Beispiele). Dem Handeln der Legislative gilt schließlich der letzte Fall dieses Teils. Die möglichen Verfahrensformen des Verfassungsprozessrechts sind dabei in die einzelnen Fälle des Buches eingebettet. Sie werden durch Schemata begleitet, aus denen sich die Aufbaustruktur der jeweiligen Klage-/Antragsform einprägsam ergibt.
5
(4) Die weltweite Corona-Pandemie ab 2020 lässt auch das deutsche Staatsrecht unter einer neuen Perspektive erscheinen, da hier nahezu alle staatsorganisatorischen und grundrechtlichen Probleme gleichzeitig und flächendeckend auftreten. Die intensive Verknüpfung beider Bereiche soll in Fall 22 thematisiert werden.