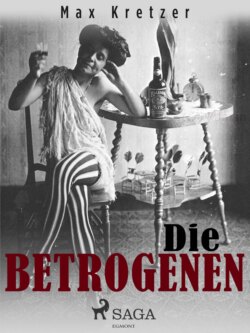Читать книгу Die Betrogenen - Max Kretzer - Страница 8
Drittes Kapitel.
ОглавлениеDie „alte Geschichte“.
„Fräulein Seidel, ich glaube gar, Sie weinen.“ Jenny Hoff war wie immer wild und geräuschvoll in die kleine Kammer gestürmt und blickte jetzt zaghaft die am Fenster Sitzende an.
O, wenn die Kleine das gewusst hätte! Sie wäre drüben in der dumpfen, schmutzigen Stube ihres Vaters geblieben und hätte ihre Lehrerin nicht gestört. Sie fand Thränen so hässlich und konnte es nicht begreifen, wie man zu weinen vermochte, wenn man so eine weisse Haut hatte, wie Maria Seidel sie besass.
Jenny hatte recht gesehen, Maria hatte wirklich geweint. Warum, weshalb? Die blonde Hoff hätte nicht zu fragen brauchen. Sie hätte keine Antwort bekommen. In diesem kleinen, einfenstrigen, armselig möblirten Zimmer mit der Aussicht nach dem tiefgähnenden, von Arbeiterkasernen eingeengten Hof war Alles Schweigen: das geheimnissvolle Dunkel, das wie ein unendlich langer, unsichtbarer Schatten immer stärker und schneller zum Fenster hereinzog und Farben und Linien verschlang; die ganze Atmosphäre, zusammengesetzt aus den emporsteigenden Dünsten der Riesenstadt und der schwülen Abendluft des Sommertages, die sich in der Kammer lagerte; die schwarz erscheinenden wenigen Möbel, die geflickte, farblose, traurig dreinschauende Gardine und das Weib am Fenster, die Bewohnerin dieser möblirten Schlafstelle am meisten. In dem hereinbrechenden Dunkel schien sich die niedrige Decke immer mehr zu neigen, herabzulassen, als wollte sie sich schliesslich, wie ein Alp auf die Menschenbrust, auf all dies Schweigen setzen und es ganz und gar erdrücken, noch todter, öder machen ...
Maria Seidel hatte nicht gehört. Wenn man in versunkenen Welten sich befindet, sind die Sinne für das Geräusch der gemeinen, wirklichen nicht empfänglich.
Was ging es auch Andere an, ob sie geweint hatte, selbst diese niedliche Tochter des Kohlenschippers, die sie vor dem Verderben bewahren wollte!
„O, wenn diese Kleine nur gewusst hätte, dass es auch Thränen geben kann, die Hass und Rache weinen — jener trockene, brennende Durst nach Vergeltung, der nach jahrelangem, wahnsinnig-schmerzhaftem Schmachten endlich die erste belebende Nahrung in erstickten, heissen Thränen findet. Wie da das Herz jubelt, wo die Augen weinen!
„Fräulein Seidel —.“
Die kleine Arbeiterin vermochte dieses Schweigen, dieses ganze Ausserachtlassen ihrer stets vorlauten Person nicht mehr zu ertragen. Sie fühlte hin und wieder, als ein echtes Berliner Vorstadtmädchen, das Bedürfniss, sich in geschwätzigen Plaudereien zu ergehen, und fand nichts peinlicher, unverständlicher, als eine Stille im Zimmer, wenn sie nicht allein war.
„Ich habe Ihnen doch nichts gethan.“
Jenny Hoff liess sich auf die Diele zu den Füssen ihrer Nachbarin nieder und fasste nach deren Händen.
Maria Seidel blickte jetzt auf.
„Du, Kleine —?“
War es die Rührung, die nach den letzten noch in ihren Ohren nachklingenden Worten Jennys sie überkam, die sie sich zu dem Arbeiterkind herniederbeugen hiess, um einen heissen, langen Kuss auf ihre Stirn zu drücken?
„Du solltest mir etwas gethan haben, harmlosestes aller Geschöpfe?“
Sie lachte. Sie wusste selbst nicht worüber — seitdem seit gestern bei ihr die Stimmungen wie Sonnenschein und Schatten wechselten.
„O, Sie lachen, und mir war’s, als weinten Sie. Ich dummes Ding habe wie gewöhnlich wieder nicht Recht. Was war Ihnen nur gestern? Wie ich mich erschrocken hatte! Ich habe den ganzen Nachmittag an Sie gedacht und habe die Fäden immer falsch gespannt.“
Die Plaudertasche gerieth in ihr Fahrwasser. Sie hatte auch so viel zu erzählen, da sie seit gestern Mittag Maria nicht gesehen hatte, denn Fräulein Seidel hatte sich am Abend vorher zeitig zu Bett gelegt und war nicht nur am Nachmittag jenes Tages der Fabrik fern geblieben, sondern auch heute den ganzen Tag über.
„Die Mädchen hatten gestern von nichts Anderem zu sprechen als von Ihnen und der jungen Frau Rother. Es ist wahr! Erst sprachen sie von Ihrem Unwohlsein und meinten, das hätte was zu bedeuten, denn es wäre so plötzlich gekommen, dann wieder nahmen sie die junge Frau vor und erzählten zum Schluss allerhand Geschichten vom jungen Herrn Rother — Alles durcheinander. Diese Klatschschwestern! Denken Sie nur, die lange Tine, Sie wissen doch, die mit den gemeinen Ausdrücken, meinte, es wäre stadtbekannt, dass der junge Herr Rother früher vor seiner Hochzeit ein ganz liederliches Leben geführt hätte — o, und was sie noch Alles sagte, ich kann es nicht sagen. Woher die das nur weiss ...“
„Was sagte sie noch, Jenny? Erzähle Alles.“
Maria Seidel zog der Kleinen Kopf an ihren Schooss und fuhr mit der weichen Hand über das blonde Haar. Dabei beugte sie sich wieder tiefer herab, als befürchtete sie, dass sonst die Worte des jungen Mädchens ihr Ohr nicht erreichen könnten.
„Oh ...“ Jenny Hoff musste es grosse Anstrengungen machen, davon zu sprechen.
Sie schien sich zu schämen, denn sie drehte ihren Kopf so, dass das Gesicht fast ganz in den Falten des Kleides verborgen war. Endlich sagte sie aber doch:
„Wenn ich durchaus soll ... Die lange Tine meinte, das wisse Jeder, dass Herr Rother vor seiner Hochzeit immer ein paar Geliebten zu gleicher Zeit gehabt hätte, die nun durch Geld abgefertigt worden seien. Sie meinte, die reichen Leute machen das immer so. Seine Frau wisse natürlich nichts davon, auch nicht, dass er ein Kindchen habe.“
Maria Seidel presste einen Laut hervor, der sich in dem Halbdunkel des Raumes wie ein geheimnissvoller Seufzer anhörte. Ihre Hand drückte die Wange der kleinen Hoff, als fände sie dort Etwas, das sie zum stummen Ausdruck ihrer Qual bringen könnte. Das wilde Senken und Heben ihrer Brust war in dem noch hellen Lichtraum des Fensters deutlich zu erkennen.
„O, nicht so an meinem Haar ziehen, bitte — das thut weh.“
Jenny Hoff machte eine kurze Pause, folgte dann der Aufforderung Marias und fuhr fort:
„Tine erzählte, ein Mädchen aus der Fabrik, sie soll sehr schön gewesen sein, hätte sich vor zwei Jahren mit ihm eingelassen. Jetzt ginge sie aber sehr fein, denn sie sei Kellnerin geworden. Sie lebe mit ihrer Mutter sehr nobel, und das meist von dem Gelde, das sie für ihr Kind jeden Monat von Rother bekäme ...“
Maria Seidel athmete auf, schwer, wie von einem starken, beklemmenden Druck befreit. Sie also war mit den gemeinen Enthüllungen der frechen Tine nicht gemeint.
Und die Plaudertasche Jenny begann wieder:
„Lina Schmidt heisst das Mädchen. Haben Sie schon von ihr gehört? Tine meint, sie trage jetzt den Kopf sehr hoch und wolle auf der Strasse Niemand mehr von den alten Arbeiterinnen aus der Fabrik kennen.“
Lina Schmidt — ein Kind, das stimmte.
O, Maria kannte das Frauenzimmer wohl. Sie hatte ihr Kind bei derselben Frau Sandkorn in Pflege, wo sie das ihre hatte. Gewiss, das musste ein und dieselbe Person sein. Also auch von ihm! Das hätte eigentlich Veranlassung zu neuen Betrachtungen geben müssen, aber die Tochter des Kohlenschippers schnitt jeden Gedankenfaden durch. Sie wartete erst gar nicht die Antwort auf ihre Frage ab, sondern hatte neue Dinge, allerhand buntes Zeug bereit, wovon sie plauderte: Nichtigkeiten, Zänkereien aus den Arbeitssälen, die sie für wichtig genug hielt, um sie zu erwähnen. Ach, sie konnte noch so unschuldig plaudern, trotz der Gemeinheiten, die ihr Ohr bereits tagtäglich vernahm! Aber sie hörte vorerst nur die Worte, ohne den eigentlichen Sinn zu verstehen. Sie war auch erst sechszehn Jahre, und seit kaum drei Wochen in der Fabrik. Was konnten ihre Kolleginnen da schon verlangen!
Und plötzlich kam sie auch auf eine ihre kleine Person ganz besonders interessirende Angelegenheit zu sprechen, bei deren Erwähnung sie selber staunte, dass sie noch nicht daran gedacht hatte.
„ ... Denken Sie nur, Fräulein Seidel, was mir heute passirt ist. Schon das zweite Mal. Der Lehrling aus dem Comptoir, Sie wissen doch der junge Mensch, der immer so fein gekleidet geht, der Herr Brendel (sie meinte den Volontair und Neffen vom alten Rother) kommt heute Vormittag zu mir heran und erzählt mir wie schon so oft allerlei Geschichten, wie er sich am Abend vorher amüsirt hatte. Ich habe sonst nie darauf gehört, immer kurz geantwortet und ruhig weiter gearbeitet. Heute frug er aber wieder wie schon gestern allen Ernstes, ob ich nicht mit ihm nach irgend einem Theater gehen wolle, er meinte nach dem Germaniatheater oder Americain. Er bat, ich sollte früher aufhören, er hätte schon dafür gesorgt, dass mir das gestattet würde, schnell nach Hause gehen, mich anders anziehen, und dann wolle er mich irgendwo erwarten. Er bat so sehr und that so freundlich ...“
„Kind, dass Du es nie in Deinem Leben wagst! Denke an Deinen alten guten Vater!“
Jenny Hoff fühlte sich im selben Augenblicke zurückgestossen, denn Maria Seidel hatte sich halb von ihrem Platz erhoben. O, was sie da gehört hatte, das war der Anfang der alten verführerischen Melodie einer Grossstadt, die die Sinne betäubt und benebelt. Sie kannte diese Melodie, sie klang ihr ewig im Gedächtniss wieder.
Sie war erregt von dem Gehörten und zugleich erschüttert von der Naivetät der Kleinen, die gross zu ihr aufblickte, wie verständnisslos bei dem plötzlichen Ausruf ihrer Beschützerin. O, sie hätte nichts davon gesagt, wenn sie dadurch die Ruhe Marias gestört sehen sollte.
„Komm her, Jenny. Kind, Du musst auf mich hören.“
Als hätte sie etwas gut zu machen, setzte sich Maria wieder und zog Jenny liebevoll zu sich empor, so dass sie den zarten Oberkörper des Mädchens wie den eines Kindes in den Armen hielt und an sich presste.
„O, Kind, Du weisst nicht, wie gut ich es mit Dir meine. Sie taugen alle nichts, diese Söhne reicher Väter, die arme Mädchen zu bethören suchen. Baue nie auf eines Mannes Wort, wenn er höher steht wie Du. Lerne sie verachten, hassen, verabscheuen, wenn sie sich Dir mit Hintergedanken nahen. O, Du weisst noch nicht, was das heisst, betrogen zu werden, mögest Du es nie erfahren ... Sieh, so fangen sie alle an, wie der junge Brendel: sie suchen die Vergnügungssucht in uns zu erwecken, das sind die ersten verbotenen Früchte, die sie uns Armen bieten, dann kommen Geschenke, Versprechungen, Schwüre von ewiger Treue und Liebe, bis das Herz gebrochen ist und Körper, Seele, Alles, Alles ... O, Jenny, Jenny, wenn ich sprechen könnte, wie ich möchte ...“
„Maria —.“
Es war das erste Mal, dass das junge Mädchen ihre Freundin und Nachbarin kurz mit diesem Namen wie eine Schwester anredete. Sie fühlte sich plötzlich durch die Aufrichtigkeit der Seidel, durch diesen Unterhaltungsstoff, der ihr Geschlecht betraf, dem um zehn Jahre älteren Mädchen näher gerückt wie sonst, es war ihr, als läge sie an der Brust einer treuen, wohlmeinenden Schwester.
Und Maria Seidel hatte dieselbe Empfindung; der eine Ausruf ihres Namens hatte sie in ihr erweckt. Und das machte ihr Herz noch einmal überquellen. Sie wollte diese in der Entfaltung begriffene Mädchenknospe beschützen vor dem gewöhnlichen Schicksal schöner Arbeitertöchter, sie wollte ihr, hingerissen von plötzlich wild auf sie einstürmenden Erinnerungen der Vergangenheit, irgend ein böses Beispiel vor Augen halten, ihr zur Bekräftigung des Gesagten irgend eine alte Geschichte erzählen — ihre eigene jammervolle Geschichte ..
Aber sie kam nicht soweit, denn draussen auf dem Flur ertönte der laute Ruf „Jenny!“ Gleich darauf klopfte es ziemlich derb an der Thür, und ohne erst ein Herein abzuwarten, zeigte sich in der geöffneten Spalte, von einer alten flackernden Lampe mit zerbrochenem Cylinder hell beleuchtet, das geschwärzte Gesicht des Kohlenschippers Hoff.
Er rief einen brummigen, aber freundlichen „ Guten Abend“ und hatte dann eine Bestellung für seine Tochter bereit.
„Nichts für ungut, Mamsell Seidel, wenn ich störe, aber das Mädel soll mir etwas holen. — Jenny, komm, hol’ uns ’ne Flasche Bier und ’nen kleenen Schnaps, Schott ist da.“
Das war genug. Jenny ging betrübt und die Thür klappte wieder.
Maria Seidel sass wieder allein und starrte über das niedriger liegende Dach des Quergebäudes hinweg, hinüber nach dem Häusermeer. Sie stand auf und lehnte sich zum Fenster hinaus. Ueber Berlin führte die Dämmerung den letzten Kampf mit dem Abend. Der Himmel wurde grauer und dunkler und verlor das intensive Blau des Tages. Der grosse Schleier der Nacht senkte sich allmählich herab und legte sich auf die spitzen und platten Dächer der Häuser. Die Höfe öffneten sich, von oben gesehen wie tiefe schwarze Abgründe, an deren Wänden die vereinzelt erleuchteten Fenster der Häuser sich ausnahmen wie winzige, unregelmässig angebrachte Lämpchen. Von den Strassen herüber ertönte das zweite Erwachen der Stadt mit seinem Rüsten zum Vergnügen des Abends, zum Schwelgen bis in die sinkende Nacht, in den grauenden Morgen. Heller erglänzten die scharfen Kanten der Häuser, beleuchtet vom Reflex der angezündeten Laternen. Und immer mehr Lichter zeigten sich in den Höfen, immer mehr erleuchtete Fenster tauchten spukhaft schnell in dem Dunkel auf. Dort noch zeigte sich ein Kopf im Rahmen des Fensters, von dort herüber ertönte das helle Pfeifen des Liedes vom „grünen Strand der Spree.“
Hier, wo man das Gedränge in den Strassen nicht sah, nur der Menschen Wohnstätten vor den Augen hatte, sah Alles so friedlich, einladend nach des Tages Arbeit aus, empfing man den Eindruck einer wohlthuenden Ruhe, ohne Hader, ohne Gedanken an die Misère des Daseins. Das war der Theil Berlins, der ermattet sich nach Schlaf und Träumen sehnte.
Und doch, wenn diese Häuser sprechen könnten, wenn sie erzählen könnten, was Die verschweigen, die in ihnen wohnen! Wenn diese schwarzen, steinernen Ungeheuer ihre Mäuler aufsperren würden, um lärmend und schreiend der Welt zu verkünden, was sie erlebt, gesehen und gehört! Wenn sie plaudern würden vom lächelnden Hunger, vom verborgenen Elend, von der versteckten Gemeinheit und dem unsichtbaren Verbrechen. Wie würden sie brüllen und toben, um der Welt da draussen die Maske vom Gesicht zu reissen, mit der sie sie nie in ihren Mauern gesehen haben. Was für Geschichten würden sie hinausposaunen zum Spott und Gelächter der schadenfrohen Menge, zum Entsetzen und zum Grauen derer, die sich die Gerechten nennen. Was liessen sie übrig, wenn sie dem Babel den Flitterstaat vom Leibe rissen — nichts als ihre eigene steinerne Ruhe und den Dampf und Qualm, der jedes Ideal erstickt — grausam, unerbittlich ...
Wie Maria Seidel so nach den dunklen Häusern, die sie anzuglotzen schienen, hinüberstarrte, vernahm sie im Geiste so eine alte Geschichte, die ewig neu bleibt: ihre eigene. Sie kannte sie ganz genau, sie wollte sie nicht mehr hören, aber sie konnte sich ihrer nicht entziehen — sie umbrauste ihre Ohren und nahm ihr ganzes Denken und Empfinden gefangen. Und eigene Phantasie und Erinnerung halfen dabei und liessen den Weg in die Vergangenheit in Minuten zurücklegen.
O, da war zuerst die glückliche Jugendzeit in dem kleinen Hause in der Potsdamerstrasse, das enge Freundschaftsbündniss zwischen zwei Familien auf einem Flur: zwischen dem schrullenhaften gelehrten Professor Wilmer und dem Doktor Seidel, ihrem Vater. Da war die süsse Vertrautheit mit Louise Wilmer, ihrer Busenfreundin, da waren die rosigen Erinnerungen an die Tanzstunden, Gesellschaftsstunden und Kaffeekränzchen mit ihren kleinen Geheimnissen, Ueberraschungen und Neckereien ältester Gymnasiasten und jüngster Studenten. Das war Poesie im Elternhause, reiner Rosenduft und heller Sonnenschein — nichts von der Atmosphäre, die sie heute athmen musste.
Und da tauchte auch ein hübscher Krauskopf auf, ein stolzer, muthiger Jüngling, ihr einziger Bruder Robert. Wie hatte er sie geliebt, wie war sie ihm zugethan in reiner schwesterlicher Liebe. Er war eine so ideal angelegte Natur, begeistert für alles Hohe und Schöne. Oft übermüthig in seinem Thun, aber doch ein herzensguter Junge. So gut, da der immer wählerische und eigensinnige Backfisch Louise Wilmer sich für ihn begeistern konnte. Wie hatte sie Beide mit dieser Liebe geneckt, sie ausgelacht, wenn sie mit sechszehn und zwanzig Jahren schon vom Heirathen sprachen. Vorüber ein paar Jahre. —
Robert sollte studiren, da starb der Vater. Das war der erste unbarmherzige Schlag. Vermögen war nicht vorhanden. Verdienen um zu leben, war die Parole des Tages. Sie gab Unterricht in Sprachen, soweit es in ihrer Kraft lag, die Mutter nahm Klavierschülerinnen und Robert trat mit guten Empfehlungen in ein grosses Waarenhaus als Lehrling, wo er sofort einen kleinen Gehalt bekam. Er mit seinen Idealen des angehenden Studententhums ein trockener Zahlenmensch!
Man musste sich allerhand Einschränkungen auferlegen, dazu gehörte auch das Aufgeben der zu theuren Wohnung. Das Band der Freundschaft mit Wilmers erlitt den ersten grossen Riss: man kam sich scheinbar aus den Augen. Wieder ein Jahr vorüber. Auch die Mutter todt! Die Geschwister waren jetzt ganz allein auf sich angewiesen. Sie trat in ein Geschäft, um mehr zu verdienen, und besuchte Abends eine kaufmännische Lehranstalt. Dann nahm sie eine Stellung als Kassirerin in einem grossen Laden ein. Und da sah er sie zum ersten Mal, er Hugo Wald, wie er sich nannte, und sie ihn. Er kam und kaufte öfter, als man es wohl bei Jemandem, der nur Interesse für Waaren hatte, erwarten durfte. Ihr musste das auffallen. Dann erwies er ihr Aufmerksamkeiten und näherte sich ihr mit redlichen Absichten. Sie verlor ihr Herz. Er war Kaufmann, Buchhalter in einem grossen Magazin, wie er sagte. Sie forschte nicht darnach — sie war blind, denn sie liebte zum ersten Male. Und nun kam die alte, ach so alte Geschichte. Er versprach ihr die Ehe, kaufte Verlobungsringe, nur um seinen nichtswürdigen Zweck zu erreichen, und dann als sie sich Mutter fühlte, eine Welt der Schande immer drohender vor ihren Augen auftrat, als sie immer mehr in ihn drang, sein Versprechen einzulösen, kam jener Winterabend, der ihr Blut erstarren machte, sie laut um Barmherzigkeit schreien hiess, um der Ehre ihrer Eltern Namen, um des Kindes willen, das sie unterm Herzen trug. Und es hörte sie Niemand, Niemand.
Sie kam aus dem Geschäft nach Hause, früher als sonst. Ihren Bruder traf sie noch nicht an. Da sah sie auf dem Tisch jenen Brief liegen, der ihr die Gemeinheit eines Mannes enthüllte, den sie mit ganzer Seele geliebt hatte, dem sie Alles zum Opfer gebracht. Sie war jämmerlich betrogen.... „Lebe wohl, ich gehe morgen nach England. Ich darf Dich nicht heirathen, denn ich bin nicht Der, für den Du mich hieltst, ich bin der Sohn eines reichen Mannes. Ich gestehe ein, nicht recht an Dir gehandelt zu haben, aber ich war Dir wirklich gut und das Herz verzeiht Manches, was die Vernunft nimmer verzeihen würde. Vergieb auch Du mir. Suche mich zu vergessen. Du bist von heute ab wieder frei. Einliegendes Geld gehört unserem Kinde ...“
Er gab sie frei, nachdem er sie entehrt, betrogen hatte! Er bezahlte ihre Liebe mit einem Almosen! Sie hatte gellend aufgeschrieen und war zusammengesunken. Das war zu viel gewesen für ein schwaches Weib, das vor Minuten noch in den Bildern der Zukunft geschwelgt hatte. Aber sie war stark, sie wollte ihre Schmach allein tragen. Als sie sich vom Teppich wieder erhob, war sie immer noch allein im Zimmer. Ihr Bruder kam erst spät, während sie schon lag. O, sie wusste, er hätte ihren Verführer im Ameisenhaufen der Menschheit gefunden, und hätte er die Welt durchpilgern müssen, aber bei Gott, eher ewiges Vergessen, lebendig begraben sein in einer Höhle der Vorstadt, als unter seinem Blick erröthen müssen. Er hatte seine Lehrzeit beendet, er konnte leben ohne sie. Sie durchwachte die Nacht in fürchterlicher Aufregung, aber ihr Entschluss war gefasst. Sie kündigte ihre Stellung im Geschäft, um jede Spur von sich zu vertilgen, und litt die Tage, Wochen bis zu ihrem Austritt in der Nähe ihres Bruders entsetzlich. Er merkte, dass sie schweres geheimes Leid trage, er sah ihre Blässe, ihren inneren Gram, und er forschte, frug, bat, sie aber lächelte und hatte nur ein Wort bereit, und das hiess „Nichts“. Dann kam der Tag, wo sie heimlich von ihm ging und ihm jenes Schreiben hinterliess, in dem sie auf vier Seiten herzzerreissend ihm ihre Schuld gestand und ihn bat, sie nicht mehr als seine Schwester zu betrachten.
Zweieinhalb Jahre lagen jetzt dazwischen, und während dieser Zeit wohnte sie draussen im Arbeiterviertel, am äussersten Ende der Louisenstadt, war sie todt für die Vergangenheit, für die einstige glänzende Welt ihrer Jugend, lebte sie nur noch für sich, ihren Knaben und ihre Rache. Wie hatte sie geforscht nach ihrem Verführer, ihn zu zwingen, ihr die genommene Ehre wieder zu geben, ihrem Kinde seinen Namen zu geben, für dasselbe zu sorgen — vergebens Alles vergebens. Sie sah ihn nie mehr, sie hörte nie mehr seinen Namen. In dieser Millionenstadt auch, wo jeder neue Tag die Spuren des alten verwischt! Aber einstmals musste die Stunde kommen, wo sie ihn sah, denn es lebte ein Gott zu strafen und zu rächen, und dann zehnmal Wehe ihm, der sie in die Reihen jener Betrogenen gestellt hatte, auf die die lästernde Welt mit Fingern zeigt um ihrer Kinder willen, die keinen Vater haben. Wer geliebt hat, der kann auch hassen!
O, dieses armen Kindes wegen, was hatte sie Alles von den Lästerzungen ertragen müssen, wie hatte man ihr das Leben, den Kampf um die Existenz schwer gemacht. Um seinetwillen aus den Reihen der Gesitteten gestossen, hatte sie sich Verachtung, Gemeinheiten und Zudringlichkeiten gefallen lassen müssen; seinetwillen war sie für die sogenannte Gesellschaft gestorben, seinetwillen zur Arbeiterin in einer Fabrik geworden, um in Ruhe und Frieden in der grossen Gemeinde der Armen ihr täglich Brod essen zu können. Hier war sie nur noch eine Null, wie die Andern alle, hier nahm man sie auf als ebenbürtig, denn zu dieser Gemeinde der Enterbten gehörte auch die Gemeinde der Verführten ...
Die zahllosen steinernen Ungeheuer da drüben hätten der Teppichstopferin viele solcher Geschichten erzählen können, wenn sie gesprochen hätten, aber sie glotzten noch immer schweigsam herüber und streckten ihre Häupter unbeweglich in die Nacht.
Maria Seidel fasste sich nach der heissen Stirn und starrte hinunter nach dem schwarzen Hof. Von unten herauf aus einem geöffneten Fenster klang das Lallen eines Kindes, das hell und deutlich „Papa“ stammelte.
Maria zuckte zusammen und holte tief Athem. Sie erhob ihren Blick, und ihre Augen schweiften nach rechts, als könnten sie das Dach durchdringen, hinüber nach jener Strasse, nach jenem Hinterhause zu jener Pflegefrau, wo die Wiege ihres Kleinen neben denen anderer stand. O, es schlummerte gewiss schon süss, die grossen Augen beschattet von den Augenwimpern. Wie wild wäre sie aufgefahren, wie hätte sie die Gerechtigkeit um Hilfe angerufen, hätte sie die Schläge gehört, die Frau Sandkorn ihrem Pflegebefohlenen austheilte, hätte sie den Theelöffel voll Branntwein gesehen, den das Weib dem Kleinen einflösste — denn so macht man die Hilflosen müde, bringt sie in Schlaf, so macht man Kinder zu Engeln ...
Aber Maria faltete im Dunkeln die Hände, beseligt von dem Gefühl der Ruhe, die um sie herrschte — der Ruhe, die auch ihrem Kinde zu Theil wurde neben — dem Kinde der Lina Schmidt, dem Kinde Rothers ...
Die schwarzen Ungeheuer da drüben hörten plötzlich ein helles Stöhnen, das wie ein Gemisch von geäussertem Schmerz und halbersticktem Jubel klang. Dann sahen sie das leuchtende Gesicht mit dem dunklen Haar verschwinden. Maria Seidel war wieder auf ihren Stuhl gesunken.
Sie weinte nicht, sie jubelte nicht laut, aber in ihrem Innern schrie es auf vor wilder Freude, da sammelten sich Gefühle, die ihren ganzen Körper erschütterten, ihr Blut in Gährung brachten.
Sie hatte ihn gefunden, seit gestern ihn gefunden als ehrlichen Gatten einer Andern — ihrer einstigen besten Jugendfreundin. Dieser furchtbare Zufall einer wachenden Vergeltung, der unbarmherzig Menschen zusammengeführt, wie lose Blätter von einem Baum, die der Sturmwind wieder zusammentreibt. Der Gedanke daran hatte sie seit gestern krank gemacht, hatte gedroht, ihr den Verstand zu rauben. Er hatte sie ruhelos wie eine Halbverrückte den ganzen Tag über abwechselnd weinen und lachen gemacht, er hatte sie seit gestern das Zimmer zum Gefängniss werden lassen, und er hatte auch ihr Hirn zermartert, um eine Antwort auf die Frage einer ewigen Weltordnung zu finden, weshalb Louise Wilmer, das reine Weib, es gerade sein musste, das die Gattin ihres Verführers Hugo Wald, jetzt Edmund Rother wurde.
Was sollte sie jetzt thun? Wo war die ewige Richterin, die jetzt die Waage hielt?
„O, Gott, allmächtiger Gott!“
Sie tappte im Dunklen nach ihrem Lager, vergrub das Gesicht in die Kissen und weinte sich satt, so recht von Herzen satt ...
Drüben auf der andern Seite des winkeligen Flures im einzigen Raume der Hoffschen Wohnung, der zu gleicher Zeit als Wohn-, Schlaf- und Kochzimmer diente, sassen am wackeligen Tisch in der Nähe des eisernen Ofens, der die Küche vorstellte, der alte Kohlenschipper und der Maschinenschlosser Schott, die sich von der Gasanstalt her kannten, in der auch Schott kurze Zeit beschäftigt gewesen war. Seit langer Zeit hatten sich die Beiden nicht gesehen, in den letzten Wochen jedoch suchte Schott den Alten fast täglich in seiner Klause auf.
Anfangs hatte der Kohlenschipper, dem das auffallend war, gedacht: „Der kommt der Jenny wegen“, und er hatte im Geheimen geschmunzelt und so seine Betrachtungen angestellt. „Hm,“ sagte er sich gleich am zweiten Abend, als er auf diesen Gedanken kam, „so schlecht wäre das nicht. Der Junge hat zwar seine Mucken und ein Krakehler soll er auch sein, aber tüchtig ist er und verdient sein Geld. Obendrein ein stattlicher Kerl, dem die Frauenzimmer von jeher nachliefen. Das Mädel ist zwar noch jung, ein halbes Kind, aber mit dem Fabrikarbeiten kann’s doch nicht ewig gehen, und jung gefreit hat noch niemals gereut.“
Der Alte kam aber bald auf andere Spuren. Da hatte der Schott so merkwürdige Dinge zu fragen, die sich alle um Fräulein Seidel drehten. Ob das richtig wäre mit dem Kinde ... Ob der Vater noch lebe und ob der Alte wisse, wer er sei ... Wie sie sich zu Hause aufführe und wie wohl die Geschichte eigentlich zusammenhänge, dass so ein Mädchen, die englisch und französisch spräche, in einer Fabrik gegen gewöhnlichen Wochenlohn arbeiten müsse.
Und alles das frug er mit so einer Wichtigkeit, als sei er von der Kriminalpolizei und müsse schlauer Weise recherchiren. Dabei liess er die Jenny ganz links liegen und bekümmerte sich nur um sie, wenn er glaubte, etwas von der Plaudertasche erfahren zu können. Aber da kam er bei der Kleinen schön an! Die von ihrer Nachbarin etwas Schlechtes sagen!
Das kam verdächtig vor. Dem Kohlenschipper ging dann ein Licht auf, als der Schlosser seltsame Sachen durchleuchten liess. Die Seidel hätte es ihm angethan. Er hätte sie vor Augen, wo er gehe und stehe, und selbst Nachts träume er von ihr. Er wisse nicht warum, aber es sei doch so.
Mit der Jenny war’s also nichts. Das war dem Alten nun eine ausgemachte Sache. Er hätte eigentlich über diese Fopperei wüthend werden können, aber er durfte nichts davon laut werden lassen. Die Kleine selbst hätte ihn am Ende ausgelacht. Dann aber fand er das ganze Gebahren Schotts äusserst schnurrig.
Der in die gebildete Mamsell Seidel verliebt? Der mit seiner derben Hand und seinem groben Wesen? Als ob die für einen Schlosser geschaffen war, der tagtäglich mit hartem Eisen umging!
Der biedere Christian Hoff fand diese Idee zu närrisch. Er hatte auch eine zu grosse Achtung vor dieser armen, schönen, immer so ruhigen und doch so freundlichen Mamsell Seidel, die still Morgens zur Arbeit ging und des Abends immer so lautlos ihr kleines Kämmerlein aufschloss; die so fein und vornehm sprach, Handschuhe und Schleier trug und doch im Hinterhause einer Arbeiterkaserne wohnte; die so viel gelernt hatte, dass sie etwas davon noch immer für seine Jenny übrig hatte — seine liebe einzige Kleine, die so aufwuchs ohne Mutter ...
Wenn er daran dachte, musste er sich immer mit dem schmutzigen Aermel über die Augen fahren, als hätte er dort den Ueberrest von Kohlenstaub wegzuwischen, und es war doch etwas Anderes, ganz etwas Anderes, Nasses —.
Sie war ordentlich rührend diese Hochachtung, die der alte Kohlenschipper vor der Seidel hatte — jene wahrhaftige Hochachtung, die der Arme Unwissende immer Menschen bezeigt, die mehr gelernt haben wie er, und doch sich nicht so hoch und stolz dünken, um ihm nicht etwas von diesem Wissen abzugeben.
„Schott, Du bist des Teufels, bilde Dir nichts ein“ — hatte er oft auf den Lippen, um dem hitzigen Krauskopf seine Meinung zu sagen. Da sah er aber in sein Gesicht, in dieses beim Sprechen von heisser Leidenschaft durchwühlte Gesicht, da sah er in seine Augen, in diese brennenden, unheimlich flackernden Augen, deren schimmernde Schwärze ihn an die Kohlenstücke der Gasanstalt erinnerten, und er schwieg.
„Der schlägt dich todt, wenn du ein Wort dagegen sprichst,“ dachte er im selben Augenblick und verschluckte die Worte auf halbem Wege. Er liess ihn reden und schwatzen und rauchte lieber aus seiner kurzen Porzellanpfeife, ehe er ihn unterbrach.
Heute war es wieder so. Da sass er wieder auf der andern Seite des Tisches neben dem jetzt kalten, gekitteten und verschmierten eisernen Ofen und starrte nach seiner alten Manier in das matte Licht der einzigen Familienlampe mit dem abgebrochenen Cylinder und der gesprungenen Glocke. Der Dampf seiner Cigarre vereinigte sich mit dem von Hoffs Pfeife und umzog die Lampe mit hellen Wolken, lagerte sich erst schichtweise im Raum der Stube und zog dann dem geöffneten Fenster zu.
„Magst Du sagen, was Du willst, Hoff, sie hat mirs angethan. Nenne mich einen Verrückten, sage, ich sei der grösste Narr auf der Welt, aber ich kann nicht anders, ich muss sagen, ich kann nicht mehr leben, wenn ich nicht weiss, dass sie mein Weib wird. Sie hat so was Apartes — ich weiss, sie passt nicht zu uns da in der Fabrik, aber siehst Du, das ist es gerade, was mich so reizt. Und lass sie wirklich ein Kind haben, ein uneheliches, wie sie Alle sagen, was kümmert’s mich. Ich will sie nehmen, wie sie ist. Wenn sie klug ist, wird sie sich die Sache überlegen und nicht nein sagen, wenn sie auch schon andere Manieren hat wie ich. Aber sie steht allein und immer wird’s doch nicht so mit ihr gehen können — sie wird älter und älter werden ... Du musst mit ihr reden, vernünftig reden, ’s geht nicht anders. Ich weiss nicht, wie ich’s anfangen soll. Wenn sie mich auslachen würde, Du weisst, Du kennst mich — ich wüsste nicht, was ich thäte vor Wuth, ich erwürgte sie auf der Stelle, mag dann werden aus mir was will ... Nimmt überhaupt gleich Jeder so ein Mädchen, die schon ein Kind hat von einem Andern? Zuletzt thut’s doch immer nur ein Arbeiter. Dazu seien wir gut genug, denken die Herren Ehrabschneider — aber’s wird doch noch mal anders werden in der Welt, wenn wir am Ruder sind und dieses Bourgeoisgesindel, diese aristokratischen Kanaillen —.“
„Kalt Blut, kalt Blut, Schott, reg’ Dich nicht auf, komm nicht in Dein altes Fahrwasser, ’s lohnt sich nicht der Mühe. Wir werden’s nicht mehr erleben. Lass ’s gut sein. Wir wollen dabei bleiben, wo wir waren. Ich sehe schon, Dir ist die Sache verteufelt ernst mit dem Fräulein, aber Schott, Schott, Du weisst nicht, ob sie noch frei ist, ob sie nicht schon einen Bräutigam hat, einen, der zu ihr passt.“
Dem alten Christian Hoff war das so herausgeplatzt, er wusste nicht wie. Er wollte den Menschen da vor ihm auf andere Gedanken bringen.
Aber hätte er nur lieber geschwiegen, denn seine Worte waren Oel ins Feuer.
Der alte Tisch bekam plötzlich einen Ruck, dass die Lampe wackelte, denn der junge Arbeiter hatte durch eine kräftige Bewegung seine alte Lage an der Wand verändert.
Er streckte den linken Arm aus und liess die Hand schwer auf des Kohlenschippers Schulter nieder, dass dieser in seiner gekrümmten Haltung sich nach unten bewegen musste.
Der ganze schauerliche Ernst einer unbezähmbaren Leidenschaft lag in seiner Stimme, als er sagte:
„Hoff, ich sage Dir, zieh mich nicht auf, bei unserer alten Bekanntschaft, zieh mich nicht auf! Wenn das wahr wäre, was Du da gesagt hast, wenn sie wirklich schon einen Andern hätte, ich sage Dir, ich könnte ’s nicht ertragen, wenn ich wüsste, wer’s ist, wenn ich sähe, dass er mehr voraus hätte bei ihr, wie ich, ich schlüge ihn nieder wie einen Hund, so wahr Gott lebt! Ich sage Dir —.“ Der ganze Körper des jungen Arbeiters zitterte. Es war, als durchrieselte sein warmes Blut plötzlich ein kalter Strom, der jede Fiber in ihm in Aufregung bringe.
Und etwas von dieser Aufregung ging wie durch einen elektrischen Strom auch auf Christian Hoff über. Er wusste, dass dieser Mensch mit der drohenden Haltung, die immer den Eindruck machte, als wollte er gleich dreinschlagen, mit den farblosen Lippen und dem scharfmarkirten, tief eingegrabenen Zug um sie, seine Worte bewahrheiten würde und ginge er selbst dabei zu Grunde.
Aber Gott sei Dank, es war noch nicht so weit, der Alte hatte da etwas in den blauen Dunst gesprochen, ohne Sinn, nur um den Schott auf andere Wege zu bringen.
Es war ihm jetzt selbst eine Genugtuung, seinem jungen Freunde den erweckten Verdacht zu nehmen, in seiner Brust die wild auflodernde Flamme der Eifersucht zu ersticken.
„Nicht gleich so wild, nicht gleich so wild, Schott. Ich wollte Dich nur auf die Probe stellen. Wenn man so was sagt, da merkt man gleich am besten, wie weit die Liebe geht. Das ist, als wenn man Wasser auf heisses Eisen giesst, um zu sehen, ob es noch zischt. Du kannst ruhig sein. Die Mamsell Seidel wohnt nun schon ein ganzes Jahr hier, aber sie kennt keine Mannsperson, es kommt auch keine zu ihr. Sie hat zwar eine Menge Freunde —.“
„Aha!“
Schott lachte laut auf — grell und höhnisch, und der Tisch bekam diesmal von seiner Hand einen Stoss, dass er von seinem Platz rutschte und die Lampe durch die Erschütterung laut klirren machte.
Der Kohlenschipper blickte ihn diesmal gross an.
„Aber so lass mich doch ausreden. Du bist ja rein toll.“
Und in aller Ruhe fuhr er fort:
„Sie hat zwar eine Menge Freunde, aber das sind ihre Bücher, nur ihre Bücher. Mit denen unterhält sie sich des Abends, wenn sie aus der Fabrik kommt, und auch am Sonntag, den ganzen lieben Sonntag. Sie hat eine ganze Portion davon, verschiedene Dutzend werden’s wohl sein, und sauber eingebunden, sage ich Dir. Frag’ nur die Jenny, die kann’s Dir ganz genau sagen. Das Mädel wohnt ja mehr bei ihr, wie bei mir.“
Mit dem jungen Arbeiter ging eine seltsame Veränderung vor. Sein Jähzorn war so schnell verschwunden, wie er aufgebraust war. Sein Gesicht nahm einen merkwürdig ruhigen, fast weichen Ausdruck an, als stimmte ihn das soeben Gehörte zur Rührung, zur tiefen Rührung. Es klang fast kleinlaut, als er sagte:
„Den ganzen lieben langen Sonntag, sagst Du, und immer nur bei den Büchern? Du lieber Himmel, was hat sie denn da vom Leben? Hat sie denn keinen Verwandten, keinen Vater, keine Mutter, nicht einmal ’nen Bruder oder ’ne Schwester?“
„Nichts, nichts, Schott. Sie steht mutterseelenallein. Aber ’n Kind hat sie wirklich, ich kann’s Dir sagen. Sie hat’s in Pflege gegeben, der Lästerzungen wegen, und ’s würde ihr auch hinderlich beim Verdienen sein, wenn sie’s zu Hause hätte. Und siehst Du, das kostet jeden Monat Geld. Für ihr Kind muss sie sparen, Alles opfern, was sie übrig hat. Jenny sagt, sie hätte es so lieb und es soll auch so ein hübscher Bengel sein. Die Kleine hat ihn schon gesehen. Aber wer der Vater davon ist, das kann ich Dir wirklich nicht sagen, denn davon spricht sie nie, das weiss selbst die Jenny nicht.“
Schott sprang auf und durchschritt laut die Stube. Es ging ihm so viel, so viel im Kopf herum, er hätte jetzt so viel zu sagen gehabt, wenn ihn nur der Alte verstanden hätte! Dieses arme Mädchen! Wie die Frauenzimmer in der Fabrik über sie herzogen, dieses Kindes wegen, für das sie arbeitete von früh bis spät! Als ob die meisten dieser geheimen Dirnen nicht auch schon Mutter gewesen waren, die eine mehr, die andere weniger! Als ob nicht viele schon einen Platz im Zuchthaus wegen Kindesmordes verdient hätten, wären die gewissen Weiber nicht ... Man musste das nur kennen, im Dampf und Qualm der Fabriken und Vorstädte gross geworden sein, wie Paul Schott. Freilich die Seidel war ihnen zu vornehm, zu stolz, zu anständig, trotzdem auch sie die Mutter eines Kindes war, das — lebte!
Aber er wollte diesen gemeinen Zungen bei der nächsten Gelegenheit die Lust zum Lästern nehmen — mit der Faust, gleichviel war es ein Mann oder ein Weib!
Alles das durchwogte seine Brust in wenigen Minuten.
Dann blieb er wieder stehen, dicht vor dem alten Hoff.
Das Gefühl, der Maria Seidel in ihrer Lage ein Beschützer sein zu dürfen, durch seinen Namen alle Schmach von ihr abwälzen zu können, die Hoffnung, durch dieses Opfer bei ihr Erhörung zu finden, gab ihm mehr Muth, denn sie stählte seine Gedanken an die Zukunft.
Und all das drückte sich jetzt in seinen Worten zu dem Kohlenschipper aus.
„Hoff, ich weiss, Du bist ein guter Kerl, ich hab’s oft bewiesen gesehen. Du bist ein alter Bekannter von mir. Thue etwas für mich. Sag’ ihr, wie ich’s meine, dass ich arbeiten will für sie von früh bis spät. Sie soll die Hände in den Schooss legen und nichts machen, als was in der Wirtschaft nöthig ist. Sag’ ihr auch, ich will ihr Kindchen lieb haben, als wär’s von meinem eigenen Blut. Sag ihr, dass ich zwar ein wilder Bursche bin, aber dass ich mich ändern werde, wahrhaftig, ich werde ein Anderer werden. Ich will ihr ein Mann sein, wie’s keinen zweiten giebt, sag’ ihr das Alles ... Nicht wahr, Hoff, ich bin doch kein schlechter Kerl.“
Er nahm die knöcherne Hand des Alten und drückte sie mit seinen beiden warm und aufrichtig.
„Hoff, Du wirst es thun? Habe Mitleid —.“
„Aber Schott, Du kannst auch weinen, lieber Junge — was ist Dir?“
Der Alte rückte auf seinem Stuhl, riss die Augen auf und nahm die Pfeife aus dem Munde, als wollte er besser sehen.
„Schott, sei ein Mann — Du packst an mein Herz, sei ruhig, vernünftig. Ich will’s für Dich thun, als wärst Du mein Sohn. Komm, lass Dich nieder. Du sollst ein schlechter Kerl sein? Ich sollt das glauben, ich, so ein alter Mann, der sich unter Menschen bewegt hat? Das wäre!“
Der junge Arbeiter setzte sich, die beiden Hände vor das Gesicht geschlagen. Kein Laut kam über seine Lippen, aber die Brust arbeitete mächtig.
Der alte Hoff wollte von anderen Dingen reden.
„Wo nur die Kleine bleibt mit dem Bier und dem Schnaps.“
Er trat ans Fenster und blickte in den Hof hinunter.
Es war ihm, als hörte er unten auf dem Flur die Stimme seiner Tochter. Die Plaudertasche hatte gewiss wieder mit irgend einer Nachbarin zu erzählen. Gut auch, dass sie nicht gleich kam. Um des Schott willen. Was der für ein Mensch war!
Der Alte blies den Rauch in das Dunkel hinaus und spann Gedanken. —
Unten wollte Jenny gerade mit dem beschwerten Korb den langen finstern Flur durcheilen, als ein Herr hinter ihr herkam und sie dreist aufhielt, dass sie erschrocken aufschrie. In der Helle, die von der Strasse herein fiel, erkannte sie den feingekleideten bartlosen Herrn Leo Brendel, Volontair der Firma Rother und Sohn.
Er fasste sie ungenirt um die Taille und drückte sie an sich.
„Nun, Fräulein, Sie sind ja nicht gekommen. Mich so warten zu lassen! Und ich hatte Ihnen eine so hübsche Busenschleife gekauft.“
Jenny Hoff war noch erfüllt von der Warnung Marias. „Lerne sie verachten, hassen, verabscheuen, wenn sie sich Dir mit Hintergedanken nahen.“
Wie kam Der dazu, ihr eine Schleife zu kaufen?
Die kleine Hoff war allen Ernstes nahe daran, gegen ihren Vorgesetzten recht böse zu werden, ihm irgend eine höfliche Grobheit zu sagen, wie sie Berliner Kindern so wohlfeil sind, aber sie brachte es nicht über die Lippen. Er war trotz seiner Zudringlichkeit so höflich und sagte zu ihr jungem Ding „Fräulein“! Das war man in der Fabrik nicht gewöhnt. Etwas Gefährliches hatte er ja ihr noch nicht gesagt. O, sie wusste nicht, dass man Schmeicheleien stets vorräthig hat, wenn man, wie Herr Leo Brendel, gewisse Zwecke verfolgt.
„Wie nett Sie aussehen in dem hellen Kleid. Weshalb gehen Sie nicht immer so gekleidet?“
„In der Fabrik vielleicht? Da würde ich schön bei meinem Vater ankommen. Man kann sich nicht immer neue Kleider kaufen. Aber, bitte, Herr Brendel, lassen Sie mich los, ich muss gehen.“
„Erst müssen Sie mir sagen, weshalb Sie zu unserm Rendezvous nicht gekommen sind.“
Das Wort Rendezvous, wie es sich vornehm anhörte!
„Weil es sich nicht schickt. Mein Vater wäre mir auch schön auf den Kopf gekommen. Aber bitte jetzt —.“
Es klang wenig ernst, was sie sagte. Ein Mann merkt das sofort, wie Leo Brendel es auch merkte. Diese Kleine musste man sich erst erziehen.
„Aber so ein unschuldiges Vergnügen, ein Theaterbesuch.“
„Wenn auch — aber es schickt sich nicht.“
„Sie können ja das nächste Mal eine Ausrede machen — Sie hätten irgend einen Gang, eine Freundin zu besuchen. Am Montag, nicht wahr, Sie kommen mit? Ich sage Ihnen, Sie werden sich köstlich amüsiren. Ich bringe Sie auch zeitig wieder nach Hause. Sie sind so jung und so hübsch, Fräulein Jenny — Sie müssen mehr in Gesellschaft. Was haben Sie sonst vom Leben?“
O, das war wahr, sehr wahr, was er eben gesagt hatte. Sie hatte wirklich wenig vom Leben. Morgens um fünf Uhr aufstehen, um dem Vater Kaffee zu besorgen, wenn er nicht gerade Nachtarbeit hatte, dann dreiviertel Stunden laufen, um Schlag Sieben in der Fabrik zu sein, elf Stunden tägliche Arbeit bei erbärmlich karger Kost und dann wieder nach Hause in die dumpfe, halb verbaute, dunkle Stube ... Und das einen Tag um den andern! Freilich, da war zwar die Gesellschaft des guten Fräulein Seidel, so mancher Spaziergang mit ihr, aber, aber was war das auch — wenig, wie das Salz auf dem Brod! Und die andern Mädchen sprachen doch jeden Montag so viel vom Vergnügen. Vom Tanzen in der Hasenhaide, vom Umherjagen im Treptower Park und vom Amusement im Schweizergarten, in Puhlmanns Vaudeville-Theater und im Volksgarten auf dem Gesundbrunnen. Und sie war wirklich schon sechszehn Jahre, musste ihr Brod verdienen, und hübsch musste sie auch sein, das hörte sie jeden Abend beim Kaufmann drüben an der Ecke.
Aber nein, mit diesem jungen Herrn Brendel durfte sie nicht ausgehen — ihr Vater hätte sie todtgeschlagen, wenn er’s erfahren hätte. Und dann die gute Maria —.
„Traue nie auf eines Mannes Wort, wenn er höher steht wie Du,“ hatte sie gesagt.
Das unverdorbene Gemüth der Kleinen sträubte sich doch gegen die Zumuthung des jungen Herrn. Als sie jetzt merkte, dass er sie an die Wand drücken wollte und seine Hand ihrer Büste nahe brachte, riss sie sich mit Anstrengung los.
„Lassen Sie mich zufrieden, ich will nichts mit Ihnen zu thun haben, oder ich schreie laut auf!“
„Aber so nehmen Sie wenigstens die schöne Schleife. Was soll ich mit dem Ding!“
„Nein. Da kommt Jemand —.“
Man hörte Tritte auf dem Hof.
„Aber einen Kuss —.“
Sie wollte wieder etwas sagen, aber der Volontair hatte ihren Mund durch seine Lippen bereits verschlossen.
„Die Schleife müssen Sie doch nehmen.“
Er warf ein Päckchen in ihren Korb und ging lachend nach der Strasse, indem er sich noch ein paarmal umblickte. Jenny eilte erhitzt und mit gerötheten Wangen dem Hofe zu. Sie hätte weinen mögen über diese Frechheit. Aber sie fand nicht die Kraft, die eingewickelte Schleife von sich zu werfen. Sie nahm das Päckchen aus dem Korb und verbarg es in ihrer Kleidertasche, des Vaters wegen!