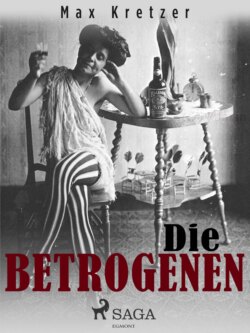Читать книгу Die Betrogenen - Max Kretzer - Страница 9
Viertes Kapitel.
ОглавлениеWeibliche Bedienung.
Brendel befand sich wieder auf der Strasse. Es war die Manteuffelstrasse, jener Theil derselben, der zwischen der Oranien- und Muskauerstrasse liegt. Ein paar Augenblicke blieb er unschlüssig stehen, um zu überlegen, nach welcher Seite er seine Schritte lenken solle. Er wollte den Abend irgendwo in einer Kneipe todtzuschlagen suchen, er wusste nur nicht wo. Es waren ihm so viele bekannt, in denen die Mamsells ihn angenehm fanden, seine guten Trinkgelder zu schätzen wussten, ihm hin und wieder wohl auch kleine Konzessionen gestatteten. Er war stets so freigebig, der „gute Leo“, wie man ihn der Kürze wegen nannte. Er ging immer tadellos gekleidet, trug blendendweisse Wäsche, wechselte alle acht Tage mit seiner Kravatte und versäumte nie die grösste Sorgfalt auf sein in der Mitte gescheiteltes, glänzend pomadisirtes Haar zu verwenden, um dadurch in den Augen Anderer — wenn auch nur par distance — sich seiner kaufmännischen Stellung auf Stunden entrückt zu sehen. Man musste nur sehen, mit welcher vornehmen Miene er nach Eintritt in eine jener Kneipen, in denen der Student und Offizier in Civil der hauptsächlichste Stammgast ist, zwei Haarbürsten links und rechts aus den Taschen seines Jaquets zog und mit der Technik eines Friseurs das Haar gleichzeitig zu beiden Seiten des Scheitels zu bearbeiten anfing — von der Stirn bis zum Genick. Er wollte nun einmal nicht für einen Kaufmann gelten, wenigstens in diesen Kneipen nicht, wo der burschikose Ton vorherrschte und das gegenseitige Zutrinken der Studenten den Comment verrieth.
Von der Oranienstrasse her ertönte das Klingeln der Pferdebahnwagen. Das liess einen Entschluss in ihm reifen.
Er schritt rechts herunter, jener Seite zu. Dabei musste er fortwährend an die kleine Hoff denken. Diese spröde Schlange — wie entrüstet sie war. Sie wollte sogar schreien, aber sie that es nicht, selbst beim Küssen nicht. Das waren Chancen genug, er konnte zufrieden sein für heute. Die zweite Einladung würde sie gewiss annehmen. Dafür war sie sechszehn Jahre, das war das gefährlichste Alter bei frühzeitig stark entwickelten Mädchen ...
Brendel pfiff unhörbar vor sich hin und schlenderte langsam weiter. Die Uhr ging erst auf Zehn. Die Strassen waren stark belebt, denn es war am Sonnabend, also am Lohntag. Es war der Abend, an dem in gewissen Theilen der Stadt der Sonntag als Ruhetag durch eine durchschwelgte Nacht eingeleitet wurde. An einem solchen Abend nimmt Berlin eine andere Physiognomie an. Alles lacht heller, Aller Gesichter sehen freudiger, unternehmender aus. Jeder Einzelne, der abhängig vom Verdienen ist, hat das Gefühl, einmal auf ganze achtundvierzig Stunden sein eigener Herr sein zu können. Das macht ihn kecker, übermüthiger, lässt ihn freier als sonst athmen und fordert den Leichtsinn heraus. Es ist fast, als wolle an einem solchen Abend Jeder sich dem lieben Gott für Schaffung des siebenten Tages dadurch recht dankbar erweisen, dass er hingeht und ihm die halbe Nacht und bis zum sinkenden Morgen Opfer in klingender Münze bringt. Die unverheiratheten Arbeiter zumal wollen sich entschädigen für sechs lange arbeitsame Tage. Sie tragen heute den Kopf so hoch, als wollten sie jeden Augenblick auf die gefüllte Tasche schlagen und in die Worte ausbrechen: „Heute machen wir uns eine vergnügte Nacht.“ Und wenn sie am dritten Tage der kommenden Woche wieder den Kredit des Budikers und Speisewirthes in Anspruch nehmen müssen, um ihr Leben zu fristen, was kümmert’s Andere! Heute wollen sie auch einmal geniessen, die Thaler springen lassen, um von dem berauschenden Gifthauch Berlins etwas zu kosten. Heute wollen auch sie einmal mit der Genugthuung nach Hause gehen, nach langer Kneipenfahrt zum Schluss die letzte Nachtstation in irgend einem Wiener-Café gemacht zu haben, in dem man nicht weiss, was gemeiner ist: die aufgeputzten Freudenmädchen, die Frechheit des Wirthes, für ein Cichoriensurrogat den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, oder das ekelhaft-weibische Aussehen der trocknen Kellnergestalten, auf deren jede François Coppées Strophen passen:
„— — — — Gleich einer Dirne
Trug er das Haar in Ringeln an der Stirne.“
In den Vorstädten sieht man jene Unglücklichen taumeln, die für die Bitternisse des Lebens und Enttäuschungen in der Ehe Trost im Alkohol suchen und auf Stunden auch finden. Die Destillation ist heute ihr Paradies und das gefüllte Schnapsglas der Genuss, in dem sie schwelgen, stieren Blickes träumen und im Anfange des Deliriums phantasiren — seltsame, unverständliche Dinge ...
Da wankt jetzt so eine vom schleichenden Gift schon halbzerstörte Gestalt. Das Arbeitsgewand umschlottert die mageren Glieder, als wolle es jeden Augenblick seinen Halt verlieren. Der Mann redet wirres Zeug und schimpft in gurgelnder Tonart — zum Gaudium der ihn umringenden halbwüchsigen Burschen. An seiner Seite geht eine abgezehrte, armselig gekleidete Frauengestalt — sein armes beklagenswerthes Weib. Sie hat eine ganze Stunde vor dem Fabrikthor geharrt, um ihn in Empfang zu nehmen, sie ist ihm aus einer Schankwirthschaft in die andere gefolgt, sie hat ihn ein Dutzendmal in die Tasche greifen sehen, um das sauer verdiente Geld für Spirituosen auszugeben, sie hat ihn sich berauschen sehen, endlich lallen und stammeln gehört, aber sie ist nicht von seiner Seite gewichen — der wenigen Groschen wegen, die er nach Hause bringen soll. Denn sie weiss, dass er nicht eher zu bewegen ist, sein Heim aufzusuchen, bis er sinnlos betrunken ist, bis man ihn führen muss. Und zu Hause warten die hungernden Kinder und schreien nach Brod, die armen, armen Kinder ...
Im Schatten der Hausthore stehen verlebte, abgeblühte lichtscheue Weiber, deren Gewerbe den Unterschied zwischen Frau und Mädchen vollständig verwischt hat. Sie blicken so frech und machen so einladende Bewegungen, wenn ein Arbeiter vorübergeht, — sie wissen, heute ist Lohntag, heute sind die Portemonnaies gefüllt, heute giebt es zu verdienen.
Da schallen laute Klänge eines verstimmten Klaviers zum tiefeingebauten Kellerfenster heraus. Unten herrscht betäubender Lärm, der durch das plötzliche gemeine Kreischen einer der Mamsells letzten Ranges seine Signatur bekommt. Sie setzen sich so dreist und schamlos auf den Schooss der Männer und animiren zum Trinken des „echten“ Bieres, das nur echt ist, soweit es sich um die Etiquette der Flasche handelt; sie verstehen es so vortrefflich durch Sich-drücken-lassen und durch Gestatten anderer Freiheiten den Arbeitern die Taschen leichter zu machen, dass der Wirth bei dem Gedanken, wieder einmal das Geschäft für die ganze Woche zu machen, schmunzelt und ein Auge zudrückt.
Diese Dummen, die nie alle werden wollen!
Und dieser Lärm des Sich-gehen-lassens, diese Sucht nach Genuss und Betäubung, die in den Kneipen bereits feste Formen angenommen hat, zeigt sich auf den Strassen erst in ihrer Gährung. Das ist ein Ueberhasten, ein Ausweichen und Stossen, ein Zur-Schau-tragen einer gewissen Ruhelosigkeit, als könne man nicht die Zeit erwarten, bis man am Zechtisch sitzt, um mitzuarbeiten an der — Verrottung der Gesellschaft.
Brendel befand sich inmitten dieses Beobachtungsmaterials für den Sittenschilderer, ohne dass es für ihn Interesse gehabt hätte. Er war wie die meisten jungen Männer seines Schlages nur empfänglich für Genuss. Er hatte sich bald hier, bald da nach einem Mädchen umzusehen und machte darin zwischen öffentlichen Dirnen und anständigen Frauenzimmern keinen Unterschied.
Einmal blieb er vor einer aufgeputzten, geschminkten Gestalt stehen.
„Na Hedwig, wie geht es Dir?“ frug er vertraulich.
Das Mädchen war erfreut, lächelte und trat dicht an ihn heran.
„Ich danke. Wohin wollen Sie? Begleiten Sie mich —.“
„Kann heute nicht. Adieu Kleine, auf Wiedersehen.“
Man trennte sich kurz und freundlich. Er war mit dieser Art Mädchen ebenfalls sehr bekannt, denn er wohnte in diesem Viertel, das der Fabrik am nächsten lag, und war ein ständiger Besucher des Wiener-Cafés, dem nächtlichen Markte der Hetären.
An der Oranienstrasse bestieg er die Pferdebahn, um seinem Ziele zuzufahren. Nach einer halben Stunde sehen wir ihn in eine der vielen Studentenkneipen der Friedrichsstadt treten. Sie führte die Firma „Zum Falstaff“. Vorher hatte er von einem Blumenmädchen, das an einer Laterne stand, eine rothe Rose gekauft, die er kokett im Knopfloch seines Jaquets befestigte.
Als er in das im ersten Stockwerk belegene Lokal trat, scholl ihm jenes halbgedämpfte wirre Gemurmel von Stimmen entgegen, das immer den Beweis für den regen Besuch einer derartigen Kneipe giebt. Trotz der theilweise geöffneten oberen Fenster lagerten Wolken Cigarrendampfes um die Milchglasschalen der Gasflammen, die die drückende Wärme des Sommerabends noch weniger angenehm machten. Ein Blick durch die aneinanderhängenden Räume lehrte Brendel, dass das Lokal stark besetzt war. Man zechte stumm, spielte den üblichen Skat oder debattirte laut. Dazwischen ertönte abwechselnd der Ruf nach der Bedienung, nach Bier, oder erschallte die helle Klingel, welche die Mamsells nach dem Buffet rief, um bestellte Speisen oder Getränke entgegen zu nehmen.
Der Volontair der Firma Rother und Sohn durchschritt die ersten Zimmer bis zu einem am äussersten Ende gelegenen, in dem er einen Platz zu finden hoffte. Dabei trug er sein dünnes Stöckchen wie eine mit der Spitze nach unten gekehrte Lanze und lüftete das Haupt, um den Blicken der zu beiden Seiten sitzenden Gäste das glänzende, gescheitelte Haar preiszugeben.
Im Rahmen der ausgehobenen Thür kam ihm die Mamsell entgegen, die in diesem Revier bediente. Sie trug in der Rechten ein paar leere Gläser, sah ihn nicht kommen und wäre beinahe mit ihm zusammengestossen.
„Ach, der gute Leo! Wie geht’s, Kindchen? Was macht Edmund? Was trinken Sie, Dunkles oder Helles?“ brachte sie hintereinander hervor, ohne erst die Antwort auf jede einzelne Frage abzuwarten.
„Bitte, Dunkles — bringen Sie sich auch gleich einen Schoppen,“ bestellte Leo, die Hand der Kellnerin drückend.
„Nehmen Sie dort rechts Platz.“ Dann eilte sie hinweg.
„Lina,“ rief er ihr nach, „bringen Sie mir doch auch die Speisenkarte!“
Dann sah er sich nach einem Platz um. An einem kleineren Tisch waren noch einige Plätze frei. Es sass nur ein Herr mit ausdrucksvollem Gesicht an ihm, der die Beine von sich gestreckt hatte und nicht besonders gut gelaunt schien, denn er zeigte eine üble Miene und starrte abwechselnd sein Glas an.
„Sie erlauben —?“ wurde er jetzt von Brendel höflich gefragt, der an einem Stuhl rückte.
„Bitte —.“ war die ebenso höfliche Antwort, von einer Handbewegung begleitet.
Brendel zog noch im Stehen die hechtgrauen Handschuhe ab, dann setzte er sich und griff in die Tasche zu seinen Haarbürsten, dabei musterte er mit einem raschen Blick die um ihn Sitzenden.
An der hintersten Wand auf einem kleinen Ledersopha zurückgelehnt sassen ein paar Künstler, die fleissig rauchten und beobachteten, hin und wieder zusammen sprachen. Der eine von ihnen, der mit dem dunklen, kurzgestutzten Vollbart war Oswald Freigang; der andere zeigte auf breiten Schultern einen mächtigen Kopf mit von Pockennarben zerrissenem Antlitz, umgeben von einer hellblonden Mähne, die in ihrer Ueppigkeit an die eines Löwen erinnerte. Das war der Heiligenmaler Hannes Schlichting. Vor ihm neben seinem Glase lag ein lederner Schnürbeutel, gefüllt mit türkischem Tabak, aus dem er sich in gewissen Zwischenräumen eine kleine, braun angerauchte Meerschaumpfeife stopfte — die unzertrennliche Freundin seines Lebens, seiner Arbeit, seiner Kunst. Es lag etwas Schwerfälliges, halb Unbeholfenes im Wesen dieses Mannes, das ihn im Verein mit dem entstellenden Merkmal einer späten, schlecht geheilten Krankheit nicht übersehen liess. Wie er den riesigen Oberkörper drehte und wand, wie er den Ellenbogen ungenirt auf den Tisch stützte und die grosse Hand in das Haar vergrub — das diente zur scharfen Charakteristik eines Menschen, das waren noch alte, unverwischbare Angewohnheiten jener Zeit, als er auf der rothen Erde Westfalens den Acker seines Vaters, eines kleinen Bauern, pflügte. Man konnte Hannes Schlichting nicht mehr vergessen, man musste sich ihn dem Auge einprägen für ewige Zeiten, wenn man ihn einmal gesehen hatte. Man sah in dieses längliche Gesicht mit dem kaum merklichen spärlichen Schnurrbart, man sah die unzähligen, tief eingegrabenen Pockennarben, die es zerfetzt hatten, man hörte sein lautes, stossweise hervorquellendes Lachen und man fand beim ersten Blick, dass die Unschönheiten eines Menschen nicht auffallender zu Tage treten konnten. Man wandte die Augen fort, um sie doch wieder auf Johannes Schlichting ruhen zu lassen. Dieser Kopf zog an, je mehr er abstossen sollte. Es war das Gepräge des Geistes, der Stempel einer ausgesprochenen Individualität, der zuletzt die Pockennarben verschwinden, die Unmanieren nicht merken und nur noch scharfe, edle, sympathische Linien sehen liess — die Gesammterscheinung in ihrer charakteristischen, originellen Form.
Hatte man ihn dann erst näher kennen gelernt, erfahren, was für ein biederer Sinn, welch ein kindliches Gemüth in dieser äusserlich so vernachlässigten derben Hülle steckte, dann gewann man ihn lieb, man fand ihn schön, man vermisste etwas, wenn man ihn nicht sah und ihn nicht hörte in seiner breiten Mundart, mit seinem derben naiven westfälischen Humor.
Er war ein wenig Pessimist, der gute Hannes, trotz seinem unerschütterlichen Glauben an das dereinstige Fortleben seiner Kunst, wenn Genre, Landschaft und Historie schon längst als verbraucht das Zeitliche gesegnet haben sollten.
Und doch fühlte er in seinem Innern, wie der tosende Schrei der Zeit seine Ideale übertönte, wie er lärmend über die Satzungen der Bibel hinweg nach Greifbarem, Wahrem, nach der nackten Materie rief. Das machte sein Herz innerlich bluten, liess ihn aber nie energisch dagegen protestiren. Er fürchtete, man könne ihn nicht verstehen. Er besass auch einen zu glücklichen Humor, als dass man ihm einen zu grossen Ernst zugetraut hätte.
Das Höchste, was er in solchen Augenblicken zu sagen vermochte, wurzelte in einem stereotypen Satz.
„Bruder,“ pflegte er zu Freigang zu sagen, „’s ist halt nichts mehr mit der Kunst, ’s ist nur noch ’ne Zeit für Dampf und Qualm, ’s ist Alles Dampf und Qualm.“
Und als müsste er diesen Worten noch eine bildliche Bestätigung geben, dampfte er ärger denn je aus seiner Pfeife.
Wenn Hannes auch seine Lebensaufgabe in der Darstellung religiöser Dinge erblickte, brauchte man ihn nicht gleich für einen Pietisten zu halten. Ihm war die Kunst zu wenig Selbstzweck, als dass er im Stande gewesen wäre, in ihr eine bestimmte Tendenz zu verfolgen. Was er anstrebte, war die Erreichung des ewig Schönen, des ewig Göttlichen, das er im Antlitz einer Madonna verkörpert glaubte. Er verstand es, stets den Menschen vom Künstler zu trennen — im guten Sinne natürlich. Er war ein Freund von Geselligkeit, er liebte einen tüchtigen Scherz, noch mehr ein gutes Glas Bier und war ein erklärter Feind jeder Verschlossenheit, jeder Stubenhockerei. Was er hasste und verabscheute, das war die Gemeinheit, die offene frivole Gemeinheit. Man konnte ihn reizen durch ein einziges den Anstand und die Höflichkeit verletzendes Wort, und wehe dem, der seine Gutmüthigkeit zu missbrauchen suchte. Dann verstummte das breite Lachen, die Pfeife dampfte schneller, der Körper reckte und dehnte sich nach allen Seiten, die Hand kraute nervös in den Haaren, und ein Gemisch von Wuth und Groll packte den ganzen Mann und machte ihn erbeben vom Wirbel bis zur Zehe. Eine Fluth der Entrüstung kam über seine Lippen und tobte sich wild-unbändig aus, wie der Sturm nach einer Gewitterschwüle. Und doch bedurfte es wieder nur weniger Minuten, um ihn zum Kinde zu machen, um ihn lächeln, scherzen zu sehen. So war der Mann im ewig grauen Wams — der Heiligenmaler Hannes Schlichting, ein Mensch, den man erst studiren musste, um ihn ganz zu kennen.
Heute hatte er bereits mehrmals das bekannte „’s ist Alles Dampf und Qualm, Bruder“, vom Stapel gelassen, als er sich mit Freigang in Lebensphilosophie erging. Dabei ruhten seine Augen nie. Er bemerkte Alles, was im Lokale vorging, beobachtete scharf und hatte kleine beissende Bemerkungen bereit.
„Scheint auch ein rechter Geck zu sein,“ meinte er halblaut zu Freigang, als Leo Brendel seine Haare strich. „Weisst Du, Bruder, das sind so die Söhne ihrer Väter, an denen die Kunst auch nichts verliert. Gelt? Reiche Jungen, die nur Sinn fürs Kneipen und für die Weibsbilder haben. Hast ja gesehen! Hat ’nen ganzen Bürstenladen in der Tasche für seine drei Haare.“
Der gute Hannes lachte wie gewöhnlich selbst über seinen Witz. Freigang konnte sich dieser Art Heiterkeit nie entziehen, er zeigte ebenfalls eine Miene zum Lachen.
„Du triffst immer das Richtige, Hannes: ein Geck durch und durch.“
Hannes hatte dann plötzlich von einer andern Sache gesprochen. Er hatte endlich ein Modell für seine „Madonna mit dem Kinde“ gefunden, an der er für die grosse Ausstellung malte. Das Bild war fast vollendet, aber der Kopf machte ihm noch immer Schwierigkeiten — er konnte unter all den professionirten Modellen kein Antlitz finden, das dem einer Heiligen glich, wenn auch nach allem möglichen Idealisiren. Es fehlten ihm die Linien, die weichen edlen Linien, die ihn begeistert hätten. Das brachte ihn oft zur Verzweiflung, dass er die Leinwand von der Staffelei nahm, verkehrt gegen die Wand lehnte und tagelang keinen Strich daran machte. Und doch war es die höchste Zeit, an das Werk die letzte Hand zu legen. Da fasste er den Entschluss, sich ein Modell von der Strasse zu holen. Wenn es sieben Uhr schlug, jene Zeit herangerückt war, wo die Ateliers der Blumenfabriken, die Werkstätten der Nähmamsells, die Magazine aller Art, in denen Mädchen beschäftigt waren, sich zu entleeren pflegten, griff er nach seinem Jaquet, dem alten, langgedienten Jaquet, stülpte den riesigen grauen Filz auf und eilte die fünf steinernen Treppen hinab unter die Menge der Passanten. O, er wusste, was für Gesichter man manchmal unter diesen Töchtern des Volkes fand: herrliche Köpfe mit einem Antlitz wie Milch und Blut, mit so üppigen, goldigblonden Flechten.
„Weisst schon, Bruder — ich habe Eine gefunden,“ erzählte er jetzt Freigang mit aller Lebhaftigkeit, die ihm zu Gebote stand. „Das ist ein Mädel, die hat ein Gesicht! Eine arme Arbeiterin scheint’s zu sein, ganz so ging sie gekleidet, aber diese Augen, dieser Mund, dieses Oval, ich sage Dir — ein Engel ist’s, ein leibhaftiger Engel. Ich muss sie haben und wenn’s doppelt kostet, sie wird’s gebrauchen. Wenn ich da mit der Kunst ein bischen nachhelfe, dann habe ich meinen Kopf ... Ganze fünf Minuten bin ich an ihrer Seite gegangen, und gerad’ als ich sie ansprechen wollt’, verschwand sie in ein Haus der Manteuffelstrasse. Aber ich weiss jetzt, wann sie kommt und welchen Weg sie nimmt. Aber Bruder —“ er machte eine Pause aus Verlegenheit und fuhr dann zagend fort: „Du weisst, ’s wird schwer, wenn Du dabei sein wolltest, um ein gutes Wort — gelt?“
Freigang wusste schon, was er sagen wollte. Er kannte seine Unbeholfenheit und musste jedesmal lächeln, wenn er ihn dabei ertappte. Er versprach, ihm behilflich zu sein. Dann sah er nach der Uhr. Plagemann wollte noch kommen, wenn es ihm seine Zeit gestattete. Man hatte sich hier ein Rendezvous gegeben.
Lina, die Mamsell, kam jetzt zurück und brachte Bier und Speisekarte.
Diese Lina Schmidt, was hatten zwei Jahre aus ihr gemacht! Wo war das einfache Kleid aus grobem Wollstoff geblieben, wo die rauhen Hände, die bäurisch-gesunde Gesichtsfarbe, wo die einstige linkische Bewegung? Wer sah es jetzt diesem Mädchen mit dem durchsichtigen, halb krankhaft blassen Teint, den beringten zarten Händen und dem koketten Wiegen des wohlfrisirten Köpfchens an, dass sie ehemals Arbeiterin in einer Teppichfabrik gewesen war, dass es eine Zeit gegeben hatte, wo sie für den elenden Wochenlohn von drei Thalern sich elf Stunden täglich plagen musste? Was ihr geblieben war, das waren die Stiefeletten, das war das halbrund abgeschnittene Stirnhaar. Was für „gute“ Manieren sie sich durch den steten Umgang mit Studenten angeeignet hatte, wie sie sich herausgemustert hatte! Wie sie verstanden hatte sich eng zu schnüren, dass die üppige Büste plastische Formen bekam. Wie in dem prallsitzenden, glänzend-schwarzen Satinkleide der runde Nacken sich wölbte, wie jede Linie des Körpers sich in der Robe markirte! O, sie hatte mit der Zeit gelernt, wie man Reize zur Geltung bringen konnte, ohne sie zu enthüllen, wodurch man den äusseren Anstand zu bewahren im Stande war und doch die lüsternen Blicke der Männer auf sich zu lenken vermochte. Und doch, wie gemein war das nicht: nackt — in Kleidern zu gehen! Aber trugen sich die vornehmsten Damen auf der Strasse nicht ebenso — sie, die doch für anständig gelten wollten? Um wie viel mehr hatte sie nicht das Recht dazu — sie, eine Kellnerin Berlins, die für jedes Trinkgeld, das sie einsteckte, den Männern die Berechtigung gab, zu ihr von Dingen zu sprechen, die dem Ohr jedes anständigen Weibes verschlossen blieben. Das war der unwandelbare Lauf einer Gefallenen, die anfängt, jeden sittlichen Halt zu verlieren.
Fräulein Lina schien sehr intim mit dem „guten Leo“ zu sein und auch sehr erfreut, ihn heute zu Gesicht bekommen zu haben, denn sie setzte sich sofort zu ihm und rückte so dicht, als es gestattet war, zu ihm heran.
„Sie haben sich ja seit acht Tagen nicht sehen lassen,“ sagte sie; dann hatte sie allerlei Fragen zu stellen, Erkundigungen einzuziehen, die sie ganz speziell zu betreffen schienen, für Zweite und Dritte aber ihrer Ansicht nach zu wenig Interesse haben mussten, als dass sie sich im lauten Sprechen hätte geniren sollen. Einmal nur sah sie zu dem andern Herrn am Tisch, mit dem sie, ehe Brendel kam, geplaudert hatte, auf, und als sie jetzt mit dem jungen Mann zum Trinken anstiess, rief sie auch dem andern Gast ein einladendes „Prosit“ zu.
Dann hatte sie das Essen für den Volontair bestellt und war zum zweiten Male zurückgekehrt.
Aus der Frage, die sie jetzt ziemlich laut an Leo richtete, ging hervor, dass dieser die alten Sünden seines Cousin Edmund ziemlich genau kennen musste, also auch die Verpflichtung, die er diesem Mädchen gegenüber hatte.
„Was macht denn der süsse Edmund und die schöne Frau Rother?“ frug sie mit einem Anflug von verstecktem Spott, indem sie dieses „süsse“ ganz besonders liebenswürdig betonte. Dabei befleissigte sie sich, ihrer Stimme eine möglichst wohlthuende Modulation zu geben, während ihre linke Hand mit dem dreifach um den schlanken Hals geschlungenen rothen Korallenband spielte.
Der andere Herr am Tisch blickte bei der Frage gross auf und liess erstaunt seine Augen abwechselnd auf Beiden ruhen. Er veränderte seine behagliche Lage im Stuhle, beugte sich über sein Glas und strich mit den Fingern daran, als sei ihm vollständig gleichgültig, was das Pärchen da spreche. In Wahrheit aber war durch die wenigen Worte eine grosse Erregung in ihm hervorgerufen, die er vergeblich zu unterdrücken suchte, und die den lebhaften Wunsch in ihm rege machte, die Fortsetzung des Gespräches zu hören. Auch auf dem wenige Schritte entfernten Sopha zeigte sich eine Bewegung. Oswald Freigang neigte sich ebenfalls nach vornüber und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Die Unterhaltung interessirte ihn auch, seitdem er seit gestern wusste, wer Edmund Rother und seine Frau waren.
„Ich danke, liebes Kind,“ antwortete Leo und zündete sich eine Cigarette an; dann fügte er hinzu: „Die sind schon zurück aus Italien.“
„Wirklich?“
Fräulein Lina zeigte ein unverhohlenes Erstaunen.
„Er ist wohl jetzt sehr moralisch geworden?“ hatte die Kellnerin wieder zu fragen.
Leo machte eine Handbewegung, die der Ausdruck seiner pessimistischen Ansicht in dieser Beziehung sein sollte, und erwiderte skeptisch:
„Wird lange bei ihm dauern! — Uebrigens,“ fuhr er gleich fragend fort, aber halb gedämpft, indem er sich mehr zu Lina neigte, „was macht der Kleine?“
„Der kleine Edmund? Ich danke, der befindet sich ganz wohl. Was meinen Sie, guter Leo, wenn die schöne, tugendsame Louise davon wüsste, oh —.“
Sie musste bei diesem Gedanken, der ihr mehr komisch als tragisch erschien, lachen. Dem guten Leo schien das nicht so lächerlich vorzukommen. Er zeigte plötzlich eine sehr ernste Miene, blies den Rauch seiner Cigarette mehrmals äusserst kunstvoll von sich und sagte dann:
„Da ist nicht zu scherzen, Kind. Im Hause wäre der Teufel los. Ich glaube, mein lieber Onkel würde um seine Schwiegertochter kommen, die jetzt die Hälfte seines Lebens ausmacht. Uebrigens, liebe Lina, haben sie durchaus keine Ursache, sich zu beklagen, ich weiss —.“
Dieses „ich weiss“ wurde von einem vielsagenden Blick begleitet, den Lina Schmidt am besten verstand.
„So war das ja nicht gemeint, guter Leo. Darf ich noch eins bringen?“
Sie war aufgestanden und hatte nach dem geleerten Glas gegriffen. Brendel nickte. Am Buffet hatte es geklingelt. Im Gehen war sie noch besonders zärtlich, denn sie streichelte dem jungen Mann flüchtig die Wange.
Der andere Herr am Tische hatte schliesslich mit Absicht zu einem Zeitungsblatt gegriffen und den Rest seines Bieres in einem Zug hinuntergestürzt. Als Lina ging, bat er ebenfalls um frisches Bier.
Kein Wort von dem Anfang der Unterhaltung war ihm entgangen. Als das Mädchen fort war, hatte er eine höfliche Frage an seinen Tischnachbar zu richten, die ihm ebenso höflich zur Zufriedenheit beantwortet wurde. Da man an einem Tische sass, sich in einer gemüthlichen Kneipe befand, Jeder vom Andern den Eindruck empfand, es mit einem wohlerzogenen Menschen zu thun zu haben, so fühlte man sich einander näher gerückt, zu einer Unterhaltung geneigt. Man wechselte erst ein paar Worte über ganz alltägliche Dinge, wie über das gute Bier, die Hitze, „das schöne Mädel, die Lina,“ und fand es dann an der Zeit sich vorzustellen, erst flüchtig die Namen zu nennen und dann die Visitenkarten hervorzulangen, auf die man einen Blick warf, um die Namen genauer zu kennen.
„Robert Seidel“, las der junge Volontair, und „Leo Brendel. Im Hause Rother und Sohn“ las der neu engagirte Kassirer der Teppichfabrik.
Es dauerte nicht lange, so wusste man ganz genau, in welchen Beziehungen Jeder zu der Firma Rother und Sohn stand. Man war nicht wenig erstaunt, durch dieses merkwürdige Zusammentreffen bekannt geworden zu sein. Leo Brendel wusste noch nichts von dem neuen Engagement in der Leipzigerstrasse, und Robert Seidel war diese plötzliche Bekanntschaft in sofern lieb, als er sich in etwas wenigstens über seine neue Wirkungsstätte informiren konnte. Es gab da so manches zu fragen, über so manche Dinge Auskunft zu erbitten. Vor Allem aber war es für ihn von Interesse, über Frau Rother junior und ihren Gatten etwas zu erfahren. Er hasste diesen Mann bereits, ohne ihn einmal gesehen zu haben, und war geradezu bestürzt, als er in dem Gespräch zwischen Brendel und der Mamsell Dinge hörte, die nur auf seinen neuen Chef Bezug haben konnten. Was diese Louise Wilmer für eine Parthie gemacht hatte! Während des ganzen Tages hatte er daran denken müssen. Dass sie es auch gerade sein musste, die durch ihren Anblick mit einem Schlage die Vergangenheit ihn ihm wach rief — von den Stunden ungetrübten Jugendglückes, in denen er für sie geschwärmt hatte, bis zu jenen jämmerlichen Tagen, in denen er, halb krank vor Aufregung, des Abends die Strassen durchirrte, — um seine betrogene Schwester zu suchen. Und er fand sie niemals, niemals. Er erliess Aufrufe in den Zeitungen, Anschläge an den Säulen, in denen er sie inständigst bat, zu ihm zurückzukehren, ihr sei vergeben; er durchwanderte halb Berlin, er nahm das Einwohnermeldeamt, die Polizei in Anspruch — Alles, Alles vergebens. Er fand weder sie noch die leiseste Spur von ihr. Sie war hart, sehr hart gegen ihn. O, er wusste wohl: sie blieb nur fern, um ihn in seinem Lebensweg nicht hinderlich zu sein, sie wollte die Schmach des Namens Seidel allein tragen, ganz allein. Das gute, grosse Herz! Und doch hätte er so gern einen Theil dieser Schande mitgetragen, alles: Entbehrung, Noth und Elend, hätte er ihr wie früher in die guten, lieben Augen schauen können. Er wusste ja, sie war rein, trotzdem sie gefallen war; doch hätte er die Hälfte seines Lebens gegeben, hätte er von ihren Lippen den Namen ihres Verführers gehört — um der schaurigen Seligkeit willen hätte er es gethan, mit der er ihr Genugthuung verschafft hätte, Aug’ um Auge, Zahn um Zahn ... Aber er musste den nagenden Schmerz tragen, stumm, blutenden Herzens wie eine Centnerbürde. Das machte ihn früh reifen, liess eine gewisse Herbheit in seiner Natur zum Durchbruch kommen, die sonst jungen Leuten seines Alters nicht zu eigen zu sein pflegt. Was ihm aber eine fürchterliche Seelenpein verursachte, das war die hin und wieder bei ihm auftauchende Ahnung, dass seine Schwester nicht mehr unter den Lebenden weilen könne. Wenn er Zeitungen zur Hand nahm und die Notizen über jene Unglücklichen las, die selbst Hand an sich gelegt hatten, wenn er von jenen unbekannten Leichen hörte, wie sie eine Weltstadt fast täglich an das Tageslicht fördert, und wenn er daran dachte, dass Maria zu ihnen gehören könne, dann wurde er vom Schauer durchrieselt. In diesem giftigen Ameisenhaufen, wo Einer dem Andern zurief: „Stirb du, damit ich lebe!“ war doch Alles möglich. In solchen Momenten schrie er in seinem Zimmer laut auf — aber es hörte ihn Niemand, der ihm Trost in seinem zerrissenen Dasein zugesprochen hätte.
Mit der Zeit wurde er apathischer, gab jede Hoffnung auf und ging nach dem Ausland. Mit dem gestrigen Tage der Rückkehr in seine Vaterstadt jedoch war die einstige Hoffnung, mit seiner Schwester wieder vereint zu werden, reger als je geworden, hatte ihn neu belebter gestaltet. O, wie glücklich hätten sie jetzt beide leben können, wie sorglos, ruhig und zufrieden. Er hatte achthundert Thaler Gehalt und dabei die Aussicht auf eine dauernde Stellung.
Wie der Mensch in gewissen Glücksstunden sich nur zu gern in seinen Hoffnungen zu betrügen sucht, wenn auch auf Kosten der Wirklichkeit, so hatte er seit heute Vormittag bereits angefangen in diesem Gedanken zu schwelgen. Am anderen Tage bereits wollte er von Neuem seine Nachforschungen aufnehmen. Diese Zuversicht, die ihn dabei beseelte, dazu das merkwürdige Zusammentreffen mit Louise Wilmer, jetzt Frau Rother, das ein unbeschreibliches altes Gefühl in ihm wachrief, hatte eine plötzliche Umwandlung in seinem sonst so verschlossenen, ernsten, mehr auf sich selbst angewiesenen Wesen hervorgerufen, dem er sich nicht zu entziehen vermochte. So sehen wir ihn denn auch heute in einer fast heiteren, zum lustigen Kneipen animirten Stimmung, die ihn die sonstige Misère des Daseins vergessen machen sollte — einer Stimmung, die noch durch die schnell geschlossene, ihn interessirende Bekanntschaft mit seinem jetzigen Kollegen Leo Brendel bedeutend gehoben wurde.
Ein einziger unglückseliger Zufall, vielleicht entstanden durch das unbewusste Hinlenken des Volontairs auf ein „ganz merkwürdig geartetes Weib“, das denselben Namen führe wie er und draussen in der Fabrik an der Spree als Arbeiterin beschäftigt sei — eine Gesprächswendung, die sehr nahe lag — hätte vielleicht im Augenblick den Dingen einen andern Lauf gegeben, hätte vielleicht durch die gewohnheitsmässigen, halb cynischen Aeusserungen des Volontairs diesen in den Augen Roberts sofort zum gemeinen, seines Umgangs nicht würdigen Menschen gemacht — aber dieser unglückliche Zufall traf eben nicht ein. Den Namen Seidel fand man so häufig, und wie hätte Brendel es auch erklärlich finden können, dass die Schwester eines noch lebenden, gebildeten, durch eine vorzügliche Stellung gut situirten Mannes sich ihr Brod als Arbeiterin in einer Teppichfabrik verdienen müsse. Nichts lag ihm ferner als dieser Gedanke. Und dann, was gingen sie auch die Arbeiterinnen der Fabrik an — jetzt, wo sie von weit wichtigeren Dingen zu sprechen hatten.
Der gute Leo sprach in seinem jugendlichen Uebermuth so gern von Dingen, die einen sittlich-heiklen Anstrich hatten! Es war ihm bei seinen zweiundzwanzig Jahren immer eine Genugthuung, Andern den Beweis geben zu können, inwieweit er bereits über moralische Gebrechen der Gesellschaft mitsprechen könne. Die Person war ihm dabei ganz Nebensache, wenn er nur einen Zuhörer fand. War dieser Zuhörer älter als er, so war ihm dies um so schmeichelhafter. Im Verlaufe von wenigen Minuten hatte Robert Seidel diese Erfahrung bereits gemacht. Leo Brendel war im besten Gange, ihn in die Junggesellensünden seines „lieben Cousin“ Edmund in Betreff Linas zur Genüge einzuweihen, als diese mit Bier und Essen an den Tisch zurückkehrte. Sie war nicht gerade erstaunt, die beiden jungen Männer im Gespräch zu sehen, im Gegentheil, sie freute sich innerlich, da ihr Seidel von Anfang an als ein sehr hübscher Mensch vorgekommen war und sie jetzt Gelegenheit fand, sich ebenfalls mit ihm unterhalten zu dürfen, ohne den „guten Leo“, der sie stark poussirte, zu erzürnen.
Sie hatte dann an einem andern Tisch zu bedienen. Als Brendel gespeist hatte, war sie aber doch erstaunt und sogar etwas piquirt, als sie hörte, dass man bezahlen wollte, um nach einem andern Ort zu gehen. Diese schnelle Intimität schien ihr auffallend. Sie nöthigte noch zum Bleiben, aber man liess sich nicht aufhalten. Schliesslich that sie aber doch sehr freundlich und drückte Jedem die Hand, indem sie Brendel noch um die Rose im Knopfloch bat, die dieser ihr auch mit ein paar zärtlichen Worten gab. Sie lud dann noch die Herren ein, recht bald wieder zu kommen. —
Hannes Schlichting hatte für das gleichzeitige Aufbrechen der Beiden zu Freigang wieder eine Bemerkung bereit.
„Ist so ein hübscher Junge der Andere, und sieht so vernünftig aus. Kann nicht begreifen, wie man sich so rasch mit so einem Gecken befreunden kann. Begreifst Du das, Bruder?“
Freigang schüttelte nur stumm mit dem Kopf.
Als Seidel und Brendel im andern Zimmer angelangt waren, sagte der Letztere:
„Haben Sie den Kerl mit der Perrücke da hinten auf dem Sopha gesehen? Ich konnte ihn kaum ansehen beim Essen, der Pockennarben wegen.“
Seidel verstand im Lärm die Frage nicht ganz, nickte aber instinktiv.
Wenn Leo Brendel nur gewusst hätte, dass der Pockennarbige dereinst sein Todfeind werden würde.