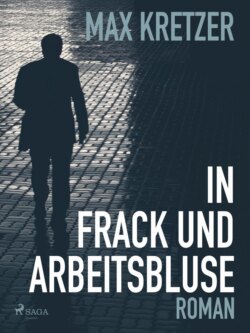Читать книгу In Frack und Arbeitsbluse - Max Kretzer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеEnde Oktober erlebte Fabrikbesitzer Geiger etwas Überraschendes, wie es ihm ähnlich noch nicht begegnet war. Vormittags gegen elf Uhr sass er in seinem Privatkontor und hatte sich gerade nach allerhand Morgengeschäften etwas Luft gemacht, als ihm ein Unbekannter gemeldet wurde, der ihn auf einige Minuten zu sprechen wünsche. Auf der kleinen mit Goldschnitt versehenen Karte stand weiter nichts als der Name Waldemar Tempel. Der rundliche, bewegliche, stets über unliebsame Störungen klagende Herr Ferdinand Geiger, den seine Freunde kurzweg mit Nante bezeichneten, wollte schon heftig werden, weil man den Besuch nach seinem Begehr zu fragen vergessen hatte, als er noch rechtzeitig einen Blick durch das kleine Lugfenster ins grosse Kontor warf und dort einen dunkel gekleideten Herrn stehen sah, der den Eindruck eines neuen Kunden auf ihn machte. Und so sagte er kurz und geschäftsmässig: „Ich lasse bitten.“
Ein etwas mitgenommen aussehender junger Mann sass dann vor ihm, dessen tadelloses Benehmen aber sofort auf gute Erziehung schliessen liess. Er hatte sehr schönes, glänzendes Haar, und in dem angenehmen Gesicht mit der kühnen Nase und dem modisch gestutzten Schnurrbart sprachen ein paar kluge und klare Augen ihre reizvolle Sprache.
Und es entspann sich folgendes Gespräch:
„Womit kann ich Ihnen dienen?“
Mit Arbeit, mit irgend welcher Arbeit in Ihrer Fabrik.“
Geiger, der ihn jetzt erst sprechen hörte, glaubte einen Ausländer vor sich zu haben, der sich nicht richtig auszudrücken verstehe. Daher sagte er entgegenkommend: „Sie können bei mir alles bekommen, was Sie wünschen.“ Und schon langte er nach Mustertafeln und einem Preisverzeichnis, als er über seinen Irrtum aufgeklärt wurde und zwar in einer Form, die ihm jeden Gedanken an „Ausländerei“ nahm. Sofort wurde sein Ton ein anderer, schwand das stolze Bild da vor ihm.
„Ach, Sie wollen Beschäftigung bei mir haben? Det is jut, sehr jut.“
anchmal fiel er um, besonders in Fällen, die seine Urwüchsigkeit als Berliner herausforderten, und so tat er sich keinen Zwang mehr an. „Ja, lieber Herr, hör’n Se mal .... Danach hätten Sie auch im Kontor fragen können — bei meinem Pokuristen. Es ist gar keine Vakanz vorhanden. Bedaure, bedaure. Was sind Sie denn. Buchhalter?“
Er sagte es wie zur Verabschiedung, nachdem er sich ärgerlich erhoben hatte. Aber der andere bewog ihn durch seine andauernd höfliche Haltung weiter zum Anhören. Er sei weder Buchhalter noch etwas anderes, habe auch keine Sehnsucht nach Schreibertätigkeit, die er als Gebildeter schliesslich auch wo anders bekommen könne. Sein Wunsch gehe nur nach harter Handarbeit, denn erstens verlange das die Wiederherstellung seiner Nerven, und zweitens seine ganze Zukunft, die er sich nur durch eine gänzlich veränderte Lebensweise erobern könne. Im übrigen müsse er arbeiten, denn er stehe vis-a-vis de rien.
Er sprach es mit müder, verhaltener Stimme, aber doch in der überlegenen Art des Mannes aus guter Gesellschaft, der voraussetzt, dass seinesgleichen ihn nach dieser Darlegung verstehen werde.
Nante Geiger, nahe daran, ihn nun für einen Narren zu halten, blähte die gesunden Apfelwangen unter einem zurückgedämmten Lachen und liess die hellen, beweglichen Augen über den ganzen, noch so frisch gefirnissten Menschen gleiten, vom sorgsam, fast kokett gescheitelten Haar bis zu dem modernen, blitzblanken Schuhwerk, über dessen schmaler Gelenkumspannung ein Streifen des bronzefarbenen Modestrumpfes unter der Bügelfalte der Hose gerade noch hervorlugte.
Und sofort griff Waldemar Tempel diesen Blick verständnisvoll auf: „Ich bitte, sich nicht an die Lackstiefel zu stossen, damit wollte ich mich nur gut bei Ihnen einführen,“ sagte er verbindlich mit leichter Selbstverspottung. „Die werde ich natürlich ablegen müssen, wenn ich zu Ihnen ins Geschirr gehe.“
„Ja, haben Sie denn was gelernt?“ fragte ihn dann Geiger gemütlich, nachdem er sich von der Verblüffung einigermassen erholt hatte.
„Bisher nur Geld auszugeben, und dazu gehört wohl kein besonderes Talent. Ich bitte, darin keine Frivolität zu erblicken. Es hätte für mich gar keinen Zweck zu heucheln, nachdem ich hier mit der Absicht aufgetaucht bin, in Ihnen meinen Lebensretter zu sehen.“
„Lebensretter is jut,“ warf Geiger trocken ein, da er plötzlich geneigt war, hinter dieser sonderbaren Einführung eine kleine Komödie zu erblicken, bei der man es lediglich auf seine Tasche abgesehen habe. Als Förderer der Wohltätigkeit hatte er genug verschämte Arme kennen gelernt, die auf die kühnsten Schliche gekommen waren. Er sah nach der Wanduhr und wollte schon dem seltsamen Anliegen mit offener Abweisung begegnen, als er durch den Hinweis auf eine vorzügliche Empfehlung davon zurückgehalten wurde.
In diesem Augenblick musste er das Gespräch unterbrechen, denn durch die Tür vom Flur her trat seine Tochter in elegantem Strassenkostüm herein, das hübsche Gesicht noch rot vom scharfen Herbstwinde draussen.
„Ich störe wohl, Papa?“
„Nein, nein, Helmine. Aber wie kommst du denn hierher?“
„Ich war auf dem Görlitzer Bahnhof, das weisst du doch: Tante Ottilie ist abgereist.“
„Ach richtig.“
„Ich wollte dir nur sagen —“
Waldemar Tempel schnellte in die Höhe und machte seine artige Verbeugung, wobei er fast die Hacken zusammen nahm, und zum Dank kam ein freundliches Nicken, begleitet von einem rasch musternden Blick.
Vater und Tochter traten ans Fenster und sprachen dort halblaut weiter, so dass der Wartende jedes Wort hören konnte.
„Wer ist das?“
„Ach, nichts von Bedeutung,“ erwiderte Geiger, und seine Miene schnitt jede weitere Bemerkung darüber ab. Für ihn stand da nur ein stellenloser Mensch, der für seine verwöhnte Tochter lediglich „Sache“ war.
Nichts von Bedeutung! Waldemar Tempel wiederholte diese Worte in Gedanken und lächelte still vor sich hin, so wie jemand lächelt, der eigentlich etwas darauf erwidern möchte, durch Umstände aber daran verhindert wird. Dann aber erschien ihm dieses Urteil sehr treffend, angepasst seiner Lage, denn um in Bedeutungslosigkeit zu versinken, war er hierher gekommen.
Er kehrte sich der Wand zu und betrachtete ein Bild, um sich die Zeit zu verkürzen. Dabei spitzte er aber unwillkürlich die Ohren, denn hinter seinem Rücken fielen ein paar Namen, die in ihm die wonnige Erinnerung an das fröhliche Leben jener sonnigen Welt erweckten, in der man sich niemals langweilt, die er aber nun, einem hässlichen Zwange folgend, auf bestimmte Zeit verlassen sollte.
„Aber hör’ mal, Papa, du darfst nicht vergessen, dass wir am zwanzigsten zu Frau von Lettendorf geladen sind, zum ersten Male,“ plauderte Helmine weiter. „Ich freue mich riesig darauf. Es soll da geradezu reizend sein.“
„Ja, ja,“ warf Geiger unruhig ein.
„Und dann denk’ daran, dass wir am zweiten November unseren ersten Abend haben. Und dann kommen Hertels, der Abend im Zoo, das Wagnerkonzert, na, und so weiter.“
„Jajaja,“ kam es nun ächzend über des Vaters Lippen, da ihm diese Sache schon zu lange dauerte.
Ganz besonders der Name Lettendorf klang Tempel so vertraulich, als spräche ihn eine gute Bekannte aus, und als müsste er sich plötzlich in die Unterhaltung mischen mit den Worten: „Wie geht es denn eigentlich der Teuren? Wollen Sie nicht die Güte haben, mich ihr bestens zu empfehlen?“
Zum Glück ging Helmine, so dass er seine Haltung bewahren konnte.
„Also grüss’ Mama, ich komme heute etwas später.“
„Danke, Papa.“
Zum zweiten Mal machte Tempel seine tadellose Verbeugung, und abermals erhielt er den Kopfnicker, der diesmal allerdings etwas kühl ausfiel. Aber mit Vergnügen sog er den kalten Veilchenduft ein, den sie nun beim Gehen wieder aufgescheucht hatte.
Geiger nahm das Empfehlungsschreiben aus Tempels Händen entgegen, überflog es noch im Stehen und bat dann, wieder Platz zu nehmen. Und auch er setzte sich aufs neue, nunmehr bedeutend höflicher geworden, denn da schrieb ihm ein höchst ehrenwerter Mann, der Justizrat Dietzel, Königlicher Notar am Kammergericht, bekannt auch als Stadtverordneter, dessen persönlicher Begegnung hin und wieder er sich entsann, dass Herr Waldemar Tempel, Sohn des verstorbenen Architekten Reinhard Tempel und seiner Gemahlin Mathilde, geborene von Schmesow, nach einem „bedauerlichen Nichtstuerleben“ den zwar etwas sonderbar klingenden, aber erklärlichen und gewiss anzuerkennenden Wunsch hege, auf einige Zeit sein Heil in einer Fabrik zu suchen, um, entgegen seinen bisherigen Gewohnheiten, durch irgend welche ihm zusagende, aber durchaus harte Arbeit andere Anschauungen vom Leben und von der Welt zu bekommen. An diesem Entschluss sei nicht mehr zu rütteln, und so werde Herr Ferdinand Geiger freundlichst gebeten, dem „begabten und geistig hervorragenden“ jungen Mann, der auch sonst viel Liebenswürdigkeit besitze, bereitwillig sein Entgegenkommen zu zeigen.
„Ist das nun wirklich Ihr Ernst?“ fragte Geiger, nachdem er den Brief noch einmal gelesen hatte.
„Ich würde mich schämen vor Ihnen, wenn es anders wäre,“ erwiderte Tempel einfach.
„Es liegen doch nicht etwa besondere Dinge vor, die Sie zwingen (er räusperte sich), auf solche Art die Flucht zu ergreifen?“
Tempel glaubte ihn zu verstehen. „Ich habe weder im Gefängnis noch im Zuchthause gesessen,“ sagte er mit leichter Heiterkeit. „Natürlich bin ich auch noch nicht mit Ehrverlust ausgezeichnet.“
Geiger lachte verlegen. „Nee, nee, das mein’ ich nicht, den Eindruck machen Sie nich,“ redete er sich aus, denn etwas Ähnliches hatte er sich gedacht. „Da hätte mir der Geheimrat wohl schon so’n kleinen Wink gegeben. Der wäre schliesslich dafür verantwortlich. So ganz neu wäre die Sache übrigens nicht.“
Und er sprach davon, dass ihm der Verein zur Besserung entlassener Strafgefangener schon zweimal Leute zugeschickt habe, die sich ganz gut bewährt hätten. Natürlich habe von den Werkstattkollegen niemand etwas von deren Vergangenheit gewusst.
Tempel sass mit brennendem Gesicht da, so wie ein Mensch, der eine heimliche Folter unverdient ertragen muss. Und um sich Luft zu machen, fügte er ernst hinzu: „Gestraft bin ich allerdings, aber nur durch meinen Lebenswandel, der mich so weit gebracht hat. Aber Sie werden mir wohl zugeben: bestraft hätten eigentlich diejenigen werden müssen, die mich erstens falsch erzogen haben, und zweitens mir frühzeitig zu viel Geld in die Hände gegeben haben.“
„Das ist richtig,“ warf Geiger lebhaft ein. „Manchmal verdienen die Eltern noch im Grabe eins drauf. Entschuldigen Sie nur —: ich hatte nicht die Ehre, Ihren Herren Vater zu kennen, aber wenn Sie es selbst sagen ....“
„Pardon, es war mein seliger Grosspapa, dessen Liebling ich war.“
„Na, dann verdient der Grosspapa eins drauf. Vielleicht hat das Petrus schon besorgt ... Übrigens sagen Sie mal —: der Name Tempel ... Tempel ... Tempel. Da dämmert mir etwas. Mir ist’s so, als hätt’ ich da mal irgend was in der Zeitung gelesen: ’ne dolle Jeschichte von einem jungen Mann, der ’ne Korsofahrt mit zehn Droschken die Linden entlang machte. Am hellen, lichten Tage. In jeder sass’n Dienstmann. Nachher hat er allen ein Essen gegeben — in’n Zelten. Zaren Sie das vielleicht?“
Waldemar Tempel nickte zustimmend. „Ich bekenne mich schuldig dieser Freveltat, die eine von meinen kleineren Sünden war.“
Nante Geiger lachte wieder. „Mein Gedächtnis! Na, besser, als wenn’s welche aus den Amorsälen gewesen wären.“
„Das sagte ich mir auch. Sie mögen daraus ersehen, Herr Geiger, dass ich schon immer etwas für das Volk übrig hatte. Um so leichter wird mir jetzt der Übergang auf das andere Geleis werden.“
„Sie hatten wohl damals so’n kleenen Tick wej, wie?“
„Ich schwamm in einem ganzen Meere von Ticks, bis ich eben auf dem Trockenen sass.“
„Und dann kam der Katzenjammer.“
„Und auch die Reue.“
„Ja, die kommt immer, wenn’s zu spät ist,“ sagte Gei ger und sann einen Augenblick nach.
Es ging ihm noch etwas im Kopf herum, das seine Bedenken wach hielt. Vor längerer Zeit war ihm nämlich ein Buch in die Hände gekommen, das den Titel, „Drei Monate Fabrikarbeiter“ führte, und worin irgend ein Schriftsteller, der sich als Arbeiter verdingt hatte, seine Erfahrungen zum besten gab. Wer konnte wissen, ob dieser junge Herr nicht eine ähnliche Absicht hatte und die vorgebrachten Dinge nur heuchelte. Der Schwindel in der Welt war gross. Es gab zwar bei ihm nichts zu „enthüllen“, immerhin aber hatte jede Fabrik ihre kleinen Geheimnisse, die man nicht gern an die grosse Glocke gebracht sah. Es war doch auffallend, wenn ein bisher verwöhnter Mensch, der sicher andere nützliche Dinge hätte treiben können, gerade Arbeiter werden wollte, ausgerechnet in seiner Fabrik. Und er machte kein Hehl aus dieser Ansicht und meinte, dass er sich die Sache noch sehr überlegen müsse.
Tempel dachte einige Augenblicke nach, ob er Geiger sogleich mit der ganzen Wahrheit kommen solle, die fernab von dessen Vermutungen lag. Dann aber hielt er es für besser, darüber zu schweigen, was ihm um so leichter wurde, da dem zukünftigen Brotgeber weder Nachteil noch Unannehmlichkeiten daraus erwachsen würden. Um ihm aber das letzte Misstrauen zu nehmen, versicherte er aufs neue mit bewegten Worten, dass es ihm nur darum zu tun sei, durch harte Selbstprüfung zu einem arbeitssamen Menschen zu werden.
Solle er Stadtreisender werden? Oder Versicherungsagent? Nein. Dadurch würde er sich dem Gespötte seiner Freunde aussetzen und Gefahr laufen, ins alte Bummelleben zu kommen, wenn auch auf andere Art. Oder solle er vielleicht nach Amerika gehen, um dort zu verkommen? Nein, nein! Er hänge mit grosser Liebe an seiner Mutter, die über diese Trennung höchst unglücklich werden würde und vor Gram sterben könnte. Er sei dafür, im Lande zu bleiben und sich ehrlich zu ernähren. Hier draussen in der Fabrik würde ihn niemand von seiner alten Gesellschaft zu sehen bekommen, und so könne er sich mit Duldung und Behagen in die neuen Verhältnisse fügen. Sei es überhaupt eine Schande, harte Arbeit zu treiben? Das müsse Herr Geiger, von dem es ihm bekannt sei, dass er sich aus kleinen Verhältnissen, durch eigene Kraft, zu Reichtum und Ansehen emporgerungen habe, doch wohl am meisten anerkennen.
Damit hatte Tempel die schwache Seite Nantes berührt, wodurch er gewöhnlich zu haben war, denn Geiger gehörte zu den offenen Naturen, die ihre Vergangenheit nicht zu verleugnen pflegen, vielmehr sich ihrer beizeiten mit einem gewissen Stolz zu erinnern wissen.
„Was Sie da sagen, lieber Freund, hat ja vieles für sich,“ warf er schmunzelnd ein, ersichtlich bestrebt, über das empfangene Lob nunmehr mit Anstand zu quittieren. Wenn Geiger schon „lieber Freund“ sagte, so war sicher anzunehmen, dass sein Widerstand bereits halb bezwungen war.
„Haben Sie nicht sonst noch Referenzen?“ fragte er dann, schon fertig mit seinem Entschluss.
„O, eine ganze Menge,“ erwiderte Tempel, „aber Sie werden es erklärlich finden, wenn ich unter solchen Umständen keinen Gebrauch davon machen möchte. Man zeigt sein Skelett nicht gern den alten Freunden .... Wie wäre es denn, wenn Sie sich hier in meiner Gegenwart telephonisch mit dem Herrn Justizrat in Verbindung setzen würden? Dann müsste Ihnen doch jedes Misstrauen schwinden. Ich bitte sogar darum.“
Geiger hatte schon daran gedacht, sich aber geniert, es auszusprechen, um seinem Zweifel nicht auch noch die beleidigende Form zu geben. Nun jedoch liess er sich sofort an seinem Schreibtisch nieder, setzte den losen Apparat des Fernsprechers an Mund und Ohr und redete darauf los. Er hatte das Glück, den Justizrat vorzufinden, und so gab er seiner Stimme einen anderen Tonfall, wobei er unwillkürlich eine kleine Verbeugung machte, als hätte er den alten Herrn persönlich vor sich.
Tempel fand das so komisch, dass er sich sein Lachen verbiss. Dann vernahm er nur, was Nante mit ausgesuchter Höflichkeit, so in seinem saloppen Berlinisch hineinrief; aber aus seiner Miene, besonders aus der Art und Weise, wie er die hellen Augen aufriss, beim Zuhören unaufhörlich nickte, dann wieder den Kopf wiegte, lächelte und einen Indianerruf ausstiess, glaubte Tempel auf die Antwort schliessen zu können. Und fast war es ihm, als hörte er die etwas krächzenden Laute seines Gönners, der ihm als einer der Testamentsvollstrecker seines Onkels den Weg zu diesen Gemütsmenschen hier gewiesen hatte. Hoffentlich hatte der Alte keine Dummheit gemacht und zuviel gesagt, dann wäre es mit dem Maskenspiel hier vorbei.
„Jut, jut, Herr Rat, soll bestens besorgt werden,“ tutete Geiger zum Schluss noch hinein. „Danke, danke. Gleichfalls, gleichfalls.“
Dann stapfte Herr Nante Geiger vorerst auf seinen kurzen Beinen im Zimmer umher, wobei er seinen soliden Bauchansatz, umspannt von einer buntgetüpfelten Modeweste, etwas wackelnd nach Seemannsart, wiederholt der geöffneten Kontortür zutragen musste, weil von dort her allerlei kleine Anfragen kamen, natürlich stets nach einem respektvollen Klopfen. Alsdann zündete er sich eine grosse, dicke Zigarre an, zog sich seine schottisch-karrierte Hausmütze über die Sardellenlichtung auf dem Schädel, und steckte dann das runde Apfelgesicht durch das kleine Fensterchen ins Kontor hinein.
„Herr Neumann, ich geh’ mal nach der Fabrik. In ’ner halben Stunde bin ich wieder hier. Fräulein Mücke kann später zu Tisch gehen.“
Er meinte damit die „Klapperschlange“, die das Stenogramm nach seinem Diktat aufzunehmen hatte.
Dann bat er Tempel, ihm zu folgen.
Zu seinem Mitgefühl kam auch die Klugheit, denn dieser schon etwas lädierte junge Mann hatte durch sein einnehmendes Wesen einen derartig günstigen Eindruck auf ihn gemacht, dass er sich der Einbildung hingab, er werde aus ihm etwas formen können, das auch ihm von grossem Nutzen sein würde: einen sogenannten Edelarbeiter, den man der Welt als Muster zeigen könne. Über ein solches Experiment hatte Nante Geiger schon oftmals nachgedacht, und hier winkte ihm die Erfüllung. Zwar kam ihm der ganze Fall noch immer etwas märchenhaft vor, aber auch in einem Märchen konnte eine gesunde Wahrheit enthalten sein.
„Haben Sie denn wirklich gar nichts gelernt?“ fragte er ihn dann noch zum Überfluss, als sie schon den Flur hinter sich hatten, und nun, an zwei mächtigen Rollwagen vorbei, über den ersten Fabrikhof schritten, dem rotgemauerten Hauptgebäude zu, dessen hundert mattgestrichene Fensterscheiben wie ebensoviele blinde Augen ins Leere starrten. Man verspürte die Arbeit schon, ohne dass man sie sah, denn das innere Erbeben des ganzen Hauses sandte seine verhaltenen Grolllaute dumpf durch die Mauer.
„Ich kann etwas zeichnen,“ erwiderte Tempel, „auch habe ich als Junge aus Brotteig allerhand hübsche Figucen geformt.“
Geiger lachte. „So’n Nussknacker haben wir wohl alle mal gemacht. Das wird Ihnen wohl nicht viel dienen; höchstens, dass Sie Geschicklichkeit in die Finger kriegen. Wenn Sie aber zeichnen können — das ist schon was. Da können Sie bald avancieren. Ich sagte immer: Wer zeichnen kann, der sieht mehr.“
Der grosse Torweg, der ihnen wie ein dunkles Maul entgegenklaffte, nahm sie auf. Dann umgab sie das lärmende Geräusch eines Fabriksaales, in dem alles in Tätigkeit ist.
Tempel, der vorsichtig hinter seinem Führer schritt, liess dieses Arbeitsorchester wie eine wilde, schlecht gestimmte Musik auf sich wirken, die sich unheimlich in die Ohren bohrt. Von der langen Reihe der Drehbänke an der Fensterflucht schrillten entgleiste Klarinettentöne auf, die ihm durch Mark und Bein gingen. Und hinein mischte sich das Surren und Summen der Treibriemen und ein leises, unaufhörliches Fauchen, das von einem unsichtbaren Ungeheuer auszugehen schien. Tempel sah eigentlich nichts Bestimmtes; er sah nur rasende Bewegungen an der Decke, schwarze, dahinschnellende Streifen und eine Garnitur blauer Blusen, auf der hell die Mittagssonne lag. Nur hin und wieder erhob sich ein Kopf, wandte sich ihnen ein neugieriges Gesicht zu, um sich aber gleich wieder über die Arbeit zu beugen.
„Nun, wie wird Ihnen? Haben Sie immer noch Lust?“ fragte ihn Geiger, als sie den ersten Saal hinter sich hatten und nun über den Flur über die andere Seite gingen.
„Ich danke, es geht,“ erwiderte Tempel verbindlich. „Ich bekomme jetzt erst recht Lust.“
„Na, und die Nerven —?“
„Die werden sich an die Symphonie gewöhnen müssen. Ein Geräusch hebt das andere auf.“
Und um dieses Thema nicht weiter auszuspinnen (denn in Wirklichkeit waren seine Nerven durchaus nicht abgestumpft), erging ec sich in Bewunderung über den grossartigen Betrieb, was Geiger so angenehm berührte, dass er ihm unaufgefordert Aufklärung über die verschiedensten Dinge gab, wobei er nicht vergass, wiederholt einzuwerfen: „Das ist noch gar nichts.“
„Sie wissen doch, dass ich Beleuchtungsartikel fabriziere,“ sagte er dann, als sie wieder ins Parterre hinunterstiegen. Und er fügte hinzu, dass er heute nicht mehr die Zeit habe, dem Neuling den ganzen Betrieb zu zeigen, der sich noch im zweiten Hof weiter fortsetze, und von dem man bis jetzt nur einen kleinen Teil gesehen habe. Alles das werde ja Tempel nach und nach noch zu Gesicht bekommen, wenn es ihm ernst mit dem Aushalten sei.
Sie durchschritten mehrere kleinere Werkstätten und kamen dann in einen Raum, in dem Rohmaterialien aufgestapelt waren und an einem kleinen Pult der Verwalter sass, ein Mann mit einem Lockenkopf, der in seinem ganzen Aussehen, auch in seiner Kleidung, ein Mittelding zwischen Kontorist und Werkführer war.
„Peters, hören Sie mal,“ begann Geiger mit gespitztem Munde, „dieser Herr hier wird vom Montag ab als Lohnarbeiter eingestellt, verstehen Sie? Es liegt ihm daran, irgend eine ihm zusagende Beschäftigung zu erhalten, um sich mit der Branche vertraut zu machen.“ Das fiel ihm so ein, um eine Erklärung dafür zu finden. „Hier unten wird sich das am besten machen, sprechen Sie einmal mit Knox, ich kann ihn nicht finden.“
Und er stellte Tempel dem anderen kurz vor und behandelte dann die Sache rein geschäftsmässig.
Peters, der dahinter einen guten Bekannten seines Chefs witterte, schüttelte sich die Mähne aus der Stirn und machte seine Verbeugung vor Tempel. Dann gab er ihm rasch die nötigen Anweisungen für sein Erscheinen am Montag.
„Lassen Sie sich wieder mal die Haare schneiden, Peters,“ sagte Geiger noch, was er jedesmal tat.
Als er dann mit Tempel wieder hinausging, schlug es gerade zwölf, und die Arbeiter strömten aus allen Türen ins Freie.
Im Torweg, auf einem Handwagen, stand ein Bursche und sprach etwas Putziges zu einer Horde gleichaltriger Jungen, worüber die ganze Bande lachte.
„Das ist unser Faxenmacher,“ sagte Geiger so im Vorübergehen, ohne der kleinen Szene weiter Bedeutung beizulegen.
Auf dem Hofe empfahl er sich durchaus höflich.
Tempel bedankte sich für das freundliche Entgegenkommen und zog tief den Hut.
Dann liess er sich von dem schwarzen Menschenstrom hinaustragen auf die Strasse, so mit dem traurigen Bewusstsein eines Menschen, der bald auf lange Zeit hinaus in diesem Strome untergehen wird.