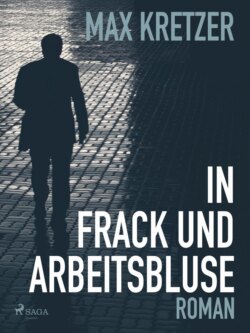Читать книгу In Frack und Arbeitsbluse - Max Kretzer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV.
ОглавлениеWenn Berlin an einem dunklen Novembermorgen die Augen aufreisst und die Strassen voller Nebel sieht, dann beginnt es zu fluchen. Alles flucht: der Kutscher auf dem Bock, der Strassenbahnführer, der Chauffeur, der Milchhändler, die Zeitungsfrau und natürlich auch der Schutzmann, der seinen Scharfblick von Staats wegen hat und sich auf seinem Posten wie genarrt vorkommt. Selbst der Bäckerjunge verliert die Lust zum Pfeifen, was in dieser grauen Humorlosigkeit am bedenklichsten erscheint.
Waldemar Tempel war dieser Berliner Frühnebel nicht unbekannt, aber bisher hatte er ihn nur flüchtig bemerkt, wenn er den kurzen Weg von einem glänzenden Ballokal bis zur Droschke und dann aus der Droschke in sein Haus nahm. Es konnte auch ein Restaurant sein oder sonst irgend eine behagliche Stätte, von der man nach süssem Vergnügen die Müdigkeit mit ins Bett nimmt. Dann hatte er auf ein paar Augenblicke den Nebel geschluckt, so wie man die Dampfwolke einer schlechten Zigarre an sich vorüberziehen lässt. Der Wagen war geschlossen, und er sah nicht mehr, was da draussen vorging.
Nun aber, an diesem denkwürdigen Montag, der ihn hinaus ins Ungewisse führte, trat der umgekehrte Fall ein: er musste den Nebel aufsuchen, statt ihn zu fliehen, er musste gleich hunderttausend anderen mit wachen Sinnen in dieses ungeheuere, graue Meer untertauchen, das Wagen und Menschen verschlang.
Eine neue Stadt glaubte er zu entdecken, allerdings eine, die sich ihm erst schrittweise zu erkennen gab. Und ungewohnt dieser Erscheinung, riss auch er die Augen auf, gleich diesem mürrischen Ungeheuer, das mit tausend umflorten Lichtern blinzelte, die, hängenden Glühkörpern gleich, allmählich erst wie irritierende Feuerpunkte aus dem dicken Dunst hervorkrochen: seltsam und märchenhaft, wie zerstreute Notsignale auf dicht verhüllter Meeresfläche. Und dieses Steinmeer ohne schwankenden Boden hatte auch sein dumpfes Rauschen und Grollen und seine dahinwogende Flut, die aus erwachsendem Strassenlärm und aus dahinziehenden Menschenleibern bestand. Und gleich den Warnungssignalen der Schiffe erschallten unausgesetzt das Töfftöff der Autos und das rasende Glockenschlagen der Elektrischen.
Aber Waldemar Tempel fluchte nicht wie die Gewohnheitsflucher, denn er war starr und sprachlos: erstens über dieses allgemeine Rühren zu so früher Morgenstunde, und zweitens über das unerhörte Ereignis, dass er es fertig bekommen hatte, um fünf Uhr aufzustehen, sein Paket unter den Arm zu nehmen und sich aus dem geschlossenen Hause hinauszuschieben, gleich einem armseligen Reisenden, der mit dem Frühzug fort muss und nicht einmal ein Handköfferchen sein eigen nennt. Aber niemand hatte ihn gesehen, selbst die beiden Männer nicht, die aus dem Nebeneingang an ihm vorübereilten.
Er ging erst ein Stück Weges, oder vielmehr: er tappte sich eilig durch den Nebel, fröstelnd, noch den halben Schlaf im Kopf, aber doch schon merkwürdig flink auf den Beinen. Vor sich und hinter sich hörte er Schritte, ohne dass er die Menschen sah. Hin und wieder gähnte ein erleuchteter Bäckerladen, in dem eine Mamsell träge sich rührte. Er sah den Lichtschein schon am geröteten Nebel. Die Strassen wurden belebter, und immer häufiger tauchte eine dunkle Gestalt auf wie aus der Erde gewachsen, durch die Plötzlichkeit in übermenschlicher Grösse erscheinend.
Wie ein ungeheurer, gespensterhafter Schatten wuchs ein Kirchturm in die Luft, den er im Augenblick nicht gleich erkannte. Das Hufeisen eines Pferdes schlug auf; er hörte das Schnauben und sah das Geistergefährt in Wolkenfarbe an sich vorüberziehen.
Dann sass er in der Strassenbahn, Linie Schlesisches Tor, und wunderte sich, wie viele Fahrgäste der Wagen schon hatte. Es waren auch Mädchen darunter, und jedes hatte die eingewickelten Stullen im Schoss. Aber alle, Arbeiter und Arbeiterinnen, starrten wortkarg vor sich hin. Eine alte Frau, ganz in ein Kopftuch vermummt, eine offene Markttasche zur Seite, aus der der Kopf einer Flasche ragte, sass in der Ecke und schlief. Jedenfalls kam sie von der Nachtarbeit und fuhr nach Hause. Und neben ihr sass ein eleganter Bummler, die Beine von sich gestreckt, den Hut ins Genick gedrückt, und schnarchte mit offenem Munde. Ähnliche Schlummerfahrten während seiner Studentenzeit fielen Tempel ein; jetzt aber, mit klaren Augen, kam ihm dieser Anblick unwürdig und ekelhaft vor.
Dann, beim gleichmässigen Rollen des Wagens, das etwas Beruhigendes für ihn hatte, liess er die häusliche Morgenszene noch einmal an sich vorüberziehen. Er sah die Mutter, notdürftig bekleidet, an seinem Bette stehen, und ihn mit aufgelöster Stimme fragen, ob er doch nicht lieber liegen bleiben wollte. Sie weinte und jammerte, als würde er zur Hinrichtung abgeholt werden. Aber es half nichts: sie musste sich an die Kaffeemaschine machen, die sie am Abend vorher schon bereit gestellt hatte, denn das Mädchen durfte bei Leibe nichts von dem Vorgang wissen, wenigstens vorläufig nicht, bis man eine Ausrede gefunden hatte. Denn die klatschte im ganzen Hause herum, und gewiss hätte man es so ausgelegt, als wäre bei Tempels schon die grösste Armut eingezogen. Im übrigen höffte Frau Baumeister noch im stillen, dass ihr Sohn am ersten Tage genug davon haben und reuig zu den fünftausend Mark zurückkehren würde.
Aber Waldemar blieb fest, und so kam der Abschied mit Tränen und Verwünschungen gegen den „Kerl von Onkel“, der sich den ganzen Plunder lieber in den Sarg hätte mitnehmen sollen.
„Manteuffelstrasse!“
Der Schaffner rief es, und Tempel stieg mit aus, um von hier aus den nächsten Weg zu Geigers Fabrik zu nehmen. Es dauerte nicht lange, so liess er sich von dem schwarzen Strom der Arbeiter mit forttragen, hinein in das breitklaffende Maul des roten Ungeheuers, dessen hundert blinde Augen nun, schon sanft durchleuchtet, in den dunklen Morgen starrten.
Lagerverwalter Peters war noch nicht da, denn der kam immer etwas später. Dafür empfing ihn Werkführer Knox ein blatternnarbiger Mann mit spitzem, schon kahlem Schädel und abstehenden Ohren, der nicht recht wusste, was er mit ihm anfangen sollte. Dieser „Neue“ sah doch zu sehr nach einem Herrn aus, obwohl er sofort sein Paket aufgerissen hatte und grüne Schürze und blaue Bluse sehen liess (alles Dinge, die Frau Tempel am Sonnabend nach Mass gekauft hatte); aber auch diese Sachen hatten so einen gewissen Sonntagsgeschmack.
Verflixt, verflixt! Werkführer Knox, der die Stahlbrille immer weit auf der Nasenspitze trug, wenn er jemand fixierte, stand unschlüssig da, die Linke gegen die Hüften gestemmt, während der Zeigefinger der Rechten eine kleine Juckerei auf dem Schädel vornahm, was immer das Signal zum Gedankensammeln war. Jedenfalls war es diesmal das Kennzeichen eines kritischen Falles.
Endlich kam die Frage: „Wat sind Sie eigentlich von Fach, Herr ....?“
Lagerverwalter Peters hatte ihm schon das persönliche Interesse des Chefs an diesem „Feinen“ gesteckt, und so fehlte ihm die rechte Traute.
„Jar nischt,“ fiel Tempel gleich im Werkstatton ein, aber doch mit einer gewissen liebenswürdigen Verbindlichkeit.
„Na ville is det jerade nich,“ sagte Knox gemütlich und juckte seinen Schädel weiter. Eigentlich hätte er ja grob werden müssen, aber an diesen Menschen war nicht heranzukommen, denn er hatte so „etwas“. Verflixt, verflixt!
„Es bleibt ooch nischt übrig, wenn man wat davon abzieht“, berlinerte Waldemar drauf los, wobei er sich seiner etwas rüdigen Jugendzeit erinnerte, als er auf dem Tempelhofer Felde die Drachen steigen liess.
Im Lagerraum nebenan, dessen Tür offen stand, lachte ein Bursche hell auf.
Und sofort schoss Knox auf die Türe zu.
„Behalt deine Lache für dich, Ede, verstehst de!“ rief er hinein. „Die Sache is jar nich so lächerlich.“
Schon vorher hatte Tempel ein Plantschen und Schrubben da drinnen gehört, und als er nun ebenfalls einen Blick hineinwarf, sah er einen jungen Menschen stehen, der damit beschäftigt war, die Dielen aufzuwischen. Er wäre ihm wohl fremd geblieben, wenn Werkführer Knox nicht wie zur Entschuldigung hinzugefügt hätte: „Det is nämlich Ede, unser Faxenmacher, damit Sie’s man gleich wissen. Denn der wird Ihnen wohl bald was vormachen. Sonst ’n juter Junge, bloss togen tut er nischt.“
„Wer’s glaubt, der wird selig und isst de Klösse fröhlich,“ klang eine klare Stimme zurück, so mit einer gewissen hochgeschraubten Betonung.
„Dichten tut er ooch“, sagte Knox wieder. Und dann kam wieder die Belehrung ins Nebenzimmer: „Hier brauchst de keene Vorstellung zu jeden, det mach’ abends ab.“
„Herr Geiger war schon so freundlich, mich auf dieses Talent aufmerksam zu machen,“ warf Tempel ahnungslos ein.
Da zeigte sich das hübsche Gesicht des Jungen im Türrahmen. Sein grosses Auge ging verdutzt auf den Fremden, dann aber huschte ein verklärtes Lächeln über die blassen Züge.
„Da hören Sie’s doch, Herr Knox,“ sagte er frischweg.
Nu haben Se aber wat anjerichtet,“ meinte der Werkführer etwas kläglich und nahm das Jucken wieder auf. „Na, dann kommen Se man mit,“ sprach er weiter und ging Tempel voran in den hintersten Raum, der klein und noch dunkel war.
Die gemütliche Unterhaltung hatte ihm endlich den Mut gegeben, sich seiner Herrschaft hier zu erinnern.
Um acht Uhr erst, als die Frühstückspause begann, kam Tempel einigermassen zur Besinnung.
Man hatte ihn an ein kleines Balancier gesetzt, wo er zierliche Rosetten „drücken“ musste. Das ging sehr schnell und war eigentlich eine Spielerei, die anderswo Mädchen verrichteten. Hier machten es gewöhnlich die Jungen. Es war sehr einfach: man legte die runde Messingblechscheibe auf die Matrize, nahm den Griff des Balanciers und drehte los, so dass die Kugel herumflog. Dadurch senkte sich der Stempel und presste die Form. Es gehörten nur Übung und Geschicklichkeit dazu, um eine hübsche Portion Arbeit zu verbringen.
Werkführer Knox, der sich keinen anderen Rat wusste, hatte ihm diese Beschäftigung zugeteilt, damit er einmal sehe, wie dieser Sonderling sich anstelle. Mochten die Herren vom Kontor dann weiter ihre Order geben.
Und nun sass Tempel auf seinem Sessel und ass die belegten Brote, die, sauber in weisses Papier eingewickelt, ihm seine Mutter mitgegeben hatte. Und merkwürdig, es schmeckte ihm, denn das Frühaufstehen und die Arbeit hatten ihm Appetit bereitet. Nur in seinem Kopfe sah es dämlich aus, wie er sich gestehen musste. Und in seinem rechten Arm, besonders am Ellenbogengelenk, fühlte er eine Art Erschlaffung, die er beinahe mit einer Lähmung verglich. Es war ihm, als würfe er noch immer das Ding da hinter sich herum, trotzdem er doch ganz stille sass.
Schon während seiner Arbeit hatte er bemerkt, dass hin und wieder jemand in den abgelegenen Raum kam und in dem Regal irgend etwas zu suchen schien, dann aber wortlos wieder verschwand. Und nun liessen sich gleich mehrere Leute zusammen sehen. Es waren Neugierige, aus den Nebenwerkstätten, die sich den „Feinen“ begaffen wollten. Denn so hatte Knox ihn sogleich getauft und hinzugefügt, dass das ein „Vollongtöhr“ sei, der sich das Arbeiten „angewöhnen“ wolle.
Zwischen zehn und elf tauchte auch Herr Geiger auf, der ein fabelhaftes Gedächtnis für alle Vorgänge in seiner Fabrik hatte, und an diesem Vormittage sich auch gleich dieses merkwürdigen Arbeiters entsann. Tempel hörte seine laute Kommandostimme schon durch die Tür, und so erhob er sich denn sofort, als der Chef mit dem Werkführer eintrat.
Wie gewöhnlich steckte Nante in seinem modernen, blauen Cheviotsakko, wozu die dunkelrote Krawatte ihr knallendes Farbenspiel gab, denn er gehörte zu jener Sorte Emporkömmlinge, die äusserlich nicht als „Schuster“ gelten wollten, wenn sie ihn auch sonst nicht ganz ablegen konnten.
Nante lachte schon bei seinem Morgengruss: „Bleiben Sie nur ruhig sitzen, so was jibts hier nich bei der Arbeit,“ sagte er dann. „Kostet nur Zeit — so’ne überflüssige Höflichkeit. Wenn hier alle aufstehen wollten vor mir, — wär ’ne schöne Bammelparade.“
Die Zuvorkommenheit Tempels berührte ihn aber doch angenehm, und so blieb seine Gemütlichkeit auf der Höhe. Er prüfte die Arbeit, drehte sie nach allen Seiten und sah dann ein Weilchen zu, wie Tempel schaffte.
„Na, es geht ja, allabonnöhr,“ fing er an zu loben. „Knox hat mir schon gesagt, dass Sie sich gut anstellen. Fleiss ist die halbe Arbeit. Man sieht doch gleich was Intelligenz ist und was die Bildung macht. Ich sage immer: ein offener Kopp geht, in die Hände.“
Das war so eine seiner Sentenzen, die er in seinem Betriebe gern zum besten gab.
Und er sagte zu Tempel, dass er ihm, wenn er sich weiter so bewähre, vorläufig zwanzig Mark Wochenlohn geben wolle, und beauftragte Knox, das Lohnbuch danach anzulegen.
Dieser Mensch tat ihm nicht nur leid, sondern bewegte wieder seinen Gedanken über den „Edelarbeiter“. Und so musste er sich persönlich um ihn bekümmern.
Und als er den Dank Tempels dafür eingesteckt hatte, ging er wieder, diesmal aber durch den Lagerraum, von wo aus seine Stimme noch zurückschallte: „Peters lassen Sie sich die Haare schneiden. Sie werden noch schielen lernen.“
Er wusste zwar, dass es doch nichts helfen würde, aber es schadete nichts, wenn er es immer wieder sagte.
Die Fabrikpfeife pfiff die Mittagsstunde, und Tempel wusste kaum, wie schnell ihm die Zeit vergangen war. Er wusch sich die Hände, zog sich die blaue Bluse von seinem Oberhemd und würgte sich rasch den Kragen um, denn um halb zwei Uhr hatte er wieder anzutreten. Werkführer Knox, der immer den Bevorzugten sah, meinte zwar, er könne ja etwas später kommen, aber Tempel lehnte dankend ab mit dem Bemerken, dass er sich der Fabrikordnung fügen wolle.
Eine Art Fanatismus war über ihn gekommen, die Aufgabe nach dem Testament zu erfüllen, und sollte es ihm die halben Knochen kosten. Nicht nur seiner Mutter wegen, sondern auch um Lüssis willen, der er in seiner Pein liebevoll geschrieben hatte, er müsse auf acht Tage verreisen und werde dann am nächsten Sonntag wieder erscheinen. Mochte sie das als kleine Strafe für ihr Misstrauen betrachten, aus dem er sich übrigens nicht mehr so viel machte.
Donnerwetter ja, — es war doch keine Kleinigkeit, plötzlich so das Bewusstsein zu haben: du trägst die Anweisung auf eine halbe Million in der Tasche, du musst nur den Fälligkeitstermin abwarten. Liebte sie ihn wirklich, so brauchte sie nur ruhig mitzuwarten.
Auf das Geradewohl ging er in eine Schankwirtschaft in der Nähe, auf deren breiten Schaufenster die Worte „Billiger Mittagstisch“ prangten. Die Bezeichnung „Zum sauberen August“ hatte ihn besonders gelockt. Und in der Tat hielt der Dicke Vater Jäckel drinnen das, was er draussen angeschrieben hatte. Hinter dem grossen, ladenartigen Vorderraum, in dem es um diese Zeit nicht besonders lebhaft zuging, lag ein kleines Speisezimmer, zu dem eine Stufe hinaufführte. Vorn war so zu sagen mehr die Destille; hier durften sich bessere Gäste niederlassen.
Jäckel, der sofort einen „Besseren“ witterte, aber augenbl lich wie ein kleiner Elefant an seinem Bierapparat hantierte, gab sofort seiner drallen, rotwangigen Tochter den nötigen Wink. Und die dicke Trude watschelte denn auch auf den Gast zu, wobei ihre starken Hüften wie ein schwankendes Boot auf und nieder gingen.
„Kann man hier immer dinieren, schönes Fräulein?“ fragte Tempel so in der Galgenhumorstimmung, in die ihn dieser erste Vormittag versetzt hatte.
Trude musste diese Anrede aus solchem Munde lange nicht mehr gehört haben, denn sie strahlte ihr schönstes Vollmondlächeln aus, und was sie unter Erröten hervorlispelte, klang wie verschämt-verworrenes Zeug.
Viel angenehmer wurde dann Tempel von der Fülle dampfender Kartoffeln berührt, die ihm neben dem deutschen Beefsteak serviert wurde. Es war unverkennbar, dass sie es von Anfang an gut mit ihm meinen wollte.
„Mutter sagt eben, wenn der Herr hier immer essen täte, dann richte sie sich darauf ein,“ lispelte sie wieder, ersichtlich bemüht, als etwas Besseres zu erscheinen.
„Sehr liebenswürdig von Ihnen,“ sagte Tempel zum Danke.
Und „Mutter“ kugelrund wie Mann und Tochter, stand auch schon, die Hände über dem mächtigen Leib gefaltet, in der geöffneten Küchentür und nickte freundlich herein, ungefähr wie zu einem guten Bekannten.
„Dat is man heite wedder ’n bisken stille, weil’s Montag is,“ begann sie in der Mischmaschsprache der Zugezogenen, „da haben se noch alle am Sonntag zu knabbern, aber sonst hab’n wer janz schöne Mittagsjäste. Und was so de Techniker sind von de Fabriken, die sind ooch all’ mang. Nich wahr, Trudchen?“
Sie sah in dem neuen Gast etwas Ähnliches und wollte damit andeuten, dass er hier gut aufgehoben sei.
Und Tempel musste sich sagen, dass man sich hier für sechzig Pfennige nicht beklagen könne, was er sich damit zusammenreimte, dass eine Athletenfamilie jedenfalls am besten wissen müsse, wodurch man sich das Fett erhalte. Es war auch alles sehr mundgerecht aufgetragen, mit extra sauberer Serviette und auf einem reinen Tischtuch, das „Trudchen“, die diese zierliche Benennung nur in den Augen der Mutter verdiente, vorher ausgebreitet hatte. Und Tempel gelobte sich, auch hier auszuhalten, wo niemand ihn kenne und man an seiner zweiten Garnitur keinen Anstoss nehme.
Und während er hastig sein Essen verschlang und das dünne Bier dazu trank, und während der dicke August, genannt der Saubere, unten den Gästen aus dem Phonographen die Herbstparade auf dem Tempelhofer Feld samt Musik und Kommandotönen zum Besten gab, dachte er daran, was der Geheime, seine Gattin und die verwöhnte Lüssi dazu sagen würden, wenn sie ihn hier so im „Separee der Destille“ sitzen sehen würden, den Blick auf die Uhr gerichtet, damit er die aufgezwungene Tretmühle nicht versäume. Und die lieben Freunde erst! Die schönen Frauen seiner Bekanntschaft! Und der ganze elegante Vergnügungsrummel, in dem er sich bis jetzt bewegt hatte!
Aber Tempel dachte aufs neue: Lass’ sie denken, was sie wollen.
So verputzte er denn das Beefsteak mit Genuss, liess aus Anstand die Hälfte der Kartoffeln auf dem Teller und griff beim Bezahlen der lieben Trude in die runden Wangen, damit sie ihn bis morgen im Gedächtnis behalte: des reinen Tischtuchs und der sauberen Serviette wegen, und nicht minder mit Rücksicht auf die gute Verpflegung.
Als er am Sonnabend seinen Lohn in der Tasche hatte und um sechs Uhr auf die Strasse trat, kam er sich wie ein Held vor. Verschiedene Stufen der Empfindung hatte er durchgemacht: zuerst die Traurigkeit, dann die Neugierde, und zuletzt die Gleichgültigkeit.
„Stumpfsinn, Stumpfsinn, o du mein Vergnügen,
Stumpfsinn, Stumpfsinn, o du meine Lust,“
hatte er bei der geisttötenden Arbeit in Gedanken geträllert. Viel lieber hätte er von früh bis spät Knackmandeln und Rätsel gelöst, wozu er eine besondere Begabung besass.
„Na, wie geht’s dir denn, mein lieber Waldemar?“ fragte ihn seine Mutter, denn er wohnte in der ersten Woche noch zu Hause.
„Ausgezeichnet, liebe Mama,“ beruhigte er sie. „Solche Beschäftigung hat mir gerade gefehlt. Verflucht, kommt da das Blut in Bewegung.“
Zugleich aber reckte er sich und zog den Rücken einwärts, denn da oben am rechten Schulterblatt meldete sich das kleine Andenken vom Tage.
Und als dabei etwas knackte, bekam Frau Baumeister einen Todesschreck.
„Ich hab’s dir gleich gesagt, dass du’s nicht aushältst. Waldemar, du machst mir was vor! Du siehst ja auch ganz blass aus, — wirklich. Und heisse Hände hast du auch ... und um die Augen Ränder.“
Das sah sie natürlich nur mit den Augen der Angst und der Liebe, denn eigentlich mochte er schon einen besseren Eindruck. Sofort riet sie zu kalten Umschlägen, dem langjährigen Hausmittel der Tempels, und er musste erst den Fidelen spielen und sie ein paarmal im Zimmer herumschwenken, um ihr das Gegenteil zu beweisen.
Aber recht hatte sie doch gehabt: Arbeit war keine Schande, aber jeder hübsch an seinem Platze. Ein General konnte nicht Müllkutscher sein, und ein Müllkutscher konnte kein Armeekorps kommandieren. Jetzt sah er erst ein, wie leicht sich Onkel Karl sein Dasein gemacht hatte, als er mit der Serviette unterm Arm die Trinkgelder einnahm und dabei wie ein Pagode gedankenlos nickte. Und darüber hatten sich die lieben Nächsten beschwert!
„Na, da gehst du wohl heute noch ein bischen kneipen, nicht wahr?“ fragte dann Frau Tempel nach dem Abendbrot, als sie sich bei dem gesunden Appetit ihres Sohnes überzeugte, dass ihm wirklich nichts fehle. Denn sonst hätte der Magen wohl zuerst gesprochen.
Waldemar aber schüttelte mit dem Kopf. Er war hundemüde; und ausserdem hatte er sich mit seinen zwanzig Mark in der nächsten Woche einzurichten. Auch war die Halbmonatsmiete für das kleine Zimmer im vierten Stock in der Manteuffelstrasse zu bezahlen, das er sich am Tage vorher gemietet hatte, denn am Montag war gerade der Fünfzehnte.
Frau Tempel lachte. „Du tust ja gerade so, als wenn du wirklich von den paar Kröten leben müsstest. So schlimm steht’s nun doch noch nicht mit uns, ich war sparsamer als du. Und pass’ auf: mit dem Pensionat wird’s doch was.“
Dann aber wunderte sie sich doch, wie zähe er blieb. Ihr grösster Kummer aber war, dass er nun auch nachts fortbleiben und dass sie ihn dann nur des Sonntags zu sehen bekommen sollte. Denn sie war an das Zusammensein mit ihm so gewöhnt, dass sie schon mit Schrecken an die Trennung durch seine Verheiratung gedacht hatte, obwohl ihr immer der Trost von ihm geworden war, er werde sie dann ganz zu sich nehmen.
„Neugierig bin ich doch, wie lange dir dieses Leben behagen wird,“ fuhr sie dann fort. „Du müsstest dir ja geradezu eine neue Haut anschaffen. Du, mit deinen Bedürfnissen nach geistvoller Unterhaltung und Umgang ... Wenn ich jetzt schon deine Hände sehe, ganz rauh sind sie. Pass’ auf, du wirst richtige Pfoten kriegen. Ich werde dir Glyzerin mitgeben, damit du dir die Hände abends vor dem Schlafengehen ordentlich einreiben kannst. Tu’ das, hörst du? Das hilft.“
Am anderen Morgen, es war noch stockfinster, wachte er wieder um ein halb sechs auf, denn das Mädchen hatte wie gewöhnlich den Wecker auf diese Zeit gestellt, ohne in ihrer Zerstreuung an den Sonntag zu denken. Und so rasselte das Ding mit Höllenlärm los, bis Waldemar, emporgeschreckt aus einem süssen Traum (er hatte sich gerade mit Lüssi geküsst), erst allmählich zur Besinnung kam, denn eine Weile glaubte er, sich in der Fabrik zu befinden, wo er im Dunkeln eine Maschine gehen hörte.
Dann wetterte er über das „verdammte Mädel“ los, wartete das Ende der schönen Musik ab und legte sich wieder auf die andere Seite. Bis zehn Uhr streckte er seine Glieder, dann aber entsann er sich, dass er zu Testamentsvollstrecker Dietzel musste, um ihm das Lohnbuch vorzuzeigen.
Der Justizrat, wie immer liebenswürdig und zuvorkommend, sprach ihm seine Anerkennung über den „ersten Versuch“ aus und schien im übrigen schon Bescheid zu wissen. In der Tat hatte er sich auch schon in der vergangenen Woche telephonisch bei Geiger nach seinem „Schützling“ erkundigt und eine befriedigende Antwort erhalten.
Als Junggeselle, der mit einer alten, unverheiratet gebliebenen Schwester zusammenlebte, war er etwas Sonderling, was sich auch in seinem vernachlässigten Äusseren ausprägte. Er hatte sein Bureau neben der Wohnung in einem der alten Häuser der Schellingstrasse, der Geheimratsstrasse des alten Berlin, und führte kein Schild an seinem Hause. Er konnte sich das leisten, denn er stammte von vermögenden Eltern und gehörte zu den Anwälten der alten Schule, die nicht für jede Vertretung zu haben waren und nicht von allen Leuten überlaufen sein wollten.
„Entschuldigen Sie nur, dass ich Sie beim Frühstück empfange,“ krächzte er die Worte etwas undeutlich hervor, „aber seitdem Ihr guter Onkel tot ist, ist mir auch der halbe Sonntag verdorben, — wenigstens da draussen. Wir nennen nun einmal alle die Gewohnheit unsere Amme.“
Diese Klage hing damit zusammen, dass er als Naturfreund seit zwanzig Jahren die Gewohnheit hatte, den Sonntagvormittag zu einer Grunewaldwanderung zu benutzen, die ihn dann gewöhnlich nach Schmargendorf führte, wo er früher beim alten Tempel regelmässig eingekehrt war. Daraus waren dann die engeren Beziehungen entstanden, die der Tod durchschnitten hatte.
„Ich muss das erst überwinden, denn er fehlt mir,“ fuhr Dietzel fort. „Ich werde jetzt eben nach einer anderen Richtung hinsteuern müssen. Na, das nebenbei.“
Und während er von dem Sherry trank und das letzte harte Ei aufknackte, begann er des Besuchers Energie zu loben „Sie imponieren mir, ich finde kein anderes Wort. Nur aushalten, aushalten. Es wäre mir eine Herzensfreude, wenn ich den letzten Willen Ihres Onkels ganz in seinem Geiste vollstrecken könnte. Ja. Aber aushalten, wenn ich bitten darf. Denn man bohrt schon, das wissen Sie wohl. Viele Hunde sind eines Hasen Tod, na, und man betrachtet Sie eben als den Hasen. Der gute Herr Musdal, der neulich bei mir war, hat schon auf Ihr Fell gewettet. Aber ich denke, Sie werden es sich nicht abziehen lassen, wenigstens vor einem Jahre nicht. Dann können Sie ja damit machen, was Sie wollen. Also wie gesagt: nicht rückfällig werden in Ihren Neigungen. Haben Sie mal des Sonntags vormittags nichts Besseres zu tun, dann holen Sie mich ab. Vielleicht finde ich dann meinen Weg doch wieder nach Schmargendorf. Zu zweien geht sich’s angenehmer.“
Damit erhob er sich, klappte sich den Schlafrock übereinander, der ihm unzertrennlich von seiner Morgenbequemlichkeit war und begleitete Tempel bis zur Tür, immer Gentleman, auch in der Unterhose.
Erst zu Nachmittag hatte sich Tempel bei Reimers angemeldet, weil seine Mutter ihn zu Tisch haben wollte in der Meinung, er habe sich in der ganzen Woche da draussen nicht satt gegessen und müsse bei einem saftigen Braten alles dreifach nachholen.
Lüssi empfing ihn mit Vorwürfen, ihr keine Ansichtskarte von seiner Reise geschickt zu haben, wobei sie das Wort „Reise“ so spöttisch betonte, dass er sofort Bescheid wusste. Aber er entschuldigte sich damit, dass sie ja wisse, wie schreibfaul er sei, und dass seine Gedanken um so mehr bei ihr gewesen seien. Darin log er wenigstens nicht.
Sofort platzte sie los: „Schwindel, Schwindel. Du warst ja gar nicht verreist. Du bist ja gesehen worden.“
„So,“ erwiderte er gefasst, „dann habe ich sicher einen Doppelgänger.“ Aber es wurde ihm doch etwas unheimlich zu Mute, denn wie sollte er sich ausreden, wenn es sich bestätigte! Er wäre vielleicht jetzt endlich mit der Wahrheit herausgekommen, wenn er nicht im selben Augenblick die Tasten des Flügels im Salon anschlagen gehört hätte. Und gleich darauf hatte er das zweifelhafte Vergnügen, von dem unvermeidlichen Assessor Lönge begrüsst zu werden. Nun nicht, dachte er in dem ihm eigenen Trotz, und nahm sich vor, alles getrost an sich herantreten zu lassen. Er war nun einmal der reiche Mann auf Sicht und wünschte, als solcher auch respektiert zu werden.
Dieser Meinung aber schien Frau Reimer nicht zu sein, die sogleich die Gelegenheit wahrnahm, ihn im Salon festzuhalten, nachdem Cousin und Cousine so von ungefähr hinausgeschlüpft waren.
„Was geht denn nur eigentlich vor, bester Herr Tempel,“ begann sie in ihrer liebenswürdigen Weise. „Sie schieben eine Reise vor und bleiben einfach in Berlin. Mein Mann ist ausser sich.“
Der Geheimrat war in solchen Dingen immer „ausser sich“, ohne es jedoch selbst an die richtige Adresse zu bringen.
„Ich gebe diese kleine Notlüge zu, aber es geschah nur im Interesse Lüssis,“ erwiderte Tempel ruhig.
„Etwas Ähnliches haben Sie schon neulich angedeutet,“ fuhr sie fort. „Wenn das alles wahr ist, dann kann ich doch auch wissen, was dahinter steckt. Sprechen Sie doch, bitte, ganz offen zu mir.“
„Ich kann nur dasselbe sagen, Frau Reimer, was Lüssi bereits weiss, dass ich leider erst in einem Jahre imstande sein werde, sie zu heiraten.“
„Also ist’s doch wahr!“ Frau Reimer wurde ganz gegen ihre Gewohnheit beweglich und rauschte durchs Zimmer, so dass das Parkett knarrte.
„Leider erfordern es die Umstände, die ganz wider Erwarten eingetreten sind. Ich habe dafür vielmals um Verzeihung zu bitten.“
Frau Geheimrat vermochte sich schwer zu beruhigen. „Aber das ist ja geradezu schrecklich ... darauf waren wir ja gar nicht vorbereitet. Ein Jahr noch, ich bitte Sie! Dann kann doch von einer öffentlichen Verlobung noch gar nicht die Rede sein. Wer wartet denn so lange mit der Hochzeit. In unseren Kreisen kommt das gar nicht vor.“
„Das würde ich ganz Lüssi überlassen .... natürlich auch ganz Ihrem gütigen Ermessen — und dem Ihres Herrn Gemahls.“
„Eine so lange verlobte Braut, ich bitte Sie!“ unterbrach ihn Frau Reimer und rang unwillkürlich die Hände. „Was wird man davon denken .... Wollen Sie mir nicht sagen lieber Herr Tempel, worin die Hindernisse eigentlich bestehen?“
„Natürlich nur in den, augenblicklichen Verhältnissen,“ erwiderte Tempel kühn. „Ich muss mir Haus und Villa erst verdienen.“
Frau Reimer starrte ihn wie einen Verrückten an; alsdann aber lachte sie, so wie man lacht, wenn die eigene Rede stockt.
„Oder vielmehr, ich muss mich dieses Besitzes erst würdig zeigen,“ fuhr Tempel indessen unbeirrt fort, „denn vorhanden ist beides schon. Ich erlaubte mir, neulich schon davon zu sprechen.“
„Ja, aber doch in ganz anderer Weise,“ warf Frau Reimer ein. „Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Tempel, aber ich werde daraus nicht klug ... Was treiben Sie denn jetzt eigentlich?“
„Ich arbeite von früh bis spät, um weiterzukommen. Daher auch meine Unsichtbarkeit in voriger Woche.“
„Sehr ehrenwert, aber deshalb hätten Sie uns doch nicht so zu vernachlässigen brauchen, mein Bester .... Sie haben wohl schon neue Baupläne?“
„Das auch.“
Er log nicht, denn in der Tat trug er sich schon jetzt mit allerlei Plänen, was er machen würde, wenn er erst im Besitze des grossen Vermögens sein würde.
„Das auch? Es klingt wirklich seltsam, was Sie da alles sagen .... Darf man Sie einmal in Ihrem Atelier besuchen? Sie sagten doch schon vor Wochen, dass Sie es verlegen wollten.“
Aber dann nur Sonntags, Frau Geheimrat, wenn ich bitten darf, in der Woche ist es unsicher. Man ist zu viel unterwegs ....“
Er schöpfte Atem, als Frau Reimer darin nichts Besonderes erblickte und es auch ganz richtig fand, als er bat, man möge es nicht übel deuten, wenn er von jetzt ab in der Woche nicht so regelmässig erscheine wie sonst. Kommt Zeit, kommt Rat, dachte er, während Frau Reimer durch diesen Hinweis auf seinen Fleiss wieder einigermassen mit der erlebten Enttäuschung versöhnt wurde.
„Ich denke, wir lassen das alles bis nachher, wenn wir allein sind,“ sagte sie wieder, „denn mein Neffe muss bald fort. Was mich betrifft, lieber Herr Waldemar, so wissen Sie ja, wie gern ich Sie habe. Aber Lüssi ist nun einmal ein bischen komisch.“
„Das merke ich, besonders seitdem Ihr lieber Cousin hier aus- und eingeht,“ warf Tempel erbost ein, denn von irgendwoher hörte er wieder ihr helles Lachen erschallen, das ihm zu denken gab.
„Ach, der zählt ja gar nicht, wenigstens nicht so, wie Sie es denken,“ beruhigte sie ihn als kluge Frau, die immer mit zwei Möglichkeiten rechnete. „Das sind so Kindereien zwischen Cousin und Cousine, die sich von klein auf kennen.“
„Hoffentlich,“ bemerkte Tempel trocken.
Es kam aber auch nachher, als die vier beisammen sassen, nichts besonderes heraus, was zur Klärung der Angelegenheit hätte dienen können. Lüssi hatte ihrer Mama einen Wink gegeben, damit lieber bis zum Abend zu warten, an dem der Papa nicht zu Hause sein würde. Heute war der Geheimrat nicht gut aufgelegt, weil er in der Nacht schlecht geschlafen und nachmittags nicht geruht hatte. Mancherlei Sorgen drückten ihn, und so liess er, scheu wie er immer war, wenn die Behandlung delikater Dinge in Aussicht stand, nach dem Abendbrot noch ein paarmal die Beine knacken und verzog sich dann in sein Arbeitszimmer, um an seinem dicken, statistischen Werk weiter zu arbeiten, das er schon seit einem Jahre unter der Feder hatte.