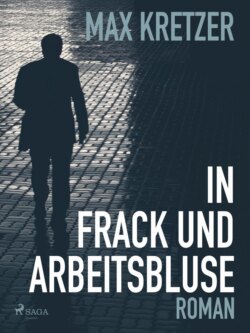Читать книгу In Frack und Arbeitsbluse - Max Kretzer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеUnd nun wunderte sich Waldemar Tempel, wie leicht ihm der erste Schritt geworden war. Aber je mehr er sich wieder dem heiteren Westen näherte, je stärker kam ihm das stille Grauen vor dem Joch da draussen. Nicht die Arbeit schreckte ihn, denn etwas Ernstes hätte er nun doch treiben müssen, aber das Ausgeben der persönlichen Selbstbestimmung, das verfluchte Muss, das Einschirren in die früh geöffnete Tretmühle, denn er war gewöhnt daran, lange zu schlafen und sich die Zeit nach Wunsch einzuteilen.
Dieser Meinung war auch seine Mutter, als sie sich bei Tisch gegenübersassen in dem noch immer eleganten Heim in der Geisbergstrasse, in einem der Häuser, das noch der selige Architekt erbaut hatte. Während der letzten zehn Jahre hatten sie in diesem sogenannten bayerischen Viertel die Rolle von Trockenbewohnern gespielt, das heisst: sie hatten sich in jedem vollendetem Neubau des Alten stets zuerst festgesetzt, damit Gardinen an die Fenster kämen, und zwar so lange, bis das Haus in anderen Besitz übergegangen war und ein Einzug in die neueste, noch feuchte Schöpfung des genialen Häusererzeugers winkte.
„Verzichte auf alles und nimm die fünftausend Mark, dann wird’s auch gehen,“ sagte sie mit ihrer ewig klagenden Stimme, und begann sofort, ihre Pläne daran zu knüpfen. Man werde sich zum ersten Januar, da man doch ziehen müsse, eine Wohnung in der Nähe des Zoologischen Gartens nehmen und ein Pensionat für Ausländer aufmachen, das bei guter Haushaltung sicher florieren werde. Dann würde sich auch wohl etwas für ihn finden, und wenn nicht anders, könne er ja einen Teil des Legats zu irgend einer Kaution benutzen.
Waldemar wurde ungemütlich.
„Das sprichst du wieder so hin, liebe Mama — in deiner Sorge um mich. Pensionate gibts hier wie Sand am Meer, und die meisten führen ein trauriges Dasein. Das weisst du doch von Frau Windmüller. Die paar Kröten würden draufgehen, und dann sässest du erst recht da. Na, und ich? Soll ich deinen Ausländern vielleicht die Stiefel putzen, um mich im Hause beliebt zu machen? Vielleicht Mister Mix pickles, der morgens um sieben schon nach „die w—uarme-Mundwuasser“ schreit, das Frühstück hineintragen? Oder gar Juffrouw van Houten aus Amsterdam, die um acht Uhr bereits das Klavier zerpaukt, „das Kakau“ vor die Tür stellen? Denn schliesslich werde ich dich doch nicht den Unausstehlichkeiten dieser anspruchsvollen Gesellschaft aussetzen lassen. Nee, liebstes Mamachen, — dann schon lieber die Zähne zusammen beissen und da draussen untertauchen .... Schwielen an die Hände kriegen und Messingstaub schlucken und was sonst noch .... Es ist ja auch schon abgemacht.“
Er hatte ihr alles gleich vor dem Essen berichtet, und nun, bei der Suppe, fügte er hinzu, dass er auch wahrscheinlich „auf bessere Schlafstelle“ werde ziehen müssen, denn Justizrat Dietzel, der ihm ja sonst sehr wohlwolle, wahrscheinlich infolge eines noch mündlich abgegebenen Wunsches des verstorbenen Onkels, habe ihn noch gestern ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass Testamentsvollstrecker Hagedorn, der alte Sandfresser, so genannt, weil er in Schmargendorf den Leuten das unfruchtbarste Land angeschmiert habe, schon geäussert habe, er werde über alles eingehend Protokoll führen. Der habe den ganzen Tag nichts zu tun, stecke seine grosse Nase in alle überflüssigen Dinge und fahre jetzt schon jeden Tag dreimal von Schmargendorf nach Berlin, wo er regelmässig gut frühstückte, alles auf Kosten seiner Bestallung.
Frau Mathilde Tempel gehörte zu den wundersamen Müttern, deren ganzes Leben im Glück ihrer Kinder aufgeht, so sehr sie selbst auch darunter zu leiden haben mögen, und so wenig die Welt das zu verstehen vermag. Schon in dem ewigen Auf und Nieder ihrer Ehe daran gewöhnt gewesen, ihrem schrullenhaften, an chronischem Spekulationsfieber leidenden Manne gegenüber in Ergebung die Nachsichtige zu spielen, hatte sich diese Schwäche auch allmählich auf ihren einzigen Sohn übertragen; und so war es erklärlich, dass sie in ihm seit dem Tode ihres Mannes den alleinigen Herrscher erblickte. Jetzt jedoch regte sich in ihr der Widerspruch, denn Ungeheuerliches drohte ihrem Liebling.
„Bis jetzt habe ich die Sache als grausamen Scherz betrachtet, nun aber müssen wir mal ernst darüber reden. Ein total verwöhnter Mensch wie du, ich bitte dich! Nach der ersten Woche lägest du da. Arbeiten ist gewiss keine Schande, aber jeder hübsch an seinem Platze. Lass’ die anderen alles schlucken, nur vergiss dich nicht.“
Es stand fest bei ihr: eher hätte sie sich im geheimen zu ähnlichen Dingen erniedrigt, bevor sie den Sohn darunter leiden gesehen haben würde.
Aber Waldemar taute auf. Wie? Dieser Verwandtensippe den Triumph gönnen, das ganze Vermögen einzustecken, während sie beide, als die Nächsten, mit einem Butterbrot abgespeist werden würden? Nie und nimmer! Jetzt erst recht nicht, da er gehört habe, dass die Gesellschaft schon im Trüben zu fischen beginne.
In Waldemar Tempel regte sich der Trotz, so wie er damals vor Jahrzehnten Friedrich Ludwig Karl aufgerüttelt hatte, als man den „Kellner“ nicht vergessen konnte. Und hier war es der „ewige Student“, der nun herausgefordert wurde, — ihm aufgebrummt leider von dem, der selbst unter ähnlichem Hohn gelitten hatte. Aber das war die Wesenseinheit von Onkel und Neffen, die nun auch dem Jungen den Weg zur Erkenntnis wies. Und der alte Schmargendorfer hatte sehr richtig gewittert, wenn er ihn schon ehrgeizig die Beute nach Hause tragen sah. Denn der kannte die Menschen, die von dem Geld nicht lassen konnten, weil er sich selbst kannte; sie sträubten sich zuerst, es unter Kränkungen anzunehmen, und dann kamen sie von selbst und baten darum und scheuten dabei die schlimmsten Entwürdigungen nicht.
„Und Lüssi Reimer, was wird die dazu sagen?“ meldete sich Frau Tempel wieder. „Die werden alle auf den Rücken fallen, wenn sie das hören.“
„Vor Freude, das glaub’ ich wohl,“ lachte Waldemar hervor. „Denn nun ist doch Aussicht, dass ich sie heiraten kann.“
„Ja, wenn sie so lange wartet.“
„Ach, sie wird schon. Bis jetzt hat der Alte angenommen, ich sässe immer noch in der Wolle und würde losbauen wie Papa. Aber wovon? Macht alles, weil sie dich immer noch für die Besitzerin des Hauses halten. Nun aber winken die Moneten.“
Frau Tempel seufzte. Ihr Besitztum stand nur noch im alten Adressbuch, was ihr bis jetzt nur Scherereien gemacht hatte. Das Haus hier, das letzte des seligen Erbauers, war so überschuldet gewesen, dass man schliesslich froh war, es mit der Vergünstigung loszuwerden, noch eine Zeitlang mietefrei wohnen zu können.
„Was wirst du nun tun? Willst du ihr alles sagen?“
„Aber selbstverständlich. Bei der Aussicht ...“
„Sie wird dich für verrückt halten.“
„Oder für sehr vernünftig.“
„Und der Alte ist so penibel.“
Erfahren müssen sie es ja doch,“ sagte Waldemar und ging wieder fort, denn er wollte zu ihr.
Frau Tempel begleitete ihren Sohn bis auf den Korridor, und was sie ihm zum Abschied noch nachrief, war die Herzensbitte: er möge sich doch alles noch einmal überlegen, bevor es zu Auseinandersetzungen käme.
Das alles ging Waldemar im Kopfe herum, denn sonst hätte er wohl gemerkt, wie das Spitzmausgesicht von neulich, das vor dem Hause gewartet zu haben schien, ihn nicht aus den Augen liess.
Langsam schlenderte er die Strasse entlang, der Richtung nach der Kaiserallee zu. Es war ein klarer, heller Nachmittag und schon bedenklich kühl, so dass man die Vorwehen des nahenden Winters empfand. Der Himmel prangte noch blau, und in der durchsichtigen Luft zeichnete sich der Strassenzug in scharfen Linien ab.
Alle diese Häuser hier mit ihren übermodernen Stilarten hatten etwas von einer rasch entstandenen, eigensinnigen Stadt, die man an den alten Berliner Westen herangeschoben habe, um eine Verbindung herzustellen.
Waldemar war gerade in die Bamberger Strasse eingebogen und fand wie immer hier die Häuser mit ihrem überall gleichmässigen Erkervorbau, der steif vom Parterre bis zum Dache führte, höchst langweilig, als er in dieser stillen Betrachtung durch eine unerwartete Anrede gestört wurde.
Eine tiefe Verbeugung, der Anblick eines schon halb kahlen Schädels, der sich eigentlich nur wie eine abgeschrägte Fortsetzung der Nase ausnahm, und es unterlag keinem Zweifel mehr, dass dies das Spitzmausgesicht war, das nun mit einem kühnen Entschluss die Attacke machte.
Natürlich trug der Allerweltsagent, wie gewöhnlich, eine einstmals hellbraun gewesene, nun aber durch den jahrelangen Gebrauch fettig-schwarz gewordene Aktenmappe unter dem Arm, denn ohne Mappe ging er niemals aus. Das gehörte zu seinem Handwerk, zu seinem Lebensbedürfnis, zu seiner Repräsentation.
„Mein Name ist Gustav Tempel, Agentur und Kommission,“ begann er unterwürfig, so in der Art von Leuten, die sich immer zwischen Tür und Schwelle vorstellen. „Herr Baumeister kennen mich wohl nicht mehr? Ich hatte schon einmal den Vorzug Ihrer persönlichen Bekanntschaft — vor etwa einem Jahr.“
Das pflegte er immer zu sagen, obgleich es niemals wahr war; aber dadurch machte er die Leute irre und gewann den Anknüpfungspunkt. „Wir sind entfernte Verwandte ...“
„Wohl sehr entfernt,“ unterbrach ihn Tempel und schritt ruhig weiter, um ihn auf diese Art abzuschütteln.
„O, das tut durchaus nichts,“ fuhr das Spitzmausgesicht fort und blieb ganz familiär an der Seite des anderen, „um so näher war ich Ihnen stets in Gedanken. Besonders mit meiner Achtung, ganz besonders damit. Wissen Sie, es sind nicht die schlechtesten Verwandten, die sich bescheiden im Hintergrund halten, und die sich nur melden, wenn sie gefällig sein wollen. Sehen Sie, so bin ich, Herr Baumeister.“
„Ich bin nicht Baumeister,“ sagte Waldemar ärgerlich.
„O, das tut nichts,“ fuhr Agent Tempel unbeirrt fort. „Sie werden es sicher noch werden, und Baurat obendrein und vielleicht auch noch Professor. Das prophezeihe ich Ihnen. Sehen Sie, so bin ich.“
„Sehr nett von Ihnen. Aber was wünschen Sie nun eigentlich?“
Gustav Tempel, der ewig an einem Stockschnupfen litt, was er mit einer steten Erkältung entschuldigte, (sein Gesicht war immer leicht blaurot angehaucht), zog erst ein paar tote Worte durch die Nase, bevor er den folgenden mit seiner verschleimten Stimme zum Leben verhalf.
„Auf keinen Fall will ich Sie anpumpen, auf keinen Fall. Sehen Sie, so bin ich. Das mögen die anderen machen, der Fiebig und der Kladisch, — passen Sie auf, die kommen noch. Sicher. Ich kenn’ doch meine Leute. Wenn die einen Braten riechen, dann sind sie schon dabei, ehe er auf den Tisch kommt. O, ich kenne die Welt.“
„Aber es gibt ja noch gar nichts anzupumpen,“ wehrte sich Tempel wohlwollend. „Irre ich mich nicht, so waren Sie doch bei der Testamentseröffnung.“
„Aber die Anpumpung wird kommen, Herr Baumeister, verlassen Sie sich darauf,“ liess Agent Tempel nicht locker und lachte ihn vergnügt an, so dass die spitzen Hauer zu sehen waren. „Und deshalb müssen Sie sich reserviert halten ... und deshalb möchte ich Ihnen mit einem Vorschlag kommen. Zu Ihrem Besten. Sehen Sie, so bin ich.“
Und ohne weiteres begann er, ihm zu entwickeln, dass sich ein Mann wie Waldemar Tempel unmöglich in eine solche Lohnknechtschaft begeben könne, ohne sein Renomee darunter leiden zu sehen, und dass daher er, Gustav Tempel, der denselben Namen führe, bereit sei, seinen Sohn Oskar, der dreiundzwanzig Jahre zähle und ein heller Junge sei, die Rolle für ihn spielen zu lassen. Natürlich gegen eine entsprechende Vergütung, worüber sich ja noch reden liesse! So etwas lasse sich schon machen, denn es sei ja doch nicht anzunehmen, dass die Herren Testamentsvollstrecker von früh bis spät wie die Affen vor dem Fabriktor stehen und die Arbeiter zählen würden. Dabei bekomme man ja auch kalte Füsse. Er werde schon alles arrangieren: sich zu den Herren Testamentsvollstreckern begeben, sich als einen Todfeind des Universalerben, als Beauftragten der ganzen Verwandtschaft ausgeben, und sich den Herren als Beobachter und Berichterstatter anbieten, worauf sie jedenfalls mit Freuden eingehen würden. Denn er kenne die Welt und die Menschen!
„Sehen Sie, so bin ich, Herr Baumeister. Wir machen doch die Sache etwas schriftlich, nicht wahr? Ich nehme auch Wechsel. Ärgern soll sich die ganze Bande, ärgern! Und haben Sie das Heu erst rein, dann denken Sie: rutscht mir den Buckel runter.“
Tempel, der die plumpe Falle dahinter sah, wollte erst wütend werden; dann aber nahm er die Sache von der humoristischen Seite. „Ein ausgezeichneter Plan, mein werter Onkel von weit her,“ sagte er spöttisch, „und viel Dank dafür. Aber es geht nicht, ich habe mich schon verdungen.“
Agent Tempel spitzte die roten Ohren. „Wie, Sie sind schon so leichtsinnig gewesen? Wo denn, wo denn?“
„Wie kann man nur so neugierig sein, mein bester Herr Namensvetter. Grüssen Sie mir die teure Verwandtschaft.“
Und um ihn loszuwerden, ging er schräg über den Strassendamm. Aber Herr Gustav Tempel, ans Reden gewöhnt, auch wenn man ihm die Tür bereits vor der Nase zugeschlagen hatte, gab den Versuch nicht auf. Die Geschäftsmappe fest unter dem Arm, den Stock tüchtig ansetzend, nahm er dickfellig denselben Weg.
Und unaufhörlich sprach er weiter, trotz seines Stockschnupfens, und obgleich ihm fast der Atem ausging, denn der Bedrängte nahm nun grosse Schritte. Und schon begann er zu handeln. Endlich, als er sah, dass er gar keine Antwort bekam, schöpfte er noch einmal Luft und sagte: „Überlegen Sie sich die Sache, Sie werden es bereuen, Herr Baumeister. Ich wohne Katzbachstrasse neuundneunzig, Hof vier Treppen, für Sie bin ich immer zu haben. Sehen Sie, so bin ich.“
Dann blieb er zurück und schnaubte sich endlich die Nase. Und sein Gedanke dabei war: „Jungeken, dich kriege ich noch.“
Er war schon um die nächste Strassenecke, als er wieder kehrt machte und aufs neue unauffällig hinter Tempel herging. Musdal, dem er Bericht erstatten wollte, lief nicht fort, denn er sass schon seit Olims Zeiten in seinem Laden im Osten. Aber der dort vorn hätte windig werden können. Auf alle Fälle schadete es nichts, wenn man ein wenig weiter schnüffelte. Man hatte ja Zeit. Eine „Agentur und Kommission“ hatte überhaupt immer Zeit, besonders wenn es nur eine sogenannte fliegende war.
Waldemar Tempel schritt währenddessen gedankenvoll seinem Ziele zu.
Der Geheime Regierungsrat Reimer wohnte am Ende der Düsseldorferstrasse, nicht weit von der Uhlandstrasse, dort, wo die letzten Häuser fast ans freie Feld stiessen und der Blick über neu parzellierte Strassen, Holzplätze und Laubenkolonien hinweg noch ins Grüne schweifen konnte. Falls es natürlich Sommer war. Und diese schönen Spätsommertage hier draussen, nach der Reisezeit, hatte Waldemar an manchen Abenden genossen, wenn er mit Lüssi in der grossen Loggia sass und allerlei Dummheiten trieb, während die Alten drinnen im Zimmer die Zeitung lasen.
Sie waren zwar erst heimlich verlobt, aber das schadete nichts. Im Gegenteil sagte sich die Frau Geheimrat, die im Hause das Regiment führte, das sei das allein richtige, wenn man noch nicht wisse, „wie, wo und wann“. Schon bei ihrer anderen verheirateten Tochter hatte sich diese Vorsicht bewährt. Denn der erste Verehrer war abgeschnappt, bis dann der zweite, ein junger Gymnasialprofessor, kam, der auf Mitgift überhaupt nicht sah und um so sesshafter blieb. Es ging zwar gegen die Familiensitte, dass die Jüngste zuerst an den Mann kam, aber besser rasch, als zu spät.
Geld konnte natürlich auch Lüssi nicht mitbekommen, und so freute man sich denn, als die Verwöhnte, die bisher im Körbe-Austeilen sehr fleissig gewesen war, einem jungen Mann, von dem man allgemein behauptete, er besitze von Grossvaters Seite ein stattliches Vermögen, ernste Avancen machte.
„Architekt“ klang auch ganz schön, und es entsprach sogar dem barocken Sinn der Dreiundzwanzigjährigen, die einstweilen ihr grösstes Vergnügen darin gefunden hatte, im Sommer in Seebädern die Strandnixe oder im Gebirge die Berghexe zu spielen, und im Winter als Wohltätigkeitsfee von einem öffentlichen Feste zum anderen zu rauschen und den Herren, besonders den jungen, durch den Anblick ihrer schönen, runden Schultern, durch ihre Perlzähne und durch das Klappern ihrer hübschen Augen das Geld für Programme, Ansichtspostkarten oder sonstige andere leichte Ware zu Gunsten der Komiteekasse abzunehmen. Manchmal auch als Büffetschlange, die solange nach Kleingeld suchte, bis irgend ein armer Leutnant, rot geworden und doch hingerissen, verlegen stammelte: „Aber ich bitte, bemühen sich gnädiges Fräulein doch nicht. Is ja für die armen Waisenkinder.“
Und manchmal war es selbst so ein armer Waisenknabe, der das sagte, — wenigstens was die Verlassenheit in seinem Portemonnaie anbetraf.
Aber für Lüssi war es ein Gaudium. Denn es erschien ihr immer wie eine kleine Vorbereitung auf ihr späteres glanzvolles Eheleben, wenn sie erst ihrem Gatten das Geld zur Erfüllung ihrer Wünsche werde abknöpfen können; natürlich gleich in Form von blauen oder braunen Scheinen. Denn eine Spiesserehe führen wie Edith mit ihrem Oberlehrer, nein, — dann lieber schon gar nicht heiraten und sich so weiter amüsieren.
Sie war nun einmal anders veranlagt, als die jüngere.
Bei alledem bedachte sie nicht, dass gerade dieses „einnehmende Wesen“ das Abschreckende für die „Reellen“ war, die den ewigen Kleingeldmangel als symbolisch für spätere Zeiten auffassten und daher beim zweiten und dritten Male hübsch um sie herumgingen.
Ganz anders war Waldemar Tempel geraten, den sie bei einer solchen Gelegenheit im vergangenen Winter kennen gelernt hatte, schon zur Zeit, als das Geld des seligen Grossvaters ziemlich klein gemacht war, und nun so allmählich die Frage kam: Was soll das werden?
Der Anblick der hübschen Lüssi mit den Tollkirschenaugen, dem verführerischen Lächeln, der schlanken Taille und den schmalen Händen half ihm bald über jedes Bedenken hinweg, denn er hatte sich gründlich in sie verschossen. Wenigstens bildete er es sich ein. Das war ein Mädel, mit dem man reden konnte, und das die süsse, kleine Frau schon als Schelm im Nacken trug. Einfach toll, wie die mit den Herren umging und die Dummen noch dümmer machte.
Und ihr gefiel der schlanke, lebenslustige Kerl nicht minder. Der hatte Rasse in seiner Nase und Witz auf seinen Lippen und zeigte männliche Galanterie in jeder Form. Ein kühner Draufgänger, dabei kolossal verliebt, wie es ihr schien, und das gab ihr die Übermacht. Musste überdies verdammt viel Moos haben, der! Denn er trug die Hundertmarkscheine stets lose in der Westentasche.
Hei, und tanzen konnte er, dass sie Seligkeit überkam bei diesem sanften Schweben im Parkettland holder Träume.
Und was er trank, war Sekt, und immer nur Sekt und Sekt.
Die Frau Geheimrat war entzückt. Der Geheimrat sagte zwar weniger, hielt aber länger aus, als sonst. Und das genügte. Sein Gedanke war immer: Wenn nur Lüssi erst verheiratet wäre.
Seit einiger Zeit jedoch zeigten sich bei Lüssi gewisse Verstimmungen, die Waldemar darauf zurückführte, dass ein Vetter von ihr, ein schneidiger, blonder Assessor aufgetaucht war, der sich von Hannover nach Berlin hatte versetzen lassen, um hier, protegiert vom lieben Onkel, in den höheren Verwaltungsdienst überzugehen. Und Tantchen lobte ihn über die Massen, denn —: man konnte nie wissen, „wie, wo und wann“. Ganz besonders erwog sie das seit dem Tage, da gewisse Nachrichten über den heimlich Versprochenen sie sehr unruhig gestimmt hatten. Sie liess sich aber nichts merken, denn als geschickte Spielerin gab sie die eine Partie nicht auf so lange sie die Chancen der anderen nicht kannte.
„Na, du strahlst ja wieder,“ sagte Waldemar, als Lüssi ihn nach seinem bekannten Klingelzeichen in dem kleinen Vorsalon mit Beschlag belegt hatte.
Er hatte schon im Entree an der Garderobe gemerkt, dass der Strohblonde wieder anwesend war, und dass die Unterhaltung am Kaffeetisch sehr laut geführt wurde.
„Sei doch nicht wieder ungemütlich. Es ist schon genug, wenn Papa schlecht gelaunt ist.“
Und um ihn zu beruhigen, schlang sie die vollen Arme um seinen Hals und gab ihm seine Küsse dreifach zurück. Diese kleinen Vorschüsse auf die Seligkeit steckte sie stets mit Wonne ein und zwar mit geschlossenen Augen, bevor sie sich wieder zusammennehmen musste.
„Du, hör mal, — nachher hab’ ich etwas Wichtiges mit dir zu reden,“ sagte sie dann plötzlich.
„Ich auch.“
Sie lachte. „Das trifft sich ja gut. Hoffentlich ist’s was Gutes.“
„Na, so halb und halb. Jedenfalls nicht zu verachten“.
„Du, dann bin ich aber wirklich neugierig. Kann ich’s nicht gleich wissen?“
„Das würde zu lange dauern. Und was sollte dein Vetter dazu sagen?“
Zur Strafe riss sie ihn an den Ohren. Dann warf sie rasch einen Blick in den Spiegel, drückte ihr Haar glatt und zog ihn mit fort.
Hinten im Speisezimmer, das zugleich auch das Familienzimmer war, sass Assessor Lönge und liess sich von der Frau Geheimrat gerade eine neue Tasse einschenken. Er hatte ein volles Gesicht mit weichen Zügen, in dem der helle, gestutzte Schnurrbart nur wenig abstach, um so mehr aber die saftigroten Lippen, und trug das glänzende, etwas gewellt aufliegende, hinter dem Ohr nach vorn gestrichene Haar in der Mitte tadellos gescheitelt.
Sofort erhob er sich und begrüsste Tempel freundlich, obgleich seine lichtgrauen Augen nur auf seiner schönen Cousine haften blieben. Immer war er artig und zuvorkommend, der von oben bis unten geschliffene Mensch, den man von allen Seiten betrachten konnte, ohne dass ein Stäubchen der Inkorrektheit aufgefallen wäre. Das ärgerte den burschikosen Tempel, der niemals recht wusste, wo er da die Bürste ansetzen sollte.
Der Geheimrat brauchte sich nicht erst zu erheben, denn nervös und gedankenzerzaust, wie er war, ging er bereits im Zimmer umher und liess die Beine knacken, dabei die Hand immer an dem langen, schön gepflegten, schon stark mit Grau, durchsetzten Hängebart, der von den dünnen Fingern zeitweilig wie von einem Kamm bearbeitet wurden. Herr Reimer war gross und geschmeidig und unstreitig ein schöner Mann, auch mit einem heiteren Blick, obwohl ihm der hornberänderte Kneifer zuerst etwas Durchdringend-Prüfendes gab, so einen Stich in Staatsanwaltliche. Alle Illusionen schwanden aber, sobald er sprach, denn seine Stimme hatte einen heiseren, geborstenen Klang, der namentlich in der Erregung etwas Bellendes bekam, wobei seine vorgesetzte Exzellenz manchmal eine Gänsehaut überlief. So liess er seine Frau lieber sprechen, die, urgesund und wohlbeleibt, sich durch nichts in ihrer Ruhe stören liess. Wo sie sass, da sass sie.
Nun ging sie aber doch dem zukünftigen Schwiegersohn auf halbem Wege entgegen. Sie erkundigte sich sogleich nach dem Befinden seiner Mama und machte ihm sanfte Vorwürfe, dass er sich gestern nicht habe sehen lassen, was man gar nicht mehr gewöhnt sei.
Tempel entschuldigte sich mit Geschäften und nahm mit seiner heimlichen Braut am Tische Platz, wobei Lüssi sich ihrem Vetter gerade gegenüber setzte, was Assessor Lönge mit stiller Wonne erfüllte. Er spielte denn auch sofort den Aufmerksamen, wobei sich seine lichtgrauen Augen verstohlen in das schwimmende Emaille unter den langen Wimpern der koketten Cousine versenkten, was sie wohlverstand. Ihr Trost blieb: Es ist ja doch nur Spielerei, und weshalb soll ich dem guten Jungen die Freude nicht gönnen. Überdies war sie an verliebte Blicke gewöhnt, und es hätte ihr etwas gefehlt, wenn ein kecker Schelm sie damit nicht bedacht haben würde.
„Na, haben Sie schon eine neue Wohnung?“ fragte die Frau Geheimrat dann, nachdem man gemütlich beisammen sass.
„Es wird sich dieser Tag entscheiden,“ redete sich Tempel aus, der schon seit einer Woche nicht wusste, wie er sich zu dieser Angelegenheit verhalten sollte. Denn bis jetzt hatte er sich gescheut, von dem Testament des Schmargendorfer zu sprechen, wie er überhaupt, auch bei Lebzeiten des Onkels niemals von ihm gesprochen hatte. Schon aus taktischen Gründen nicht.
„Dann wird es aber Zeit, dass Sie zu einem Entschlusse kommen,“ sagte die Mama wieder, die eine derartige Saumseligkeit nicht begriff. Sie hatte von Tempel gehört, dass man das Haus verkauft habe und von nun an zu Miete wohnen würde. Hinzu kam noch etwas anderes, das sie aber in Gegenwart ihres Neffen nicht berühren wollte.
„Werden Sie in Ihrer Gegend bleiben?“ meldete sich nun auch der Geheimrat, der sich aus Anstand wieder auf ein paar Minuten gesetzt hatte. Durch sein Augenglas ging sein Blick herausfordernd auf den künftigen Schwiegersohn.
„Herr Tempel ist für die Gegend am Zoo, er sprach doch schon neulich davon,“ mischte sich Lüssi hinein, schlug aber die Augen nieder, denn sie wusste, was hinter alledem steckte.
Ihr Herr Papa hat sehr viel gebaut, wie ich gehört habe,“ sagte nun auch Assessor Lönge.
„Ganze Strassen,“ renommierte Frau Geheimrat darauf los.
„Das muss Pinke gegeben haben,“ sagte der Assessor wieder ungeniert und nahm sich ein Stückchen Kuchen vom Teller, weil Lüssis weisse Finger gerade ebenfalls danach langten.
Waldemar Tempel nickte verbindlich nach beiden Seiten, allerdings mit etwas beengtem Gemüt; denn erstens fühlte er sein Gewissen schlagen, und zweitens kam ihm diese Stimmung etwas sonderbar vor: schwül und bedrückend, trotz des freundlichen Getues. Ausserdem gefiel ihm die Miene des Alten nicht. Er sass seitwärts da, ein Bein über das andere geschlagen, liess die Finger über den Bart gleiten und lächelte verdächtig.
„Werden Sie die Baufirma Ihres Papas wieder aufnehmen? fragte er wieder.
Da hielt es Tempel für angezeigt, mit einem Teil der Wahrheit herauszurücken, um in keine zu schiefe Lage zu kommen. Und, indem er die Frage des Alten offen liess, wandte er sich an die Mama: „Übrigens wollen wir nur vorübergehend zur Miete wohnen. Im Winter werden wir unser Haus in der Nachodstrasse beziehen, und im Sommer werden wir wohl in unserer Villa in Schmargendorf wohnen. Oder ganz, wie Lüssi es wünscht.“
Assessor Lönge riss die Augen auf und beobachtete seine Cousine, die die Farbe wechselte und heftig Atem schöpfte, ohne jedoch den Blick von ihrer Tasse zu heben. Und dabei verschlang er wieder ihren weissen Hals und alles das, was sich in dem spitzen Kleidausschnitt zeigte.
„So, so,“ warf Frau Reimer überrascht ein, sah aber ihre Tochter bedeutungsvoll an.
Ihr Mann jedoch hatte plötzlich genug davon. Er erhob sich wieder, liess beim Umhergehen aufs neue die Beine knacken und entschuldigte sich dann damit, dass er noch wichtige Dinge in seinem Arbeitszimmer zu erledigen habe. Mochten Frau und Tochter diese Lügen aufdecken, er fand zu solchen Dingen nicht den Mut, denn seine Nervosität hatte ihn furchtsam gemacht. Er hatte genug mit seinen staatlichen Dingen zu tun. Ausserdem war heute sein Abend bei Siechen, und da wollte er sich in Ruhe bei den Akten, die er sich ins Haus hatte schicken lassen, darauf vorbereiten.
Das Pärchen ging dann in den Salon, wo ein alter Stutzflügel stand.
Es begann schon zu dunkeln, und so zündete Lüssi rasch ein paar Flammen der Gaskrone an. Und dabei sah sie durch die halbmatt geschliffenen Scheiben der Tür, wie Mama nebenan dasselbe tat.
Tempel setzte sich an den Flügel und liess die Finger über die Tasten gleiten. In seiner Jugendzeit hatte er lange Unterricht gehabt, aber viel verlernt, weil er nicht übte. Aber so wenig er auch konnte, er zeigte doch, dass er musikalisches Gehör besass. Und plötzlich, nach einer romantischen Einleitung, spielte er ganz banal:
„Muss i denn, muss i denn zum Städtle hinaus,
Und du mein Schatz bleibst hier.“
Lüssi, die seitwärts stand und in ihren Noten kramte, lachte.
„Wie kommst du denn gerade darauf?“ fragte sie.
Tempel aber lachte nicht mit, denn ihm war sehr ernst zu Mute. Und deshalb gerade hatte er diese Melodie angeschlagen. Dann, schon nach ein paar Takten, bat er sie, seinen Platz einzunehmen.
Sie zögerte aber und sah ihn aufmerksam an.
„Du hör’ mal, Waldemar, — in dir geht etwas vor.“
„Na, in dir doch auch, in euch allen. Was gibt’s denn?“
Erregt ging er im Salon herum und betrachtete zerstreut all die Dinge, die er schon zur Genüge kannte: die Ölporträts von Reimer und Frau, schlecht und recht gemalt, die übrigen Bilder, auffallend durch protzige Goldrahmen, die grosse Herkulesuhr auf dem Ofensims, flankiert von zwei silbernen Handkandelabern; die vielen hübschen Nippes, die überall herumstanden, — die ganze schwere Möbelausstattung, die ein Gemisch von Altem und Neuem war, zusammengetragen und ergänzt durch die Jahrzehnte: steife Lehnsessel, moderne Seidenfauteuils und barockgeschnitzte Schränke und Spiegel.
„Nun, was wolltest du mir denn sagen, Waldemar?“
„Ich denke, du hattest etwas Wichtiges.“
Sie stand verlegen da und tippte die Spitzen der gespreizten Finger gegeneinander. „Ich trau’ mich nicht.“
„Nun, siehst du, Lüssi, ich auch nicht.“
Er trat an die Tür, blickte durch die blanken Stellen der Scheiben vorsichtig ins Speisezimmer und sah, wie Mama Reimer eifrig mit dem Assessor sprach, wobei sie mehrmals nach dem Salon hinsah. Tempel bekam einen roten Kopf und ging von der Tür weg, wieder aus den Flügel zu.
Da stellte sich Lüssi dicht vor ihn hin, ergriff seine Hände und sagte mit holder Frechheit: „Du, sag’ mal, — das ist doch Schwindel mit dem Haus und mit der Villa?“
Das Wort Schwindel war ihr sehr geläufig, und so nahm er es ihr nicht krumm. „Aber nein doch, es ist die Wahrheit,“ erwiderte er im Gefühl des künftigen Erben.
„Ach rede doch nicht, Waldemar. Das hast du dir im Augenblick so ausgedacht, weil mein Cousin dabei war. Den wolltest du einfach damit ärgern. Denkst du denn, ich seh’ nicht, dass du ihn nicht leiden kannst.“
Sie hatte zwar recht, aber er wollte es ihr nicht gestehen.
„Nein, nein, nur weil dein Papa dabei sass,“ redete er sich aus. „Er hat seit einiger Zeit etwas gegen mich. Siehst du, ich seh’s dir an, Lüssi.“
Eine kleine Verlegenheitspause, und Lüssi war wieder gefasst.
„Du musst es mir nicht übel nehmen, liebster Waldemar, aber darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Es ist jemand, der Papa darauf gebracht hat. Es soll nicht alles so recht stimmen mit deinen Verhältnissen. Sei mir nur nicht böse, dass ich so offen bin, aber ich muss es dir doch sagen, damit du Bescheid weisst.“
„Sei nur gleich deutlicher. Papa hat Erkundigungen über mich eingezogen, nicht wahr?“
Da zog ihn Lüssi beiseite, von der erleuchteten Tür fort, und umschlang ihn wild, fast wie verzweifelt: „Waldemar, ist es wahr, dass deiner Mutter das Haus schon lange nicht mehr gehört, und dass deine Aussichten sehr trübe sind.“
„Im Gegenteil, Lüssi, sie sind so glänzend wie möglich. Du hast es ja gehört: ein grosses Haus und eine schöne Villa. Und was sonst noch kommt.“
„Pfui, schäme dich,“ rief sie aus. „Von wem denn?“
„Allerdings erst in einem Jahr, vielleicht noch später,“ fuhr er trocken fort.
Das war ihr zuviel. „Solange soll ich noch warten?“ presste sie wütend hervor.
„Das wollte ich dir eben sagen, Lüssi.“
Da biss sie, blass geworden, in ihr Taschentuch und zerrte daran, was sie immer tat, wenn sie so ihre kleinen Anfälle hatte. Und Heiterkeit heuchelnd, drehte sie sich im Kreise und zischte die Worte zwischen den Zähnen hervor: „Schwindel, Schwindel, Schwindel.“
Am liebsten hätte sie ihn dafür geohrfeigt, so wütete der Zorn in ihr, die Aufgezogene zu sein. Nebenan wurden Stühle gerückt, und so wollte sie Waldemar rasch zur Vernunft bringen.
„Wir können die Verlobung ja noch hinausschieben. Ganz nach deinem Wunsch.“
„Alles das sagst du mir erst jetzt?“
„Weil ich selbst erst jetzt alles erfahren habe ... Lüssi, glaube mir. Komm her zu mir und sei vernünftig.“
Sie rückte vor ihm aus bis hinter den Flügel und hielt sich die Ohren zu. „Schwindel, Schwindel! Ich glaube dir nichts mehr.“ Sie dachte an weiter nichts, als dass sie noch ein ganzes Jahr bis zur Hochzeit warten sollte, und das erboste sie dermassen, dass sie ihm die Augen hätte auskratzen mögen.
Da, als er ihr schon alles sagen wollte, kamen die Frau Geheimrat und Assessor Lönge herein.
Mama sah sofort, dass etwas Ernstes vorgegangen war und schlug einen vermittelnden Ton an.
„Willst du nicht etwas singen, Fred?“ fragte Lüssi mit gewinnender Liebenswürdigkeit ihren Vetter und dachte dabei nur daran, Tempel zu ärgern. Jetzt, nachdem die Sache, so stand! Zum mindesten sollte er eine schlaflose Nacht haben, wie sie sie selbst haben würde.
Assessor Lönges lichtgraue Augen strahlten. Und gewöhnt, immer den Galanten zu spielen, und auch ein wenig eingenommen von seinem dünnen Bariton, der gerade für ein grosses Zimmer ausreichte, schmachtete er seine Cousine lächelnd an, setzte sich dann und legte ohne Ziererei mit einem Schumannschen Liede los, nachdem er sich zuvor die Beinkleider mit der Bügelfalte sorgsam über das Knie gezogen hatte.
Und Lüssi stand hinter ihm, um rechtzeitig das Notenblatt zu wenden. Es war so, als wäre das ihr Bräutigam und nicht der andere, der da, in sich versunken, in der Ecke sass.
„Sie bleiben doch zum Abendbrot?“ fragte Mama Reimer dann Tempel. Sie hielt das zwar für selbstverständlich, aber aus Höflichkeit stellte sie immer dieselbe Frage. Junge Leute hatten auch manchmal etwas anderes vor. Sie spielte auch die Erstaunte, als sie eine Absage erhielt, nötigte dann aber nicht mehr, denn sie dachte sich ihr Teil. Ihr Neffe blieb ja, und das war eine kleine Entschädigung. Man konnte nie wissen: „wie, wo und wann“.
Tempel empfahl sich, und Lüssi begleitete ihn wieder hinaus. Ihre Wut war erloschen, um so mehr lohte ihre Leidenschaft wieder. Dieser Strohkopf drinnen war zwar hübsch und artig, aber fade. Dieser hier hatte Temperament und die gewisse Art, auf Frauen zu wirken. Die quälende Angst hatte ihr die Feuchtigkeit in die Augen getrieben.
„Weshalb gehst du denn eigentlich? Bleib doch, das lässt sich doch machen,“ bat sie.
„Nein, nein, es geht nicht, ich habe mich heute verabredet.“
Sie sah es ihm an, dass er sich nur ausredete, und so wurde sie wieder kurz. „Na, dann geh ... Kommst du morgen vormittag mit heran?“
„Wahrscheinlich .. Ausserdem, — du hast ja Gesellschaft.“
„Allerdings.“
Die Tür klappte. Sein Abschiedskuss war nur flüchtig gewesen, und das ärgerte Lüssi am meisten. Ihre Brust ging stürmisch, während sie unbeweglich stehen blieb. Sollte sie ihn zurückrufen, ihn um Verzeihung bitten? Schon hatte sie die Türklinke in der Hand. Ach was, der kam ja doch wieder! Bevor sie aber zu dem anderen ging, trat sie in das Schlafzimmer ihres Vaters und kühlte sich rasch Gesicht und Augen.
Unten ging Waldemar Tempel kummervoll durch die Strasse.