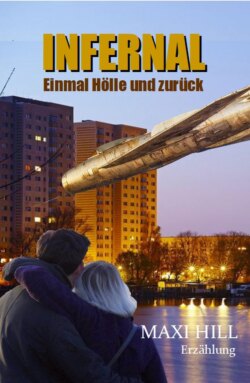Читать книгу INFERNAL - Maxi Hill - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN
ОглавлениеDen ganzen Tag über war der Himmel grau, als liege die Welt unter einer Milchglasscheibe. Normalerweise fiel es Reni an solchen Tagen nicht schwer, ihrer Arbeit nachzugehen. An diesem Montag, dem 13. Januar 1975, war sie nur ungern zu ihrer Nachtschicht im Kombinat aufgebrochen. Es waren dieselben Gedanken, die ihr seit zwei Wochen keine Ruhe ließen. Ich sollte ihm schreiben, dass ich zurück bin. Sie kannte das Haus in der Dreifertstraße und hatte sich die Nummer gemerkt, aber sie wusste nicht, ob noch jemand außer Björn in dieser Wohnung wohnte. Es schien ihr so. Für einen Mann ganz allein war sie ziemlich groß. Außerdem musste es einen Grund gegeben haben, warum er es am Morgen immer merkwürdig eilig hatte.
Nun stand sie an ihrem Arbeitsplatz, wo sie die modernsten Großrundstrickmaschinen bediente, die es im sozialistischen Wirtschaftsgebiet gab. Sie rückte ihr Kopftuch zurecht, mit dem sie ihr glänzend blondes Haar bändigte. Das war Vorschrift. Reni war erst seit kurzem stolz auf ihr Haar, weil es Björn ausgesprochen gut gefiel und weil er begierig seine Nase daran rieb.
Stolz war sie schon immer auf ihre Arbeit. Die Achtfachbedienung der Großrundstrickmaschinen hatte die Leistungen um die Hälfte über dem Weltstand erhöht. Das war etwas, um stolz zu sein. Weltweit gab es nur die Fünffachbedienung dieser Maschinen. Das hatte sie auch Björn gesagt und seinen Blick genau verfolgt. Sie wusste nicht, ob es Mitleid war, oder ob er besorgt war, sie könnte überfordert sein. Ihr war nichts geblieben, als ein souveränes Lächeln, so souverän, wie sie mit diesen Monstren von Maschinen umging. Könnte sie mit allem so umgehen, würde ihr Leben in anderen Bahnen gelaufen sein. Souverän in allem, wie Björn?
Ein zufriedenes Schmunzeln fuhr über ihre Lippen: Gleich wenn ich von der Schicht komme, hänge ich den Abwaschlappen ins Fenster. Dann wird er mich abholen… Ganz bestimmt.
»He Renate, stellst du deinen Kaffeebecher immer da hin, wo es dir gerade passt?« Neben ihr stand Michelle, das aufgeputzte, stark geschminkte Stadtkind, die Tochter vom Chef der Handwerkskammer. Man munkelte, der Vater habe ihr einen Studienplatz an der Bauhochschule verschafft, aber sie sei schon nach den ersten Semestern aus moralischen Gründen wieder rausgeflogen, was immer das für Gründe sein konnten. Normalerweise kehrte man bei Leuten aus diesen Schichten das Unmoralische unter den Teppich.
Reni stand da wie ein in die Enge getriebenes Tier und wusste nichts zu erwidern, jetzt, wo sie gerade die schönsten Gedanken hatte.
Sie hatte nicht den Eindruck, Michelle könnte es gut mit ihr meinen, dagegen sprach ihr Verhalten in letzter Zeit. Vermutlich wusste sie, wie Reni sich heimlich mit ihr verglich, weil sie stets glaubte, die Stadtdamen nähmen eine vom Kohlerevier, noch dazu aus einem kleinen Dorf, nicht ernst. Sie fühlte sich im Vergleich zu Michelle unauffällig, weshalb sie vermutlich kaum beachtet worden war. Bis vor reichlich sechs Wochen. Seitdem lief sie regelrecht Spießruten.
Arbeitsmäßig betrachtet konnte Reni der Einschätzung ihrer Chefin nicht widersprechen, Michelle sei auffällig nachlässig. Auch wenn es wie ein Paradoxon klang, faktisch war es durchaus vorstellbar. Die allesbeherrschende Kollegin hatte ihre Augen immerzu überall, nur nicht bei ihren Maschinen. Dabei musste man höllisch aufpassen, um keinen Ausschuss zu produzieren.
Frida meinte zu ihrem Vergleich mit Michelle, Reni sei natürlicher als Michelle. Und fleißiger sei sie sowieso.
Das durfte Reni von sich auch behaupten. Nicht von ungefähr erntete sie viel Lob, was nicht jedem gefiel.
Jetzt, als Michelle mit rollenden Augen vor ihr stand, spürte sie, wie sie schon wieder den Boden unter den Füßen verlor. Aber warum?
In Michelles Hand schwang ihr Kaffeebecher hin und her. Es war unverkennbar ihrer. Sie hatte den Becher zu ihrem zwanzigsten Geburtstag von Frida geschenkt bekommen, produziert westlich der Grenze und mit ihrem Namen bedruckt. Eigentlich wollte sie ihn in der gemeinsamen Unterkunft lassen, weil er so besonders war und weil sie nur dort Frida zeigen konnte, wie dankbar sie ihr war — für alles. Aber dann hatte sie ihn zuerst mit zu Björn genommen. Leider hatte er darauf bestanden, dass sie das gute Stück wieder mit nach Hause nahm, weshalb sie es noch am selben Tag mit zur Arbeit geschleppt hatte, eben weil es unverkennbar ihrer war und nicht mit anderen verwechselt werden konnte.
Ich bin ihr nicht gewachsen, dachte sie und kämpfte mit aufsteigenden Tränen. Sie wusste sehr wohl, dass sie den Becher ordentlich abgestellt hatte.
Wieso ist da noch ein Kaffeerest drin? Noch oder wieder?
Sie hatte die merkwürdigen Blicke zwischen Michelle und Eva schon vorhin gesehen, aber sie achtete seit einiger Zeit nicht mehr auf die beiden, so, wie sie es aus Björns Worten entnommen hatte, als sie einmal über gehässige Menschen gesprochen hatten. Verachtung, so hatte ihr Freund gesagt, ist die leichteste Strafe. Er konnte nicht wissen, dass ihr Gerede über ganz gewisse Gemeinheiten einen realen Grund für sie hatte.
Reni merkte, wie die Wut sie beherrschte und erwiderte nichts. Bisher ruinierte jedes Wort von einer der beiden jeden Versuch, ein sachliches Gespräch zu führen. Sie griff wortlos nach ihrem Becher, drehte sich um und stellte ihn auf das untere Deck einer Maschine. Später würde sie ihn mit in die große Pause nehmen, sofort ausspülen und bei Schichtende in den Spind stellen. Jetzt hatte sie weder Lust noch Zeit, sich auf lange Streitereien einzulassen. Sie zählte die Stunden bis zum Wiedersehen mit ihrem Liebsten, den sie viel zu lange vermisst hatte. Ihr Verlangen nach ihm war in den zwei Wochen so groß geworden, dass sie bereit war, alles andere zu ertragen.
Routiniert konzentrierte sie sich auf ihre Arbeit, verfolgte mit Argusaugen die Fäden auf den Spulen und das langsam wachsende Gestrick. Sie blickte erst wieder auf, als die Chefin neben ihr stand. Deren Stimme war im Lärm der Halle untergegangen, weshalb ihr Finger hartnäckig auf Renis Schulter klopfte. Auch ihre Hand schwenkte den Becher.
»Kann ich mich neuerdings auch bei dir auf derartige Provokationen einstellen?« Das war keine Frage, das war beinahe eine Androhung von Konsequenzen. Vom Nebenplatz schaute die schmächtige Eva, die Frau ohne eigenen Willen, wie Frida sie nannte, mitleidsvoll zu ihr herüber. Im Handumdrehen konnte Reni ihrer Freundin Recht geben. Ein gehässiges Grinsen lag über dem schmalen, stets blassen Gesicht. Weiter hinten grinste Michelle zurück. Das alles war jetzt ihr Leben. Neu waren nur die Worte ihrer Chefin, die nach Vermerk oder Verweis geklungen hatten, was sie vor lauter Scham und Ärger nicht mehr erfassen konnte. So ein Theater wegen einem Kaffeebecher!
Ihre Füße stampften auf, ihre Hände verschlangen sich trotzig vor der Brust, bis ihr das Fatale an ihrer Lage einfiel: Vorschrift ist Vorschrift. Aber Vorsatz ist viel schlimmer. Vorsatz ist gemein. Und das war von Michelle grober Vorsatz, um mir eins auszuwischen. Warum nur? Was habe ich denen getan?
Und dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Es gab zwei Gründe, die ihr in den Sinn kamen. Bei keinem war diese Schikane verzeihlich. Sie schrie irgendetwas gegen den Lärm in der Halle an und verließ zum ersten Mal die laufenden Maschinen. Erst vor der Tür wurde ihr klar, dass dieser Moment einen Wendepunkt markierte. Wenn sie jetzt nachgab, verliert sie die Selbstachtung.
Mit lautem Knall fiel die schwere Tür ins Schloss und ließ die Wand erzittern, die die Halle vom Gang trennte. Sie hörte nicht, wie der Putz leise aus dem Rahmen bröckelte. Dafür stellte sie sich umso deutlicher das Keifen der beiden Weiber hinter der Tür vor.
Seit sie Björn liebte, wie sie nie geglaubt hatte, lieben zu können, konnte sie nichts mehr erschüttern. Schon als Crissi, eine Mitbewohnerin im Ledigenheim, ihr erzählt hatte, man munkele, sie solle zum Frauentag ausgezeichnet werden, war es, als ging sie das gar nichts an. Aber jetzt ging ihr ein Licht auf. Wie kann man wegen einer Aktivistenauszeichnung…? Als hätte ich mich selbst vorgeschlagen. Geht doch zur Chefin, meinetwegen!
Irgendwo tief in ihr war noch der Glaube, es könnte sich alles wieder dahin normalisieren, wie es mal war, als man sie völlig übersehen hatte. Aber wenn sie es jetzt genau bedachte, fing die Schikane von Michelle und Eva nach dem Tanz bei Kaisers an. Also geht es den beiden doch um mich und Björn? Ganz sicher wissen sie mehr von uns, als ich glaube. Oder sie ahnen nur etwas? Sie stapfte über den Gang, ihre Fäuste tief in die Kitteltasche vergraben. In diesem Moment wusste sie selbst nicht, ob sie wütend war oder nur enttäuscht. In der Kitteltasche steckte noch immer die halbleere Zigarettenschachtel, die sie eigentlich wegwerfen wollte. In den zwei Wochen zu Hause hatte sie Björns Vorschlag beherzigt und mit dem Rauchen aufgehört. Solange etwas noch keine Sucht ist, hatte er gesagt, fällt alles leichter.
Ungeachtet jeder Vorschrift zündete sie sich eine der zerdrückten F6 an, die längst in die Tonne gehört hätten. Hinter der Stellage, an der fertige Docken vom Rundgestrick übereinander aufgereiht hingen, würde sie niemand erwischen. Unfähig, ihre Tränen zu bezwingen, heulte sie in sich hinein. Sie wünschte sich so sehr, jetzt an seiner Schulter zu lehnen, sein Streicheln zu spüren, seine tröstenden Worte zu hören. Am liebsten würde sie immer bei ihm sein.
Eingehüllt in die süßen Gedanken, spürte sie eine Hand sanft auf ihrer Schulter. Reni fuhr herum. Eva stand da, reckte ihre spitze Nase in die Höhe und legte ihren Zeigefinger auf die eingekniffenen Lippen, von denen Frida behauptete, sie würden unnachgiebige Durchsetzungskraft symbolisieren. Das war der blanke Gegensatz zu Fridas sonstiger Einschätzung von Eva. Auch daran konnte Reni nie glauben. Nur eines wusste sie genau. Sie stand sehr unter Michelles Fuchtel.
Das kurze blonde Haar wippte noch vom raschen Schritt. »Pst«, zischte Eva, als ob bei diesem Maschinenlärm da drinnen irgendjemand etwas hören könnte. Ihre schmalen Hände nahmen die glimmende Zigarette aus Renis Hand. Sie trat sie am Boden aus, bückte sich sogar wieder danach und steckte die Kippe wortlos in ihre Kitteltasche. »Reite dich nicht noch weiter in den Schlamassel«, sagte sie und fixierte Renis Gesicht, als wollte sie ihr ganzes Wesen ergründen. Dabei bildeten ihre Brauen einen satanischen Bogen, den Reni nie zuvor an Eva bemerkt hatte, weil sie die beiden seit langem mied. In Reni schoss der Gedanke, Eva könnte sich unter der Dauer-Fuchtel von Michelle nicht mehr wohlfühlen und versuche gerade, daraus auszubrechen. Was sollte sie dazu sagen?
»Wenn ich könnte, wäre ich längst weg hier«, brachte sie heraus. In ihrem Herzen wuchs der innige Wunsch, Björn könnte sie von hier wegholen, für immer.
Ach, wie konnte sie jetzt daran denken. Würde Björn sie mit in sein Zuhause nehmen, sie verlöre den Kontakt zu ihrer besten Freundin.
Frida saß im Nähsaal 1, wo über zweihundert Näherinnen hintereinander in Reih und Glied hinter Bergen von Zuschnitten verschwanden. Dafür war Frida ausgebildet. Reni hingegen hatte ihre Lehre als Strickerin gemacht, der Näherinnen-Jahrgang, ein Jahr später, den sie eigentlich anvisiert hatte, war bereits voll gewesen.
»Weißt du was, Reni«, sagte Eva, und das klang anders, als sie Eva bisher kannte, wenn auch nicht so freundschaftlich wie die Worte selbst. »Du brauchst hier einfach eine Freundin. Alleine schaffst du es nicht gegen Michelle …«, Evas Pause war gekonnt, »die dominiert uns alle.« Weil sich bei Reni, außer ihren Augen, die sich weiteten, nichts regte, sagte Eva wie mit Engelszungen. »Sag mir, wenn du einen Rat brauchst. In jeder Beziehung…«
Reni war einfach nur sprachlos.
»Hast du mich verstanden?«
Reni glaubte ehrlich, dass sie Eva verstanden hatte, und nickte ihr zu. Allerdings glaubte sie nicht, dass Eva vor Michelle einmal für sie Partei ergreifen würde.
Zum Glück ging Eva nicht weiter darauf ein. Mit erhobenem Daumen bestätigte sie lediglich ihr stilles Einvernehmen, drehte auf den Hacken um und kehrte in die Produktionshalle zurück.
In der Halle bemerkte die Polin Maria, wie Eva etwas unter Renis Arbeitsplatz warf und rasch davonlief. Mit erhobenem Kopf defilierte sie an den Plätzen der Polinnen vorbei, die sich gespannte Blicke zuwarfen aber nur selten einmischten. Michelle dagegen hob anerkennend ihren Daumen, ehe ihre Augen die Glaswand zum Chefbüro suchten, wo sie jetzt unbedingt etwas zu besprechen hatte.
Noch vor der Mittagspause erhielt Reni die erste Abmahnung von ihrer Chefin, die Eingang in ihre Kaderakte fand.
»13. 01.1975: Doppeltes Fehlverhalten im hochsensiblen Produktionsbereich.«
Das mit der Auszeichnung zum 8. März konnte sie nun wirklich vergessen.
and auf ihre SchulterH
Nach dem langen Dienst ging Reni noch zur Kaufhalle, um frische Brötchen für sich und Frida mitzunehmen. Die Kaufhalle öffnete bereits um sechs Uhr, was allen Schichtarbeitern nutzte, die gleich nach der Nachtschicht ihren Einkauf erledigen konnten.
Frida lag noch im Bett, die anderen drei Mädchen, mit denen sie sich die Wohnung teilten, hatten bereits Schicht. Also war heute Zeit für ein entspanntes Frühstück zu zweit, sie hatten sich ja viel zu erzählen. Auch Reni genoss es, mit Frida zu frühstücken, so sehr sie sich auch einmal ein solch entspanntes Frühstück mit Björn wünschte. Nach ihren wenigen Nächten in seiner Wohnung, die sehr gelöst und harmonisch verliefen, schien er am Morgen jedes Mal zu gehetzt, als dass ein entspanntes Frühstück noch möglich gewesen wäre.
Der Kaffeeautomat blubberte und der Toaster klickte, auf dem Reni die Brötchen noch einmal kurz aufgewärmt hatte. Bei den Außentemperaturen waren sie vermutlich schon in der Warenschleuse eisig kalt geworden.
Es läutete an der Wohnungstür. Frida, die noch rasch ins Bad geschlüpft war, um sich frisch zu machen, rief: »Kannst du mal…!«
Draußen stand Maria, die Polin aus der Wohnung eine Etage höher. Reni wusste, dass Frida und Maria schon oft Kontakt hatten. Daher konnte sie besser mit ihr umgehen, wie sie mit allem besser umgehen konnte. Aber nun stand sie selbst hier und sah die angezogenen Schultern, die Marias Entschuldigung ausdrückten. In ihrer Hand hielt sie ein buntes Porzellanschälchen mit einem Deckel, dessen Knauf ein Vögelchen darstellte. Reni fand es kitschig, aber sie war Marias polnischem Geschmack gegenüber sehr tolerant. Maria war vor einem halben Jahr für immer in die DDR umgesiedelt, weil sie seit langem im Kombinat arbeitete und in Polen keine Familie mehr hatte. Dass sie noch im Ledigenheim wohnte, war keiner Frage wert. Ob sie geschieden war, oder ob ihre Familie verstorben war, wusste Reni nicht. Nicht einmal Frida hatte von Maria den Grund ihrer Umsiedlung erfahren. Aus irgendeinem Grund schien sich Maria zu wundern, dass Reni öffnete, aber dann besann sie sich: »Habt ihr Zucker für mich? Ein bisschen…«
Reni lächelte tapfer, obwohl sie sich noch immer schämte, was während der Schicht passiert war und was Maria miterlebt hatte. »Klar, komm rein.« Drinnen fiel ihr ein, dass sie die erheblich ältere Frau, sie schätzte Maria so um die fünfzig Jahre, an jedem anderen Tag an den gemeinsamen Frühstückstisch gebeten hätte. Heute musste sie verhindern, dass Maria über die Blamage sprach.
»Das ganz lieb von dir. Ich nicht trinke süß, aber Aneczka nur trinkt süßen Kaffee…« Sie schob die ausgestreckte Hand mit der Dose in Renis Richtung und lächelte verlegen. »Ein andermal, ich werde dir erzählen von…«, sagte sie noch, aber Reni glaubte, Maria freue sich lediglich über die Nachbarschaftshilfe.
Dass es für keine von ihnen ein andermal geben sollte, konnte niemand ahnen.
An diesem Morgen des 14. Januar umarmten sich die Mädchen erst einmal innig, als Frida endlich aus dem Bad kam. Der Duft der aufgewärmten Brötchen zog verführerisch durch die kleine Wohnung, und der Kaffee, der diesmal nicht dieser schreckliche Kaffee-Mix war, mit dem der Wirtschaftsminister die Menschen abzuspeisen versuchte, weil die Devisen knapp wurden, schickte sein verführerisches Aroma in alle Ecken und sogar hinaus auf den Flur und weiter bis ins Treppenhaus.
»Erzähle«, sagte Frida, »was hast du zu Hause die ganze Zeit gemacht?«
Reni goss beide Tassen voll köstlich duftenden Kaffee und griff nach dem Brotkorb. Dabei hoffte sie, so unbefangen zu klingen wie es nur ging. Von ihren eigenen Sorgen mit den gemeinen Weibern ihrer Schicht zu erzählen, hatte sie noch später Gelegenheit.
»Na was schon?« Reni grinste. Auf keinen Fall wollte sie Frida erzählen, wie sie dauernd an Björn denken musste, und wie sie gezögert hatte, ihm zu schreiben, wie sehr sie sich nach ihm sehnte.
»Ausschlafen. Ein bisschen Nähen für die Verwandtschaft. Das Übliche eben…«
Weiter kam Reni nicht. Schon wieder läutete die Klingel. Diesmal ging Frida zur Tür. Draußen stand Crissi aus der Wohngemeinschaft gegenüber.
»Ihr feiert Wiedersehen. Nach Kaffee-Mix riecht es jedenfalls heute bei euch nicht.«
»Nee, man gönnt sich ja sonst nichts.« Frida kannte diese Spielchen. Alle Welt glaubte, dass sie das ganze Haus mit West-Kaffee versorgen könnte. Diesmal konnte sie zwei Pakete mitbringen, weil gerade der Onkel aus Stuttgart zu Besuch war. Und der Onkel aus dem Westen hatte immer für die darbenden Brüder und Schwestern etwas im Gepäck.
Die Mädchen schauten sich an, unschlüssig, was jede von der anderen erwartete.
»Ich habe …« Crissis Blick ging zu ihrer Tasche, doch dann zögerte sie wieder. »Ich meine… kann ich mal kurz?«
Frida zog ihre Schultern an und ging einen Schritt zur Seite. Ihren Standardsatz: Wenn es sein muss, hatte sie sich verkniffen. Wer sie kannte, wusste ohnehin von ihrer ironischen Ader.
»Möchtest du ein Brötchen mit uns essen?« Wieder einmal erkannte Reni, wie Recht Björn hatte mit seinen Worten: Du bist stets der Schatz, der keinem etwas Böses will. Du musst nur besser darauf achten, dass du auch mal ein Echo zurückbekommst.
Bei den beiden, Frida und Crissi, musste sie keine Sorge haben. Sie waren ihr stets wohlgesonnen, dem Anschein nach jedenfalls, vor dem sie Björn ebenso gewarnt hatte. Nichts ist, wie es scheint. Wie wahr!
»Ich dachte eher an einen Kaffee«, meinte Crissi, »wenn ihr schon das ganze Haus damit verrückt macht.« Sie lachten, während Frida den wackeligen Hocker aus dem Bad mit einem Sitzkissen drapierte und ihn für Crissi zwischen Sofa und Wand schob.
»Heute gab es in der Kaufhalle Yogurette. Eine Tafel pro Kunde. Ich habe eure Ration mitgebracht. Na, wie bin ich…?« Tatsächlich zog sie grinsend zwei der Tafeln aus ihrer Tasche und legte sie triumphierend vor jeden der beiden Frühstücksteller. Crissis Gesicht spiegelte Heiterkeit: »Oder hat hier wirklich einer geglaubt, ich komme nur Kaffee schnorren?«
Reni stutzte. Es war kein Wunder, dass sie nichts von der Westware erfahren hatte. Zu fürsorglich hatte sie nur schnell nach den Brötchen und einer Flasche Milch gegriffen. Vielleicht aber war sie mit ihren Gedanken schon wieder bei Björn. War sie noch immer nicht fertig mit der Erniedrigung durch Michelle? Sie wusste es nicht mehr. Dabei musste man immerzu genau nachsehen, was die Kaufhalle an begehrten Dingen anbot. Manchmal reichten die keine zwei Stunden. Zum Glück gab es noch Menschen wie Crissi. Man lebte unter denselben Einschränkungen, genoss dieselben Freuden, erlitt dieselben Ängste und frönte denselben Hoffnungen. Das Solidarische lag in ihren Biografien, dazu musste man sich nicht zwingen.
»Und das ging so einfach?«, staunte Frida. Sie war die einzige der Mädchen, die den Unterschied zwischen Yogurette und Van Houten Edelschokolade gut kannte. Yogurette war nur ein überzuckerter Versuch, mit einer hübschen Verpackung höchsten Genuss zu suggerieren.
»Was ist denn heute einfach«, lachte Crissi. »Die Thea von der Bibliothek war dabei und hat bestätigt, dass ihr beide…«
»Die Thea? Die mit dem Matrosen?«
»Die mit dem Matrosen.«
Ein bisschen verlegen schaute Reni auf die begehrte West-Nascherei. Die Blicke, die sie mit Frida tauschte, verrieten etwas von Bedauern über Crissis vermeintliche Störung. »Jedenfalls haben unsere Menschenfreunde da oben mal wieder keine Devisen für uns gescheut«, raunte Crissi.
»Mein Vater sagt, das sind Kompensationsgeschäfte. Unser begehrtes Jersey für deren Bananen und Kaffee.«
Als ob Bananen und Kaffee in Westdeutschland gedeihen.
»Schau dir die Neckermann-Kataloge an«, steuerte Frida bei. »Die Marke Privileg, reihenweise unsere Kühlschränke und unsere Waschmaschinen, ganz eindeutig. Und billig noch dazu. Für Devisen machen die scheinbar alles.«
So etwas weiß man nur, wenn man Westverwandtschaft hat. »Da sieht man 's wieder«, Crissi gab sich Mühe, locker zu klingen, »unsere Produkte haben eben das Privileg, von verwöhnten Westlern für wenig Geld gekauft zu werden.«
Drei junge Mädchen nickten einig, aber keine sprach aus, dass etwas stank im Staate, der sogar den Mangel für den Ansporn gebrauchte, noch höhere Leistungen zu erbringen.
»Da weißt du es mal wieder, warum du dich anstrengen musst, Reni. Volle Leistung bitte«, sagte Crissi, die längst nach einem Brötchen gegriffen hatte und bereits kraftvoll hineinbiss. Erst neulich hatten sie sich über die Sollsteigerung unterhalten, die vom Kumpel Adolf Hennecke ausgegangen war. Einer aus der Runde wusste, dass es genau deshalb vor mehr als zwanzig Jahren zum berüchtigten 17. Juni geführt hatte. Auch die Mädchen hatten keine einheitliche Meinung über die Achtfach-Bedienung ihrer Großrundstrickmaschinen im Kombinat, aber die meisten waren stolz, dass es funktionierte und man seinen Beitrag leisten konnte, damit es aufwärts ging.
»Du hast wohl verpasst, dass Reni in ihrer Schicht die Beste ist«, konterte Frida.
Reni hob die Hand und griff nach der Kanne, in der nur noch eine Tasse Kaffee sein konnte. Begehrte Dinge wurden stets gut dosiert.
»Ich habe ja tolle Dinge von dir gehört.« Crissi grinste übermütig.
»Wenn sie wirklich toll sind, sind sie wahr. Ansonsten sind sie nur das Produkt von Neid«, erwiderte Frida, die jede Regung von Reni richtig einzuschätzen glaubte. Reni blieb still, goss in jede der Tassen noch einen letzten Schluck nach und trug die leere Kanne wortlos zur Küchennische. Dort hinter der Wand holte sie erst einmal tief Luft. Diese Zicken! Gemeiner ist niemand in der ganzen Schicht. Schade, dass ich darüber jetzt nicht mit Björn reden kann.
Sie fasste sich und ging zurück, in der Hoffnung, ihr Gesicht hatte sich wieder entspannt.
»Eva hat mir erzählt …«
»Eva?«, wunderte sich Reni. »Nicht Michelle?«
»Ja.«
»Was: ja«, wollte Frida wissen.
»Ja, Eva.« Crissi zögerte jetzt. Renis Liebschaft ging sie nun wirklich nichts an, was sie ebenso von Eva dachte.
Reni drehte sich erst weg, dann stand sie wiederum auf und trug auch das Geschirr zur Spüle. Eine Erklärung gab sie den beiden nicht.
Es war zehn Minuten nach zehn Uhr, als sich Crissi erhob, um zu gehen, weil sie erkannt hatte, nach ihrer guten Absicht ein falsches Wort gesagt zu haben. Bevor sie aus der Tür ging, drehte sie sich nochmal zu Reni um. »Ich wünsch dir viel Glück in der Liebe, und danke für…« Reni wäre keine Antwort mehr gelungen. Ein furchtbarer Knall erschütterte das Haus, ein Feuerball schoss durch die Etagen und ihre bisher heile Welt verwandelte sich in eine heiße Hölle.