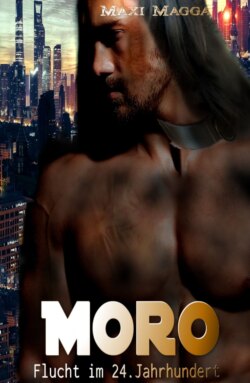Читать книгу MORO - Maxi Magga - Страница 4
ОглавлениеVerzweiflung kroch langsam, aber unaufhaltsam in seine Seele. Sie lähmte den Geist, so wie die Nässe und Kälte dieses Apriltages den Körper hemmte. Dazu dieser Hunger! Moro, der eigentlich Moron hieß wie sein Vater, den jedoch nahezu alle bloß Moro nannten, wusste nur zu gut, was es bedeutete, Hunger zu haben. Er lebte mit ihm, solange er denken konnte. Schon seit Tagen hatte er kaum etwas Essbares gefunden. In seiner Not versuchte er, den grimmigen Magen mit Gras und vereinzelt aufgesammelten Insekten zu beschäftigen. Am Vortag stritt er sich sogar in Sichtweite eines Dorfes mit einem abgemagerten Hund um dessen Beute. Kratzer in der Haut und ein tiefer Riss in der alten, ohnehin zu dünnen Jacke zeugten von dem erfolglosen Kampf. Vom ersten Tag seiner Flucht an – Wie lange war das jetzt her? Drei Wochen? Er hatte längst die Kontrolle verloren. – war seine Kleidung feucht und klamm. Die Füße waren wund und blutig, obwohl er die zu großen Schuhe so komfortabel wie möglich mit Gras und Moos ausgestopft hatte.
Das war nicht das Schlimmste, das alles konnte er ertragen. Er hatte schon weit Härteres aushalten müssen. Dass er sich verirrt hatte, war es, was ihm jeden Mut raubte. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wo er war. Als Kind der verachteten F-Kaste hatte er nie zur Schule gehen dürfen. Da er sie nicht lesen konnte, ergaben die Ortsschilder für ihn keinen Sinn. Bis vor drei oder vier Tagen, er erinnerte sich nicht genau, hatte er sich mit Hilfe des Kartendispensers mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. Mühsam hatte er die Form jedes einzelnen Zeichens auf den Straßenschildern mit denen auf dem Display verglichen. Häufig hatte auch das nicht weitergeholfen, weil er der Karte zufolge einen Wald, einen Hof oder eine Stadt hätte vorfinden müssen. Aber da gab es keinen Wald oder Hof und die Stadt hatte einen anderen Namen. War er an einem falschen Ort? Oder hatte sich vielleicht die Gegend verändert? Das Gerät war schließlich schon älter als er selbst. Wie auch immer, jetzt schien es endgültig defekt zu sein. Mitten in seinem Bemühen sich zu orientieren, hatte sich das Display einfach verdunkelt. Ja, wenn Ferine dabei gewesen wäre, so wie sie es geplant hatten, die hätte bestimmt gewusst, was zu tun war. Aber Moro war allein verloren. Ihm war nur erschreckend klar, dass er nicht wusste wohin und dass er noch weit von seiner Heimat und damit von seiner Frau und seinem Kind entfernt war. Dass nichts und niemand ihm helfen würde. Nur der Gedanke an die geliebten Menschen trieb ihn seit Wochen durch die Kälte voran. Und die Worte seines Vaters, die sich so tief in sein Gedächtnis eingegraben hatten, dass er sie abends vor dem Einschlafen, morgens beim Aufwachen und während der Verzweiflung des Tages zu hören glaubte: Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Du musst zurück zu deiner Familie.
Auch jetzt hörte er diese Stimme, nur leiser als sonst. Die Hilferufe seines Körpers klangen lauter. Er konnte nicht mehr. Nicht einen einzigen Schritt. Seit dem Vorabend saß er zusammengekauert im Windschutz der Reste einer alten Mauer und wartete. Hätte ihn jemand gefragt worauf, er hätte es nicht sagen können.
Lange bevor der Schall ihn erreichte, hatte sein Unterbewusstsein etwas wahrgenommen. Moro erwachte aus seiner Lethargie und sah sich um. Vor dem Gemäuer, an dem er Schutz gesucht hatte, fiel das Gelände einige Meter ab bis auf eine marode Straße. Von dort unten drangen leises Klirren und Marschgeräusche herauf. Moro duckte sich wieder hinter die Mauer und spähte den Weg entlang. Und da sah er sie. Eine Doppelreihe von mehr als einem Dutzend Männern in zerlumpter Kleidung, manche von ihnen barfuß. Jeder Einzelne trug Hand- und Fußfesseln. Keine Kastenabzeichen. Sklaven. Wie er. Moro konnte den Blick nicht von dem elenden Haufen abwenden. Er sah sich selbst darin. Dieser Trupp wurde offensichtlich von drei Aufsehern zu einem Einsatzort geführt, denn jeder von ihnen trug Arbeitsgeräte mit sich.
Vor Entsetzen unfähig sich zu bewegen, starrte Moro auf das abschreckende Bild unter ihm und hörte die leisen Schritte nicht, die sich hinterrücks näherten, bis es zu spät war. Die beiden scharfen Spieße der großen, metallenen Gabel bohrten sich links und rechts von seinem Hals in den Boden und drückten ihn nieder. Fast gleichzeitig spürte er, wie seine Hände auf den Rücken gedreht und mit Handschellen fixiert wurden. Bevor er verstand, was vor sich ging, lag er gefesselt auf den Knien vor zwei mit Betäubungstasern und Peitschen bewaffneten Männern.
Einer von ihnen riss Moros Kopf an den Haaren nach hinten und schüttelte ihn heftig.
„Seit zwei Tagen soll sich hier ein Strolch herumtreiben. Gut möglich, dass das jetzt ein Ende hat. Oder was meinst du?“
Moro rührte sich nicht. Er hielt die Lider tief gesenkt, damit ein versehentlicher Blick in die Augen den anderen nicht beleidigte. So hatte man es ihm eingeprügelt.
„Sieh an! Kein Kastenabzeichen! Das wird ja immer besser! Du kommst mit. Und dir gebe ich heute Abend einen auf deine scharfen Augen aus“, rief er seinem Kollegen hinterher, der bereits den Abhang hinunterrutschte.
Er riss seinen Gefangenen auf die Beine und erreichte mit ihm trotz einiger Schwierigkeiten die Männer, die auf der Straße warteten.
„Wollen doch mal sehen, was du so mit dir herumträgst. Ausziehen!“, herrschte er ihn an und nahm die Handschellen ab.
Moro gehorchte. Sie durchsuchten seine Kleidung und leerten die Schuhe. Rücksichtslos zerrten sie an dem Metallband um seinen Hals, das der Herr ihm einst angelegt hatte, um ihn mit Stromstößen unter Kontrolle zu halten. Da sie es nicht abnehmen konnten, verloren sie bald das Interesse daran. Stattdessen fuchtelte einer der Bewacher mit wutrotem Gesicht mit dem kleinen Taschenmesser, das er in einer Jackentasche gefunden hatte, dicht vor Moros Augen herum.
„Was hast du denn damit vor? Los, sprich schon! Kannst du nicht reden? Soll ich es dir sagen? Das ist eine Waffe, die du benutzen wolltest, um unschuldige Menschen zu berauben. Gib es ruhig zu! Du bist ohnehin geliefert. Oder ist es etwa dazu da, um kleine, anständige Mädchen zu zwingen, sich mit dir abzugeben, du Stück Dreck? Wie viele hast du schon belästigt? Antworte endlich, verdammt. Ich bringe dich zum Reden, darauf kannst du Gift nehmen.“
Der Mann, offensichtlich der Anführer der Gruppe, redete sich in Rage. Das begleitende Wachpersonal grinste, die angeketteten Sklaven ließen ängstlich die Köpfe hängen, als ob sie selbst im Fokus des Wutausbruchs stünden. Moro stand nur da, starrte auf den Boden vor seinen Füßen und schwieg. Zu groß war seine Angst, ungewollt auch nur mit einem Wort zu verraten, von wo er geflohen war.
Ein weiterer Aufseher mischte sich ein.
„Seht mal, was ich gefunden habe. Das ist doch so ein Kartending. Oder irre ich mich? Sowas wollte ich schon immer haben. Aber das da scheint nicht zu funktionieren. Scheiße! Warum schleppt der Idiot kaputten Kram mit sich herum?“
„Lass den Blödsinn gefälligst, hier geht es nicht um Kinderkacke. Leibesvisitation!“, fuhr der Truppführer seinen Untergebenen an.
Moros Herz begann zu rasen. Die Geschehnisse im Haus seines Herrn zerrten augenblicklich wieder an jedem Nerv. Er musste sich komplett ausziehen, Arme und Beine spreizen, die Haare ausschütteln und sich eingehend inspizieren lassen. Zum Schluss fuhr ihm einer der Aufseher mit schmutzigen Fingern durch die Mundhöhle.
„Haltet euch ran, Männer, wir haben nicht ewig Zeit. Ihr habt da was vergessen.“
Moro wurde auf die Knie gezwungen, die Doppelspießgabel presste seinen Kopf in die feuchte Erde. So hatten sie ihn in der Position, in der sie ihn haben wollten. Rücksichtslos suchten sie im Rektum nach irgendetwas, das ihn belasten würde. Sie fanden nichts.
Der Anführer verlor die Kontrolle. Er trat den hilflosen Gefangenen, wo immer er ihn treffen konnte, und fuhr ihn an zu gestehen.
„Verdammt, mach dein Maul auf. Wie viele anständige Bürger hast du angegriffen? Wo hast du die Beute versteckt?“
Doch Moro schwieg eisern. Einzig ein schmerzvolles Stöhnen kam über seine Lippen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging einer der Männer dazwischen.
„Es ist genug, Jago. Lass mir noch etwas von ihm übrig. Wir sind spät dran.“
Der Jago genannte Wortführer funkelte ihn wütend an. Doch er beruhigte sich, nickte und ermahnte ihn, bald nachzukommen. Gleichmütig, wie er gekommen war, zog der Trupp weiter. Moro zog seinen Kopf ein wenig aus dem Schlamm, in den er getreten worden war, und spuckte. Modrige, sandige Erde, vermischt mit seinem Blut, verstopfte Mund, Nase und Augen. Zuviel Freiheit war ihm jedoch nicht vergönnt. Sofort stand der Wächter bei ihm und erneuerte den Druck der Doppelspießgabel.
„Nicht so eilig, mein Bester. Für ein bisschen Spaß sollte immer Zeit sein, meinst du nicht? Also, was ist dir lieber? Das …“, fragte er mit freundlicher Stimme und fasste sich in den Schritt, „oder das?“ Dabei zeigte er Moro einen faustdicken Ast mit bröckelnder Rinde und kleinen Auswüchsen.
Moro schrie auf.
„Nein, bitte nicht. Nein!“
„Na, schau mal einer an! Du kannst ja tatsächlich sprechen! Gut, du hast dich entschieden. Still halten!“
Moro ergab sich in sein Schicksal. Er rang nur noch darum, nicht von der Gabel erstickt zu werden. Er kämpfte um nichts als das nackte Überleben.
Endlich ließ der andere von ihm ab und befahl ihm, sich wieder anzuziehen. Er legte ihm Fußketten an, wie die Männer in der Kolonne sie tragen mussten, und zog die Arme auf dem Rücken in die Höhe, wo er die Hände zusammenband. Dann schlang er einen Lederriemen oberhalb des Ringes um den Hals, den er an den Handschellen verknotete. So trieb er seinen Gefangenen vor sich her.
Moro hatte mit beträchtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da die Graseinlagen fehlten, spreizte er verzweifelt die Zehen in den großen Schuhen, um diese nicht zu verlieren. Der Aufseher legte ein schnelles Tempo vor, ihm blieb nichts anderes übrig, als in einen trippelnden Laufschritt zu fallen, um trotz der knappen Kette zwischen den Füßen mitzuhalten. Die auf den Rücken gebundenen Arme schmerzten schon nach kurzer Zeit, aber er musste sie dennoch hochhalten, damit sie nicht an dem Riemen um seinen Hals zogen und so das Atmen behinderten. Und noch immer blinzelte er gegen den Dreck in seinen Augen an. Doch am meisten litt er unter dem Unrecht, das ihm so grundlos angetan wurde.
Moro hatte keine Vorstellung, wie lange sie so den Weg entlang hetzten, bis sie die anderen eingeholt hatten. Die Sklaven arbeiteten an einem Hang, den sie roden sollten, ihre Bewacher saßen, sich unterhaltend, auf Baumstämmen dabei und tranken dampfend heiße Getränke aus ihren Isolierflaschen.
„Das wird aber auch Zeit“, wurden sie begrüßt. „Schick den da in den Hang zu den anderen. Ich entscheide heute Abend, was mit ihm geschieht.“
So schuftete Moro trotz seiner Verletzungen, bis bei Einbruch der Dämmerung zum Aufstellen gerufen wurde. Schwankend vor Schwäche erwartete er das Machtwort, das seine Zukunft bestimmen würde.
„Mit dem ist beim Chef kein Blumentopf zu gewinnen. Damit halse ich mir höchstens zusätzliche Verwaltungsarbeit auf. Jagt ihn weg. Aber das Messer bleibt hier“, ordnete der Anführer an und hatte den kleinen Zwischenfall bereits vergessen.
Moro schnappte sich die Schuhe, die er während der Anstrengungen im Hang nicht hatte gebrauchen können, da er fürchtete abzurutschen, und lief, so schnell es ihm möglich war, auf der Straße zurück. So bald wie möglich, verließ er den öffentlichen Weg und versuchte, abseits davon unterzutauchen. Dankbar trank er Wasser aus einer Pfütze, die er in einem Graben entdeckte, und kroch für die Nacht unter einen ausladenden Busch. Schlaflos kämpfte er darum, die Schmerzen, den Hunger und die ihm zugefügten Erniedrigungen zu verdrängen, indem er sein ganzes Denken und Fühlen auf seine Frau Vanisa richtete. Die Qual, sie nicht bei sich zu haben, sie vielleicht nie mehr in den Armen halten zu dürfen, ließ alles andere dahinter klein und nichtig werden.
Das Morgengrauen fand Moro wieder unterwegs. Blindlings hielt er an der Richtung fest, die er schon am Vortag eingeschlagen hatte.
Zwei Tage später war klar, er hatte sich geirrt. Die Mauer, die ihm damals Schutz geboten hatte, schien ihn jetzt zu verhöhnen. Achtundvierzig Stunden im Kreis gelaufen. Achtundvierzig Stunden voller Mühen und Selbstverleugnung und er war keinen Schritt weiter gekommen. Wenige Meter unter sich sah er auf der Straße den defekten Kartendispenser liegen. Dieser Moment, der jeden Zweifel zunichtemachte, raubte ihm die letzte Zuversicht. Ohne zu wissen warum, holte er das Gerät herauf und wischte den Schmutz ab. In Moros Herz blieb pure Verzweiflung zurück. Er überließ sich wehrlos dem Schmerz, sank hart zu Boden und rollte sich zusammen.
Die Stimme seines Vaters ließ sich dadurch nicht zum Schweigen bringen.