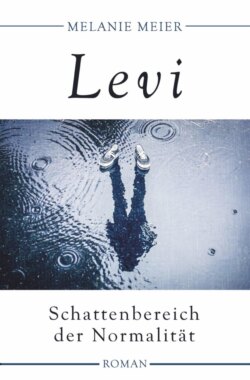Читать книгу Levi - Melanie Meier - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление24.04.1996
Als er zu Hause ankam, legte er sich in sein Bett und schlief. Zwei Stunden später weckte ihn seine Mutter.
»Wieso bist du daheim und nicht im Krankenhaus?«
»Ich bin gesund.«
Sie setzte sich an die Bettkante, nahm seinen Kopf in beide Hände und sah sich die Platzwunde an. Danach begutachtete sie seine Hand, tastete sie ab und bewegte die Finger. Ihr Blick war unergründlich.
»Wir wohnen solange bei Hilda. Das Haus muss renoviert werden, es ist nicht mehr sicher.«
Levi nickte.
»Steh auf und geh duschen. Ich packe deine Kleidung ein. Wir fahren noch einmal ins Krankenhaus.«
»Ich bin gesund«, wiederholte Levi.
»Das entscheiden die Ärzte.« Seine Mutter stand auf, kehrte ihm den Rücken zu und fing an, den Kleiderschrank auszuräumen.
»Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe.«
Sie hielt inne, drehte sich aber nicht um. »Geh und wasch dich.«
Eine halbe Stunde später stiegen sie ins Auto und fuhren zurück ins Krankenhaus. Die ältere Krankenschwester war wieder da. Sie sagte, sie hätten Levi schon überall gesucht. Sie begleitete seine Mutter und ihn in einen Wartebereich, und fast eine Stunde später kam jemand, der Levi für eine Röntgenaufnahme abholte. Als er zurück in den Wartebereich kam, unterhielt seine Mutter sich mit einem Arzt. Levi ging zu ihnen. Die beiden verstummten und betrachteten ihn.
»Kommen Sie nach den Untersuchungen in den dritten Stock«, sagte der Arzt schließlich. »Dann sehe ich mir Ihren Jungen mal an.« Er drehte sich um und verließ den Raum.
»Was will er ansehen?«
Seine Mutter führte ihn zurück zu den Stühlen, sie setzten sich. »Er wird dich ein paar Sachen fragen. Das ist alles.«
Sie wurden aufgerufen und folgten einer Schwester in einen Behandlungsraum. Einer der Ärzte, der Levi betreut hatte, wartete dort auf sie. Er gab seiner Mutter die Hand und bat sie, sich zu setzen.
»Der Mittelhandbruch ist verheilt«, sagte er. »Komm mal her, Levi.«
Levi stellte sich hin, der Arzt tastete seinen Kopf ab.
»Auch die Platzwunde ist geheilt. Ich entferne gleich die Fäden. Setz dich.« Der Arzt sah Levis Mutter an. »Das nenne ich eine Blitzheilung. Ich kann es mir nur so erklären, dass wir uns getäuscht haben und kein Mittelhandbruch vorgelegen hat. Vielleicht eine Verwechslung der Röntgenbilder.«
»Dann können wir gehen?«
»Ja. Ich nehme nur noch rasch die Fäden heraus.«
Anschließend fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock. Seine Mutter meldete sie bei der dortigen Station am Empfang an, und wieder mussten sie warten. Levi hielt sich still, weil er wusste, dass seine Mutter nicht gut auf ihn zu sprechen war. Sie war sicher noch wütend, weil er sie geschlagen hatte.
Der Arzt aus dem Wartezimmer kam und holte sie ab. Wieder waren sie in einem Behandlungszimmer, dieses Mal aber saß Levi direkt vor dem Arzt, seine Mutter im Hintergrund. Der Arzt wirkte nett.
»Wie alt bist du, Junge?«
»Dreizehn.«
»Gefällt es dir in der Schule?«
»Geht so.«
»Hast du viele Freunde?«
»Einen. Phil. Die anderen kenne ich nur, wir spielen zusammen.«
»Und deine Noten? Wie sehen die aus?«
Levi zuckte mit den Schultern. »Einser und Zweier.«
Der Arzt sah zu seiner Mutter hinüber. Als er wieder Levi anschaute, lächelte er. »Deine Mutter hat mir erzählt, dass bei euch daheim ein Unglück passiert ist. Die Decke im Wohnzimmer ist eingestürzt.«
Levi nickte.
»Kannst du dich daran erinnern?«
»Ja.«
»Willst du mir erzählen, was passiert ist?«
»Nein.«
Der Arzt hielt einen Moment inne. »Warum nicht?«
»Weil es schon vorbei ist.«
»Fühlst du dich anders als vor dem Unglück?«
»Ja. Es sind ein paar Tage vergangen seitdem. Außerdem war ich das erste Mal im Krankenhaus.«
»Kannst du in Worte fassen, wie du dich fühlst?«
»Anders als vorher.«
»Fühlt es sich besser oder schlechter an?«
Levi zuckte erneut mit den Schultern. »Spielt das eine Rolle?«
Der Arzt beugte sich ein bisschen vor und lächelte wieder. »Schau, Levi, deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Manchmal sind solche Ereignisse belastend. Wir wollen nur sichergehen, dass es dir gut geht.«
»Es geht mir gut.« Levi drehte sich auf dem Stuhl um und sah seine Mutter an. »Wirklich.«
»Levi«, sagte der Arzt und wartete, bis Levi sich wieder umwandte. »Deine Mutter hat mir auch erzählt, dass euer Nachbar bei diesem Unglück gestorben ist.«
»Ja. Er hatte ein schwaches Herz. Seine Zeit war gekommen.«
Wieder ein kurzes Innehalten des Arztes. »Wie meinst du das?«
»Er war alt. Ich konnte schon seit einigen Monaten riechen, dass er bald stirbt. Herr Gruber wusste es selber, er hat es mir gesagt.«
»Was hat er gesagt?«
»Er sagte jeden Tag, wenn ich ihn traf, dass es ein guter Tag wäre, um zu sterben.«
»War er freundlich zu dir, der Herr Gruber?«
»Er war zu niemandem freundlich. Er war grimmig, weil er wusste, dass er bald stirbt. Ich konnte es riechen.«
»Wie riecht jemand, der bald stirbt?«
»Alt. Wie der feuchte Keller von Phils Oma, in dem sie Obst und Gemüse aufhebt.«
Der Arzt lächelte nachsichtig. »Da war noch etwas, bevor das Unglück passiert ist. Willst du es mir erzählen?«
Levi wusste jetzt, worauf der Arzt hinauswollte. Er sah auf seine Hände im Schoß hinab und schüttelte den Kopf.
»Du hast deiner Mutter das Leben gerettet, nicht wahr?«
Levi zuckte mit den Schultern. Er fühlte seine Mutter im Rücken.
»Du hast sie geschlagen, weil sie nicht auf dich hören wollte. Und dann hast du sie aus dem Zimmer geschleift. Du bist ganz schön kräftig, was?«
»Es war nötig«, murmelte Levi.
»Ist dir unangenehm, darüber zu sprechen?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil ich meine Mutter nicht verletzen wollte. Ich wollte ihr helfen.«
»Das weiß deine Mutter.«
»Ja«, sagte seine Mutter. »Das weiß ich, Levi.«
»Deine Mutter möchte nur wissen, woher du wusstest, dass die Decke herunterkommt.«
»Ich habe es gesehen.«
Kurzes Schweigen.
»Hat sich der Putz schon gelöst? War es das, was du gesehen hast?«
Levi schüttelte den Kopf.
»Was tust du in deiner Freizeit gern, Levi?«
Überrascht über den Themenwechsel, sah Levi auf. Der Arzt hatte stahlgraue Augen.
Er sah ihn über ein Waschbecken gebeugt. Neben ihm lag eine leere Pillendose. Der Arzt war weggetreten. Hinter ihm auf dem Boden saß eine nackte Frau, die auch berauscht aussah. Sie grinste und kratzte mit ihren Fingernägeln über den Boden. Ihr Haar war nass.
»Nehmen Sie die Tabletten nicht«, sagte Levi. »Die machen Sie krank. Und die schöne Frau auch. Sie wird zu viele nehmen und sterben, und Sie werden sich das nie verzeihen.«
Jetzt dauerte das Schweigen länger. Im Gesicht des Arztes stand Entsetzen. Levi hörte, wie sich seine Mutter bewegte.
»Das meine ich!«, sagte sie. »Plötzlich sagt er solche Sachen zu den Leuten!«
Der Arzt wandte sich ab. Er tippte etwas in seinen Computer und schaute auf den Monitor. »Da müssen wir etwas unternehmen. Ich gebe Ihnen eine Überweisung mit. Gehen Sie mit ihm zu einem Psychiater.«
»Was glauben Sie, was das ist?«
Der Arzt sah seine Mutter ernst an. »Ich will keine voreilige Diagnose stellen, aber ich will auch ehrlich sein. Es könnte etwas schlimmer sein als erwartet.«
»Inwiefern?«
Jetzt richteten sich die stahlgrauen Augen doch wieder auf Levi. »Warum hast du das zu mir gesagt, Junge?«
Levi schwieg.
»Sehen Sie, er will dazu nichts sagen. Man muss erst einmal eine Vertrauensbasis aufbauen, um herausfinden zu können, was in ihm vorgeht. Darum rate ich Ihnen, zu einem Psychiater zu gehen und dort eine Therapie zu beginnen. Im Laufe der Zeit wird sich zeigen, wie krank Ihr Sohn ist.«
»Ich bin gesund«, sagte Levi.
»Wie ist Ihre erste Einschätzung?«, fragte seine Mutter.
Der Arzt holte tief Luft. »Basierend auf dem, was Sie mir geschildert haben, und aufgrund seiner Behauptung, er sehe Dinge, die nicht da sind, tippe ich auf etwas in Richtung Schizophrenie. Machen Sie sich darauf gefasst. Aber er ist noch jung, und mit der entsprechenden Medikation und Therapie kann man das bestimmt in den Griff bekommen.«
Levi drehte sich auf dem Stuhl um. »Mama, ich bin nicht krank. Wirklich nicht. Alles, was ich sehe, ist da. Es passiert wirklich. Hör nicht auf diesen Arzt. Er nimmt Tabletten und hat Angst, weil ich es weiß.«
»Bist du jetzt still!«, sagte seine Mutter. Sie stand auf. »Entschuldigen Sie. Es tut mir leid, dass er so etwas sagt.«
Der Arzt erhob sich ebenfalls. Seine Wangen waren gerötet. »Sie müssen sich nicht entschuldigen. Aber ich muss Sie jetzt bitten zu gehen. Ich habe weitere Termine. Ich wünsche Ihnen alles Gute.« Ohne Levi anzusehen, verabschiedete er sie an der Tür.
Im Auto liefen ihm die Tränen über die Wangen. Immer wieder versuchte er, seiner Mutter begreiflich zu machen, dass er nicht krank war, doch seine Mutter verbat ihm den Mund. Sie sah selbst aus, als könnte sie jeden Moment zu weinen anfangen.
Sie fuhren zu Tante Hilda, und dort setzte ihn seine Mutter in ein kleines Zimmer, in dem er seine Kleidung in eine Kommode räumen sollte. Während Levi das tat, konnte er hören, wie seine Mutter schluchzte und Hilda tröstend auf sie einredete.
06.05.1996
»Was weißt du über deinen Vater?«, fragte die Psychiaterin bei ihrer dritten Sitzung. Sie saß steif in ihrem Stuhl.
Levi saß zurückgelehnt in seinem Stuhl ihr gegenüber. Er sagte nichts.
»Deine Mutter hat mir erzählt, dass du ihn nicht kennst und dass sie dir nichts von ihm erzählt hat. Das stelle ich mir traurig vor. Interessiert es dich nicht, wer er ist?«
»Mama sagt, dass er kurz vor meiner Geburt ging.«
»Bist du deshalb traurig?«
Er sah die Frau an. »Er hat Mama und mich bestimmt bald vergessen.«
»Das kann sein. Aber meine Frage ist, ob dich das traurig macht.«
»Wären Sie traurig?«
»Bestimmt.«
»Dann nehmen Sie doch Ihre Antwort. Sie werden eh zu meiner Mutter sagen, dass ich krank bin, ganz egal, was ich Ihnen sage.«
Sie lächelte. »Ich werde sagen, was ich für die Wahrheit halte. Wir alle wollen dir nur helfen, Levi.«
»Die Wahrheit ist für jeden anders. Sie kennen meine doch gar nicht. Wenn Sie mir helfen wollen, dann sagen Sie meiner Mutter, dass ich gesund bin, damit ich wieder nach Hause gehen kann.«
»So einfach ist das leider nicht.« Sie lächelte wieder. »Dass du diese Dinge siehst, von denen mir deine Mutter erzählt hat, ist nicht schlimm. Wenn wir zusammen herausfinden, wie das genau bei dir ist, können wir dir helfen, damit es aufhört. Und dann bist du ein ganz normaler Junge wie alle anderen auch. Das möchten wir erreichen, Levi, und dafür brauche ich deine Hilfe.«
»Ich bin ein ganz normaler Junge.«
»Siehst du denn Dinge, die andere nicht sehen?«
»Ich weiß nicht, was andere sehen. Ich kann nicht die ganze Welt danach fragen.«
»Siehst du Sachen, die beispielsweise deine Mutter nicht sieht?«
»Meine Mutter sieht viel nicht. Sie hat nicht gesehen, dass mich der Mann, den sie zuletzt als Freund hatte, beim Schlafen und Duschen beobachtet hat. Sie hat es erst gesehen, als ich es ihr gesagt habe.«
»War das so?«
»Ja.«
»Hat er dir etwas getan, dieser Mann?«
»Nein. Ich habe ihm gesagt, dass ich es weiß, und dann ist er gegangen und nicht wiedergekommen.«
»Wie hat deine Mutter darauf reagiert?«
Levi senkte den Kopf und schwieg.
»Du kannst mit deiner Mutter nicht darüber sprechen, richtig? Erzähl mir, wie es war, als dir dieser Mann zugesehen hat.«
»Davon kann ich nicht erzählen. Ich habe ihn nicht gesehen, denn entweder schlief ich oder ich duschte.«
»Woher wusstest du dann, dass er dir zusieht?«
Levi erwiderte ihren Blick schweigend.
»Hast du ihn vielleicht doch einmal dabei erwischt?«
»Nein. Er war sehr vorsichtig.«
Die Psychiaterin wartete. Levi sah ihr in die graugrünen Augen.
Sie lag im Bett, ein Tuch um den Kopf gewickelt. Ihre Haut war weiß und runzelig. Sie war sehr dünn. Obwohl sie bei Bewusstsein war, schien es, als schliefe sie mit offenen Augen. Ihre Lippen waren aufgesprungen.
»Sie sollten Ihr Blut untersuchen lassen«, sagte er. »Sie haben eine Krankheit.«
Schweigen. Die Psychiaterin blinzelte mehrmals hinter ihrer Brille.
»Hast du das jetzt gerade gesehen?«
Levi nickte langsam. »Ihr Blut. Es ist Ihr Blut.«
Die Frau wurde bleich. Sie legte den Stift auf den Tisch, mit dem sie immer spielte, nahm die Brille ab und putzte die Gläser.
»Es ist kein Brustkrebs. Das stimmt nicht.«
Sie wurde noch bleicher. »Woher …« Sie sah ihn ohne Brille lange an. »Erzähl mir, was dich veranlasst hat, das zu sagen.«
»Ich sage es, weil ich Ihnen helfen will. Man wird Sie operieren, aber das ist nicht nötig. Es ist falsch. Es ist das Blut.«
Ihr Mund verengte sich zu einem Strich. Sie setzte die Brille wieder auf. »Levi, ich verstehe, dass du nicht anders kannst. Du möchtest helfen. Aber es ist nicht richtig, einfach Dinge zu sagen, von denen man nichts weiß. Du verunsicherst die Leute. Du möchtest doch nicht, dass man das mit dir macht, oder? Dann mach es auch nicht mit den Leuten um dich herum.«
»Ich verunsichere Sie nicht, ich sage die Wahrheit. Gehen Sie und lassen Sie Ihr Blut untersuchen.«
»Was hast du gesehen? Wer hat dir das gesagt?«
»Niemand.«
»Was hast du gesehen?«
»Sie.«
»Jetzt gerade?«
»Ja.«
»Was habe ich getan?«
»Sie lagen in einem Bett, mit einem Tuch auf dem Kopf. Sie waren sehr krank. Man hat die Krankheit zu spät erkannt.«
»Levi, wir sind uns einig, dass wir gerade alle beide auf Stühlen in meiner Praxis sitzen, ja?«
Levi nickte.
»Liege ich in einem Bett?«
»Nein.«
»Trage ich ein Tuch auf dem Kopf?«
Er verneinte und sah in seinen Schoß.
»Levi«, ihre Stimme klang jetzt sanfter, »wie kommst du also darauf, ich läge in einem Bett?«
Er zuckte mit den Schultern. Schweigen folgte.
»Manchmal passieren Dinge in unseren Köpfen, in den Gehirnen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Sie spielen uns etwas vor, das nicht wirklich passiert. Kannst du dir vorstellen, dass das bei dir so ist?«
Levi hob den Blick. »Nein. Was ich sehe, passiert. Manchmal dauert es länger, bis es passiert.«
Die Psychiaterin überlegte. »Spielst du gern?«
»Ja. Mit Lego.«
»Was zum Beispiel spielst du mit Lego?«
Levi dachte nach. »Gestern habe ich mit Phil, meinem Freund, eine Stadt aufgebaut. Da gab es fliegende Autos.«
»Das hört sich schön an. Ist die Stadt, die ihr gebaut habt, Wirklichkeit?«
»Vielleicht irgendwann.«
»Ist sie jetzt wirklich?«
»Nein.«
»Ihr habt also eure Phantasie benutzt, um etwas zu erfinden, das es nicht gibt. Das macht unser Gehirn. Manche Leute können nicht unterscheiden, was wirklich ist und was nicht, sie sehen den Unterschied zwischen Phantasie und Wirklichkeit nicht. Ich glaube, dass das bei dir auch manchmal vorkommt.«
»Ich kann das unterscheiden.«
»Aber du hast mich gerade in einem Bett gesehen.«
»Das ist etwas anderes.«
»Gibt es noch andere Dinge, die du siehst? Menschen vielleicht, die deine Mutter oder Phil nicht sehen?«
Wieder schwieg er.
Die Psychiaterin nickte und notierte etwas. »Sind es Menschen?«
»Nein.«
»Andere Wesen?«
»Nein.«
»Aber irgendetwas siehst du. Willst du mir davon erzählen?«
»Nein.«
»Macht dir das, was du siehst, Angst?«
Levi dachte an die Schatten. Sie kamen nachts, meistens nachts. Er nickte vorsichtig.
Die Frau lächelte. »Du erzählst mir davon, wenn du es für richtig hältst, okay? Eines kann ich dir aber sagen: Du musst dich davor nicht fürchten, was auch immer es ist. Es ist nicht wirklich. Es passiert nur in deinem Kopf. Glaubst du, es würde dir helfen, wenn ich mit deiner Mutter darüber spreche? Damit du das nächste Mal, wenn du dieses Etwas siehst, zu ihr gehen kannst und sie dir mit ihrer Gegenwart hilft?«
»Nein. Das hilft nicht.«
»Ich werde es deiner Mutter trotzdem sagen, und wenn du das nächste Mal doch den Wunsch verspürst, zu ihr zu gehen, dann mach es. Unsere Zeit ist jetzt leider schon um, Levi. Hast du noch etwas auf dem Herzen, ehe ich dich wieder deiner Mutter übergebe?«
»Muss ich wieder herkommen?«
Die Psychiaterin nickte. »Ja. Wir werden einige Zeit miteinander verbringen. Du wirst sehen, dass es dir hilft.«
»Muss ich weiter diese Tabletten nehmen?«
»Sie helfen dir auch. Sie werden machen, dass du diese Dinge nicht mehr sehen musst.«
Levi schüttelte den Kopf. »Seit ich sie nehme, bin ich anfälliger. Es wird schlimmer.«
Die Psychiaterin notierte wieder etwas. »So was musst du mir immer sofort sagen. Ich rede mit deiner Mutter, du bekommst andere Tabletten. Da muss man manchmal verschiedene probieren, bis man die richtigen gefunden hat.« Sie stand auf. »Warte hier. Ich gehe rasch zu deiner Mutter, und dann kannst du endlich nach Hause.«
Sie aßen zu Abend. Levi sah immer wieder von seinen Pfannkuchen auf und zu seiner Mutter hin, die nur in ihrem Essen stocherte. Soweit er sich erinnern konnte, war seine Mutter blass und traurig. Jetzt war es, als habe die Traurigkeit eine neue Tiefe erreicht.
Ihre Blicke begegneten sich.
»Nimm dir noch einen«, sagte Mutter und zeigte auf die Pfannkuchen, die auf einem Teller aufgetürmt lagen. »Hilda kommt erst spät heim, sie hat Nachtdienst. Wir werden morgen leise sein müssen, der Beruf der Altenpflegerin ist nämlich anstrengend. Sie muss ausschlafen können.«
Levi nickte. Er nahm sich keinen weiteren Pfannkuchen, er hatte keinen Hunger mehr.
»Wie findest du die Ärztin? Verstehst du dich mit ihr?«
»Ja. Sie ist nett. Aber ich will nicht noch mal zu ihr. Sie glaubt, ich bin verrückt.«
Seine Mutter sah ihn an. In ihren Augen sammelten sich Tränen. Levi griff unwillkürlich über den Tisch und legte seine Hand auf ihre. Seine Mutter lächelte, als er das tat.
»Du bist ein guter Junge«, sagte sie. »Zusammen stehen wir das durch, hörst du? Wir beide, wir werden das hinkriegen.«
Levi wollte sagen, dass es nichts gab, was sie durchstehen mussten, aber er hatte einen Kloß im Hals. Er wusste, sie würde ihm nicht zuhören. Sie wollte nicht hören, was er zu sagen hatte.
»Ich gehe Zähne putzen.« Er stand auf, lief ins Badezimmer, sperrte hinter sich ab und setzte sich auf den Teppich. Das Gesicht in den Händen vergraben, weinte er lautlos.
Als er einige Minuten später den Kopf hob, sah er die Drillinge zum ersten Mal. Sie standen Schulter an Schulter an Schulter hochaufragend vor ihm und schauten ihm in die Augen. Er konnte durch sie hindurchsehen, aber sie waren da. Und er hatte keine Angst, nicht wie bei den Schatten. Ihre Gegenwart war angenehm. Trotzdem konnte er sich nicht bewegen.
»SEIN HERZ ERSCHRECKE NICHT UND FÜRCHTE SICH NICHT«, sagten sie. Sie sprachen gleichzeitig, ihre Münder bewegten sich, aber es hörte sich wie eine einzelne Stimme an. »ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN.«
Levi starrte sie an.
»KEINE TABLETTEN NEHME ER ZU SICH. FREI IST DER GEIST IN SEINER NATÜRLICHKEIT.«
Während sie ihn weiterhin ansahen, verblassten sie. Übrig blieben nur das Badezimmer und das angenehme Gefühl.
Levi wusste sofort, dass sie gut waren. Woher auch immer sie kamen, sie hatten bestätigt, was er gefühlt hatte: Die Tabletten, die ihm die Psychiaterin gab, durfte er nicht nehmen. Sie machten ihn anfällig. Sie zogen die Schatten an.
Er stand auf, putzte sich die Zähne, wusch sich das Gesicht und zog seinen Schlafanzug an. Als er in sein vorübergehendes Zimmer lief, in dem eine Matratze auf dem Boden sein Bett darstellte, formte sich in ihm der Plan: Er würde jeden Morgen die Tablette in den Mund schieben, mit Wasser nachspülen, die Tablette aber nicht schlucken. Er würde auf die Toilette gehen und dort das Ding hinunterspülen.