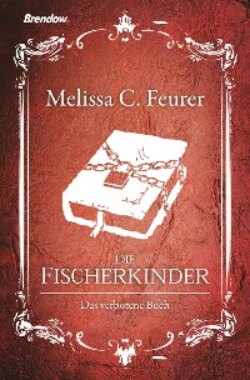Читать книгу Die Fischerkinder - Melissa C. Feurer - Страница 11
Porters Höhle
Оглавление„Wir werden erwischt, wir werden erwischt, wir werden erwischt“, flüsterte Vera unablässig, während sie um kurz nach zwölf in dieser Nacht die Straße vor Veras Haus hinabschlichen.
Mira war vor Aufregung ganz schlecht, und sie war nicht in der Stimmung, Vera zu beruhigen. „Wenn du noch ein bisschen lauter sprichst, dann ganz bestimmt“, zischte sie nur und presste das Buch, das wieder unter ihrer Bluse steckte, so fest an sich, wie sie nur konnte. Sie war sich nicht mehr so sicher, ob es das Risiko wirklich wert war. Es schien ihr nahezu unmöglich, ungesehen zu „Porters Höhle“ zu gelangen.
Veras Flüstern ging in ein ängstliches Wimmern über, das einzige Geräusch, das, abgesehen von ihren verdächtig lauten Schritten, noch zu hören war. Mira hatte geglaubt, ihr Vorhaben sehr sorgfältig geplant zu haben, doch nun, da sie tatsächlich unterwegs waren, musste sie sich eingestehen, dass sie das größte Hindernis gründlich unterschätzt hatte. Sie hatte sich so sorgsam überlegt, wie sie sich aus dem Haus schleichen konnten und was sie Edmund Porter fragen wollte, wenn sie ihm schließlich gegenüberstand, dass ihr der Weg dorthin wie das geringste Problem erschienen war.
„Warum gehen wir noch einmal mitten in der Nacht?“, wisperte Vera, die Mira ganz nervös machte, indem sie sich alle zwei Schritte nach links und rechts und hinten umsah.
„Weil sie die Buchhandlung überwachen“, gab Mira wie die beiden vorangegangenen Male zur Antwort. „Sie dürfen uns nicht belauschen. Sonst wissen sie, dass Herr Porter eine verbotene Schrift besitzt und dass ich sie gelesen habe.“ Es war nicht erlaubt, während der Ausgangssperre draußen unterwegs zu sein. Wen sie erwischten, den stellten sie unter Arrest oder kürzten seine Rationen. Aber eine verbotene Schrift zu besitzen oder auch nur gelesen zu haben war schlimmer. Mit einer Gefängnisstrafe oder einer Rationskürzung käme man dabei nicht davon.
„Es wird schon gut gehen“, versicherte Mira ihnen beiden leise.
Sich aus dem Haus der Petersens zu schleichen war beinahe lächerlich einfach gewesen. Veras Mutter hatten sie den ganzen Abend nicht zu Gesicht bekommen, und ihr Vater war lange vor Mitternacht über seinen Unterlagen eingenickt. Vera hatte nach ihm gesehen und das Licht gelöscht, ihn aber schlafen lassen. Er hatte nichts von alledem – und auch nichts von ihrem Gehen – mitbekommen.
Obwohl ihnen beiden das Herz bis zum Hals schlug, kamen sie ohne größere Zwischenfälle bis in den Kern der Innenstadt. Sie begegneten niemandem, nur einmal hörten sie in der Ferne die Schritte eines Wachpostens. Als sie „Porters Höhle“ schon am jenseitigen Straßenende sehen konnten, hatten sie sich ein wenig entspannt und waren vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig geworden.
Sie beschleunigten ihre Schritte, die hämmernd wie ein Herzschlag von den Wänden der umstehenden Häuser widerhallten. Erst im letzten Moment sahen sie den Lichtkegel der Taschenlampe, der sich aus einer Seitengasse näherte, während der Rest der Stadt in tiefster Dunkelheit lag, nachdem der Strom in den Privathaushalten schon vor Stunden für die Nacht abgeschaltet worden war. Eine Stimme bellte in die Stille der Nacht: „Wer ist da?“
Vera fuhr zusammen und bremste ihre Schritte, aber Mira erfasste die Situation schneller. Innerhalb von Sekunden packte sie Vera am Arm und rannte blindlings geradeaus los.
„Stehen bleiben!“, schrie die Stimme, und die Schritte ihres Verfolgers waren nun, da sie ihn bemerkt hatten, auf dem harten Kopfsteinpflaster deutlich zu hören. Sie kamen rasend schnell näher.
Die Eingangstür zu „Porters Höhle“ war verschlossen, die Fenster allesamt stockfinster. Das heißt … nein, in einem Fenster, das auf den Hinterhof hinausblickte, schimmerte ein blasses Lichtchen. Ein kleiner, tastender Lichtkegel, wie der, der Mira schon so oft hätte verraten können, wenn sie heimlich in ihrem dunklen Zimmer gelesen hatte.
„Hier rüber!“, flüsterte sie so laut, wie ihre zugeschnürte Kehle es zuließ. Sie zerrte Vera über das Mäuerchen und sprang mehr gegen die Fensterscheibe, als dass sie dagegenklopfte. Den heimlichen Leser dahinter erschreckte sie wahrscheinlich halb zu Tode. Die Taschenlampe erlosch schlagartig.
Der andere Lichtkegel hingegen hatte sie fast erreicht. Vera und Mira blieb keine andere Wahl, als sich bäuchlings hinter dem Mäuerchen auf den Boden zu pressen. Zwischen dem staubigen Pflaster und ihrem hämmernden Herzen spürte Mira das Buch, das ihr das alles eingebrockt hatte. Es drückte seine Lederstruktur in ihre schweißnasse Haut und erinnerte sie daran, wie schlecht es um sie stand, wenn der Mann mit den schweren Stiefeln, die nun unweit von ihnen innehielten, sie bemerkte. Sie waren keine normalen Ausreißer oder Leute, die verbotenerweise nach der Sperrstunde draußen herumwanderten. Mit einem Buch wie dem unter Miras Bluse kam man nicht mit einem Arrest oder einer Verwarnung davon.
Die Stiefel des Mannes knirschten bei jedem nun vorsichtiger gesetzten Schritt auf dem steinernen Grund. Der Lichtkegel tastete weiter über die Straße und in die Hauseingänge. Die weiße Wand von „Porters Höhle“ warf den Schein zurück auf den Mann, und Vera entfuhr ein Quieken.
Miras Hand schnellte über die Schulter ihrer Freundin und legte sich über deren Mund, während ihr Arm sie fest auf den Boden presste. Sie hatte gesehen, was Vera gesehen hatte: Es war Filip. Aber heute, hier, in dieser Situation änderte diese Tatsache rein gar nichts. Er war ein Wachmann, und sie waren Straftäter – Bruder und Schwester hin oder her.
Filip musste Vera gehört haben, denn er schnellte herum und hob die Taschenlampe höher, sodass sie nun über sie hinweg den hinteren Teil des Hofes beleuchtete. Mira glaubte fast, die Hitze des Lichts zu spüren, während es sich näher und näher tastete. Es hatte die beiden im Schmutz liegenden Mädchen fast erreicht.
Ein jähes Geräusch, nicht weit von ihnen, ließ den Lichtkegel zurückjagen. Mira hatte keine Ahnung, was Filip darin sah, aber es schien von größerem Interesse zu sein als der Rest des Hinterhofes.
„Hoppla“, ertönte ein tiefer Bass hinter ihr, und der Geruch von süßem Tabak ließ Mira das Herz in die Hose sinken. Nun war das Chaos komplett. Edmund Porter hatte sein Haus verlassen und stand nur wenige Meter hinter ihnen. Ihm allein musste sich die ganze Szene auf einen Blick erschließen. Filip mit Uniform, Abzeichen und Taschenlampe und zwei Mädchen, die sich in der Dunkelheit seines Hinterhofes auf den Boden pressten, als hinge ihr Leben davon ab. „Mir war doch, als hätte ich hier draußen einen Lichtschein gesehen“, sagte er nach kurzem Zögern.
„Edmund Porter.“ Filip tippte sich an den Hut. „Es ist spät. Sie sollten das Haus nicht verlassen.“ Seine knappen Feststellungen erinnerten nicht einmal entfernt an die umständliche Ausdrucksweise, die Mira von ihm kannte.
„Oh, das hatte ich doch nicht vor“, versicherte Edmund Porter ruhig. Vielleicht, überlegte Mira, konnte er sie gar nicht sehen. Vielleicht verbarg der Schatten des Mäuerchens sie auch vor ihm. „Ich bin nur ein neugieriger alter Mann, der nicht schlafen kann und beim Lesen einen Lichtschein in seinem Hof gesehen hat.“
„Das war ich. Sie können wieder hineingehen“, sagte Filip schroff. „Ich habe etwas gehört.“
„Und das wiederum könnte dann wohl ich gewesen sein“, erwiderte Edmund Porter, der keineswegs wieder nach drinnen gegangen war. „Sehen Sie, ich füttere die streunenden Katzen in der Nachbarschaft, und erst eben habe ich ihnen diese Schüssel nach draußen gestellt.“
Der Lichtkegel bewegte sich. Vermutlich leuchtete Filip in die von Edmund Porter gewiesene Richtung, und aufgeschreckt von der Helligkeit, stoben in der Tat zwei oder drei Straßenkatzen davon.
Filip zuckte zurück und richtete den Lichtkegel wieder auf Edmund Porter. „Streuner also.“ Seiner Stimme fehlte jede Herzlichkeit. „Ich schlage vor, dass Sie trotzdem wieder nach drinnen gehen. Und sich den Straßenkatzen in Zukunft besser am Tage erkenntlich zeigen. Sie bringen sich noch in ernste Schwierigkeiten.“
„Verzeihung“, sagte Edmund Porter, und dann herrschte Stille. Die Tür fiel ins Schloss, der Lichtkegel erzitterte ein wenig, dann zog er sich zurück und begleitete Filip die Straße hinab.
Als Vera sie zwickte, wurde Mira sich bewusst, dass sie ihr immer noch mit aller Kraft die Hand auf den Mund presste. Rasch ließ sie los und spürte, wie ein Kribbeln durch ihren vor Anspannung steif gewordenen Arm wanderte. Ihr ganzer Körper fühlte sich verkrampft an, und plötzlich war sie furchtbar erschöpft.
Ein Klicken ließ sie beide zusammenfahren. Die Tür hinter ihnen war aufgesprungen. „Schsch“, ertönte eine tiefe Stimme aus der Dunkelheit dahinter. „Hier rein. Schnell.“
Das ließen sich die Mädchen nicht zweimal sagen.
Mira hatte noch nie das Gesetz gebrochen. Mit einem Staatsbeamten zum Vater hatte sie dazu auch reichlich wenig Gelegenheit gehabt. Gerald Robins hatte stets zwei besonders wachsame Augen darauf gehabt, dass seine Tochter auf dem rechten Weg war und blieb.
Aber nach dem Diebstahl des Buches hatte eines zum anderen geführt. Innerhalb von kaum mehr als vierundzwanzig Stunden hatte sie gestohlen, eine verbotene Schrift gelesen, ihre Freundin zu einer Straftat angestiftet und die Ausgangssperre missachtet. Im blassen Licht einer Taschenlampe inmitten der Regale von „Porters Höhle“ zu stehen erinnerte sie einmal mehr daran, wie verboten es war, hier zu sein. Und wie unfassbar gefährlich.
Die Beleuchtung reichte gerade einmal aus, die Konturen der Einrichtung sichtbar zu machen und ihre Gesichter zu erhellen. Mira fragte sich, ob sie genauso verängstigt aussah wie Vera, deren Miene schreckensstarr war. Ihr Haar war staubig, und der Abdruck des Kiesbodens prangte auf ihrer Wange. Das Ausweisbändchen an ihrem Arm hatte auch ordentlich etwas abbekommen: Mitten durch den neunstelligen Code zog sich ein scharfer Knick.
Edmund Porter war die Ruhe selbst. Er zog die Vorhänge zu, zündete eine Kerze an, verstaute die Taschenlampe in einer Schublade und setzte sich in seinen Ohrensessel. „Es ist gefährlich“, sagte er dann, „um diese Zeit unterwegs zu sein.“
Vera stieß die Luft aus, als wollte sie ein sarkastisches „Wem sagen Sie das?“ loswerden. Doch außer dem Schnauben kam kein Laut über ihre Lippen. Überhaupt sah sie so aus, als wäre sie nicht fähig, jemals wieder ein Wort zu sagen.
„Uns zu helfen war ebenfalls sehr gefährlich.“ Mira straffte die Schultern. Edmund Porter hatte ihnen nicht den Hals gerettet, um sie nun ans Messer zu liefern. Und auch seine Ermahnung schien nicht wirklich von Herzen zu kommen. Mira wurde das Gefühl nicht los, dass er sie erwartet hatte. Vielleicht nicht jetzt, nicht mitten in der Nacht … aber doch erwartet.
Sie nestelte am Bund ihrer Bluse herum und zog schließlich das ledergebundene Buch hervor. „Es tut mir leid“, sagte sie aufrichtig. „Ich habe das hier gestern mitgenommen.“
„Ich weiß.“ Edmund Porter war nun dazu übergegangen, seine Pfeife zu stopfen. „Ich wusste, dass du dir kein Buch entgehen lassen würdest, das du noch nicht kennst. Schon gar keines voller Abenteuer und Weisheit.“ In seinen Augen glitzerte die Heiterkeit. Mira konnte es nicht fassen, wie gelassen er es hinnahm, dass sie mitten in der Nacht in seinem Laden stand und zugab, eines seiner Bücher gestohlen zu haben. Noch dazu ein so gefährliches.
„Es ist verboten“, würgte Vera schließlich heraus. „Dieses Buch müsste gemeldet werden!“ In ihrer Stimme vibrierte die Angst.
Edmund Porter nahm den ersten Zug von seiner Pfeife. „Zwei Mädchen, die des Nachts durch die Straßen wandern, müssten auch gemeldet werden.“
Vera sog die Luft ein und sah sich panisch um, als suche sie einen Fluchtweg.
„Ich habe kein Interesse daran, jemanden in Schwierigkeiten zu bringen. Aber dass ihr hier seid – noch dazu um diese Zeit –, zeigt mir, dass ihr das Risiko nicht scheut.“ Er stieß den Rauch aus. Nach wie vor machte er keine Anstalten, Mira das Buch abzunehmen. „Das ist gut. Dieses Buch bringt viele Probleme mit sich.“
Das erinnerte Mira an den eigentlichen Grund ihres Kommens. Sie holte tief Luft und fragte geradeheraus: „Wo ist der Rest der Geschichte?“
Vera neben ihr keuchte erschrocken. Wie zwei grüne Laternen flackerten ihre angsterfüllten Augen im Kerzenlicht.
„Ich konnte es nicht zu Ende lesen, weil die Seiten herausgerissen wurden. Das Ende fehlt.“
Edmund Porter nahm einen weiteren tiefen Zug von seiner Pfeife. „Ah. Ja.“ Er lächelte. „Matthäus. Du hast längst nicht alles herausgefunden.“
Es ärgerte Mira, dass er sie vergnügt anlächelte, so als wäre ihr etwas ungemein Wichtiges entgangen. Vera stand immer noch wie versteinert da und war auch keine besonders große Hilfe. „Das Ende“, fuhr Edmund Porter jetzt fort, „fehlt nur bei Matthäus.“
„Die anderen Geschichten interessieren mich nicht“, entgegnete Mira ärgerlich. Die Anspannung in ihr stieg ins Unermessliche. Sie war so kurz davor, das Geheimnis zu lüften und den Rest der Geschichte zu erfahren. „Ich will wissen, was mit seinen Freunden passiert. Können Sie es mir erzählen? Bitte“, fügte sie hastig hinzu, weil sie feststellte, dass ihre Frage mehr wie ein Befehl geklungen hatte.
„Natürlich kann ich. Aber ich bin fast ein wenig enttäuscht, dass du nach Matthäus aufgegeben hast. Markus und Lukas hätten dir alles verraten. Und Johannes.“
„Sie meinen, die gleiche Geschichte ist mehr als einmal in diesem Buch?“, fragte Mira.
„Viermal, um genau zu sein.“
Ein Kribbeln machte sich in Miras Bauch bemerkbar. Nun war auch bei Vera die Neugier der Angst über den Kopf gewachsen. „Aber wie können vier Schriftsteller die gleiche Geschichte aufschreiben?“, fragte sie.
„Ja, das scheint ungewöhnlich“, erwiderte Edmund Porter immer noch völlig entspannt. Wie er da in seinem Sessel lehnte, hätte man leicht meinen können, es wäre nicht mitten in der Nacht und sie sprächen nicht bei einem äußerst verbotenen Treffen über eine äußerst verbotene Geschichte.
Mira atmete tief ein. Die Luft roch nach süßem Tabak und der Kälte der Nacht. „Das alles ist wirklich passiert, nicht wahr?“ Irgendwie hatte sie es die ganze Zeit geahnt. Schon als sie tränenüberströmt die letzte grausige Szene gelesen hatte.
Edmund Porter löschte sorgfältig seine Pfeife, legte sie weg und stand auf. Jede Heiterkeit war aus seinem Gesicht gewichen. Seine Stirn lag in sorgenvollen Falten. „Wäre diese Geschichte ein Märchen“, sagte er, als er dicht vor ihnen stand, „hätte man sie nie verboten. Der Staat könnte nicht tun, was er tut, wenn die Leute um die Wahrheiten in diesem Buch wüssten.“
Vera gab ein Wimmern von sich, und auch in Mira regte sich bei diesen Worten Unbehagen. Beide waren sie dazu erzogen worden, den Staat und das, was er tat, nicht zu hinterfragen oder gar zu kritisieren. Man hatte es ihnen in den Erziehungshäusern, zu Hause und im Unterricht regelrecht eingeimpft.
Edmund Porter sah nicht aus wie ein Rebell. Natürlich, er besaß einen ganzen Laden voller Bücher, und das machte ihn nicht gerade zu einem vorbildlichen Staatsbürger. Aber ansonsten erschien er Mira recht friedlich. Er war doch nur ein ergrauter Mann mit rundem Bauch und Brille. Mira wollte hören, was er zu sagen hatte. Sie wollte das Ende der Geschichte erfahren. Deshalb schluckte sie ihre Beklommenheit hinunter.
„Du hast gelesen, wie Jesus starb?“
Mira nickte angespannt.
„Dann will ich dir erzählen, wie er auferstand“, sagte Edmund Porter.
„Aufer- was?“, fragte Vera.
Mira griff nach der zur Faust verkrampften Hand ihrer Freundin und drückte sie fest. Veras Panik durfte Edmund Porter nicht davon abhalten, die Geschichte zu Ende zu erzählen. „Das ist, wenn jemand Gestorbenes wieder ins Leben zurückkommt“, flüsterte sie hastig.
Vera starrte Mira an und stieß dann ein nervöses Lachen aus. „Das glaubst du aber nicht wirklich, oder?“
Sie sahen beide zu Edmund Porter, über dessen Gesicht ein Lächeln huschte. Ihr Entsetzen schien ihn zu amüsieren. „Es war am dritten Tag nach der Kreuzigung“, ergriff er wieder das Wort „als zwei Frauen zu seinem Grab kamen. Es war leer.“
„Vielleicht hat ihn einfach jemand gestohlen“, sagte Vera schnell. Sie hatte ihre Bewegungslosigkeit überwunden und zerrte an Miras Arm. „Komm schon, jetzt lass uns endlich gehen. Diese ganze Sache ist zu gefährlich! Nur wegen einer blöden Geschichte …“
„Gestohlen“, wiederholte Edmund Porter nachdenklich. „Ja, das haben einige böse Zungen damals auch behauptet. Aber die beiden Frauen berichteten des Weiteren, sie wären ihm begegnet. Und was deine ursprüngliche Frage angeht, Mira: Jesus traf auch noch einmal seine Freunde und sprach mit ihnen. Dann ging er zu Gott zurück.“
„Gott?“, echote Vera. Sie hatte die Augen weit aufgerissen und schien einem hysterischen Anfall nahe.
„Das ist sein Vater“, erklärte Mira. „Und er ist wohl so was wie ein … König?“ Sie sah mit gehobenen Brauen zu Edmund Porter.
Er lächelte. „Es ist doch alles recht viel, um es sofort zu begreifen“, sagte er ruhig. „Ich will nicht, dass auch nur eine eurer Fragen unbeantwortet bleibt. Aber dafür gibt es einen besseren Ort und ganz gewiss einen besseren Zeitpunkt als mitten in der Nacht.“
Nun schließlich nahm er Mira das Buch doch noch ab, und mehr denn je schmerzte es sie. Sie wollte es festhalten, es ihm nicht geben. Aber es glitt aus ihrer Hand, ohne dass sie Widerstand leistete.
„Du wirst alles erfahren“, versicherte Edmund Porter mit seiner ruhigen, fast trägen Stimme. „Kommt am Montag wieder, dann lasse ich euch Zeit und Treffpunkt wissen. Ich denke, ich brauche euch nicht zu sagen, dass alles, was wir innerhalb dieser vier Wände besprochen haben, unter uns bleiben muss. Das habt ihr verstanden, nicht wahr?“
Mira bejahte und sah zu Vera, die zögerlich nickte.
„Und jetzt geht. Nehmt den Weg durch die Kirschgasse – dort gibt es keinen Wachposten.“ Sie fragten nicht, woher er das wusste. Wenn sie eines begriffen hatten, dann dass der freundliche Buchladenbesitzer nicht der gesetzestreue und harmlose Mann war, der er zu sein vorgab.
Am Montag im Unterricht saß Mira wie auf Kohlen. Eigentlich hätte sie von den vergangenen Nächten übermüdet sein müssen, doch sie war hellwach und aufgedreht wie eine Spieluhr. Allerdings fiel es ihr schwer, diese Wachheit in Konzentration auf Staatswirtschaft umzuwandeln.
Professor Winkelbauer ließ sie Essays über die Fortschritte der Landwirtschaft schreiben. Während sie über ihren Heften brüteten, ging er mit kritischer Miene durch die Reihen und brachte die Schüler aus dem Konzept, indem er über ihre Schulter starrte und mitlas.
Staatswirtschaft war nicht gerade Miras Lieblingsfach, aber sie schlug sich doch ganz gut. Nur heute kam sie nicht recht voran, und während Professor Winkelbauer ihr zusah, konnte sie ihre Hand kaum dazu bewegen, auch nur ein einziges Wort zu Papier zu bringen. Minutenlang starrte sie auf ihren halb fertigen Satz: „Obwohl die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln derzeit noch nicht zu hundert Prozent gewährleistet ist, machen sich auch in der Landwirtschaft die positiven Auswirkungen von König Auttenbergs Gesetz zur Einstellung des Imports bemerkbar, wo die Erträge dank der Reduktion minderwertiger Fremdware und …“
Vera hatte wohl etwas Ähnliches geschrieben. Allerdings hatte sie nicht ein ganz so glückliches Händchen für klangvolle Formulierungen wie Mira. Bei ihr hinterließ die ganze Geschichte einen etwas anderen Eindruck.
„ … gibt es seit dem Importverbot nach wie vor nicht genug Essen für die Bevölkerung.“ Professor Winkelbauer war einen Platz weitergegangen und las über Veras Schulter hinweg mit gekräuselten Lippen laut vor. „Obwohl alle Lebensmittel rationiert wurden, ist es den Landwirten bisher nicht gelungen, genug anzubauen, um alle Bürger zu versorgen. Was, wenn ich fragen darf, soll das heißen, Frau Petersen?“
Vera starrte auf ihr Heft und drückte den Kugelschreiber in ihrer Hand so fest, dass Mira befürchtete, er könnte jeden Moment zerspringen und seine Feder quer durch den Klassenraum schießen.
„Frau Petersen“, wiederholte Professor Winkelbauer. „Was wollen Sie damit sagen? Etwa, dass unser Staat nicht imstande ist, seine Bürger zu versorgen?“
„Nein, Professor“, murmelte Vera, aber der Lehrer hörte ihr gar nicht zu.
„Oder dass unsere Landwirte nicht hart genug arbeiten?“, fuhr er fort. „Ist es das, was Sie mit Ihrer kleinen Hetzschrift zum Ausdruck bringen wollen?“
„Nein, Professor Winkelbauer“, quiekte Vera ängstlich. Sie war in sich zusammengesunken und schon halb hinter der Tischplatte verschwunden. Mittlerweile hörte die ganze Klasse zu; manche betroffen, andere erleichtert, dass es nicht sie getroffen hatte, und wieder andere hämisch grinsend. Daphné Baron hatte ihren Stift weggelegt und sich zurückgelehnt, um ja nichts zu verpassen – eine Dreistigkeit, die abgesehen von ihr keiner gewagt hätte. Herr Baron war ein Arbeitskollege von Miras Vater im Gericht.
„Haben Sie schon einmal die Bedingungen gesehen, unter denen unsere Landwirte arbeiten?“ Professor Winkelbauer war noch längst nicht fertig. Sein krauser Schnurrbart vibrierte bei jedem Wort. „Waren Sie jemals dort draußen auf den Feldern und haben die Knochenarbeit gesehen, die unsere Arbeiter Tag für Tag verrichten, um diesem Volk ein Leben in Unabhängigkeit zu ermöglichen? Nun antworten Sie schon!“
„N … nein, Professor“, Vera schien nun den Tränen nahe. So aufgelöst war sie nicht einmal Samstagnacht gewesen, als sie beinahe nach Ausgangssperre mit einer verbotenen Schrift draußen auf der Straße erwischt worden wären. Alle hatten Respekt vor Professor Winkelbauer, doch Vera schien ihn regelrecht zu fürchten.
Kein Wunder; bei ihr schlug er einen ganz anderen Umgangston an als bei seinen übrigen Schülern. Rotgesichtig schritt er hinter Vera auf und ab, während er einen Vortrag über die harte Arbeit der Landwirte und ihre beeindruckenden Errungenschaften hielt. Vera wagte nicht, sich zu ihm umzudrehen, aber wahrscheinlich musste sie weder seine Gesichtsfarbe noch seine Miene sehen, um zu wissen, dass er kurz vor einer Explosion stand.
„Ich denke“, schloss der Professor schließlich und klang jetzt regelrecht gehässig, „dass es Ihnen nicht schaden könnte, ein zusätzliches Referat zu diesem Thema vorzubereiten. Ich erwarte es in einer Woche schriftlich auf meinem Schreibtisch und lasse Sie wissen, wann Sie Ihre gesamte Klasse mit Ihren Gedanken über die derzeitige Landwirtschaft beglücken können.“
Ein paar verhaltene Lacher lenkten ihn von Vera ab. „Wer hat Ihnen allen eigentlich erlaubt, mit dem Schreiben aufzuhören?“, blaffte er und beobachtete, wie sich die Schüler – abgesehen von Daphné Baron – wieder über ihre Arbeiten beugten. Aber Mira war sich fast sicher, dass er nicht erst jetzt bemerkt hatte, dass alle Anwesenden zuhörten, wie er wieder einmal Vera Petersen schikanierte.
„Ich komme nicht mit“, eröffnete Vera, als sie am frühen Nachmittag die Schule verließen. Es war Mitte März, und ein kühler Wind fegte durch die Straßen.
„Was?“ Mira musste sich beeilen, um mit Veras Tempo Schritt zu halten. Sie machte nicht gerade den Eindruck, als wolle sie hierbleiben. Hier, in der Schule, am Ort zahlreicher Demütigungen und Anfeindungen. „Der Unterricht ist vorbei“, setzte Mira an, aber Vera – fast einen Meter vor ihr – schnaubte.
„Bitte, Mira, stell dich jetzt nicht dumm. Ich sagte, ich komme nicht mit“, erklärte sie mit mehr Nachdruck, als Mira jemals in Veras dünner Stimme gehört hatte. „Nicht mit du-weißt-schon-wohin.“
„Was … doch!“ Mira verfiel in einen leichten Trab, um zu Vera aufzuschließen. „Doch, Vera, natürlich kommst du mit zu ‚Porters Höhle‘. Du musst einfach!“
„Ich muss genug andere Dinge“, entgegnete Vera. „Zum Beispiel dieses irrsinnige Referat vorbereiten. Als hätten wir mit den Hausaufgaben und dem Lernen nicht schon mehr als genug zu tun! Und vor der ganzen Klasse diesen Seiltanz vollführen, mich an die Fakten zu halten und es Winkelbauer recht zu machen. Und das alles, während Daphné Baron mich feixend beobachtet und zu Hause jedes falsche Wort, das ich gesagt habe, ihrem Vater erzählt, der es dann an Filip auslässt und es ihm im Staatsdienst noch schwerer macht. Das muss ich, und das reicht mir völlig. Ich kann nicht noch mehr Schwierigkeiten gebrauchen, Mira!“
Ihre Stimme überschlug sich, während das alles aus ihr heraussprudelte. Ein paar Mitschüler, die vor ihnen liefen, drehten sich nach ihnen um, aber Mira verzichtete darauf, Vera zu ermahnen, ihr Geheimnis nicht so herumzuposaunen. Sie wussten beide ganz genau, wie gefährlich diese Geschichte war. Wenn Mira sie dabeihaben wollte, durfte sie Vera nicht auch noch daran erinnern.
„Unsere Familien arbeiten im Staatsdienst.“, fuhr Vera leiser fort. „Und wir können froh darüber sein. Den Leuten draußen in den Armenvierteln geht es nicht so gut wie uns.“ Sie machte eine ungenaue Geste in Richtung Stadtmauer, welche die Innenstadt von den äußeren Bezirken trennte. „Willst du das alles wirklich für ein Buch aufs Spiel setzen?“
„Nein, aber … Vera, ich muss wissen, warum sie diese Geschichte verboten haben. Ich sehe nichts Gefährliches an einem Mann, der Kranke gesund gemacht und Menschen geholfen hat.“
„Dann vielleicht an einem Mann, der angeblich zuerst tot und dann wieder lebendig war?“, flüsterte Vera heiser. „Mira, bitte! Es ist nicht unsere Aufgabe, zu entscheiden, was gut für uns ist und was nicht. Das Komitee für verbotene Schriften wird schon wissen, warum sie dieses Buch nicht erlauben.“
Bis vor wenigen Tagen hätte Mira ihr zugestimmt. Ein bisschen wehmütig, weil sie zu gerne gewusst hätte, was es mit den verbotenen Schriften auf sich hatte, aber doch im festen Glauben, dass der Staat hier und in allem anderen im Recht war. Aber dieses Buch. Dieser Mann, dieser Jesus. Wie konnte Mira jetzt, wo sie seine Geschichte kannte, zur Normalität zurückkehren und es einfach so hinnehmen, dass er und seine wundersame Geschichte verboten waren?
„Was, wenn sie keinen guten Grund haben?“ Mira ballte die Hände zu Fäusten. „Oder einen Grund, mit dem ich nicht einverstanden bin? Was, wenn sie uns nur etwas vorenthalten wollen, das ihnen nicht gefällt?“
„Mira!“ Vera sah aus, als würde sie ihr am liebsten den Mund zuhalten. Sie blickte panisch nach links und rechts, ob jemand Miras aufbrausende Rede gehört hatte. „So kannst du nicht reden. Das kostet dich Kopf und Kragen. Und mich auch. Und deine Familie! Dein Vater arbeitet für den Staat, den du da hintergehst. Was meinst du, was sie mit ihm machen, wenn seine Tochter zur Gesetzesbrecherin wird? Bestenfalls verliert er nur seinen Job und nicht seinen Kopf.“
Mira schluckte. „Jetzt mach mal –“
„Halblang? Mira, schau dir meinen Vater an. Schau, was ihm passiert ist und was das mit meiner Familie gemacht hat.“ Auch Vera hatte die Fäuste geballt. Mira war nicht sicher, aber es hatte fast den Anschein, als schimmerten Tränen in ihren Augen.
„Filip hat so hart gearbeitet, um trotz der Fehler, die mein Vater gemacht hat, eine gute Stelle zu bekommen. Ich kann nicht alles riskieren, was er erreicht hat, nur um mir verbotene Geschichten anzuhören!“
Mira dachte an Filip, der so pflichtbewusst und so verbissen arbeitete, und daran, wie er manchmal völlig übermüdet von seinen zahlreichen Doppelschichten zurückkam, wenn sie und Vera gerade über ihren Hausaufgaben am Esstisch im Wohnzimmer der Petersens saßen. Sie dachte daran, wie er nach Dienstschluss Papierkram für die Staatsbeamten in der Verwaltung sortierte oder gar Orden polierte, um sich mit ihnen gutzustellen, und sie schämte sich dafür, dass sie ihn für seine Unterwürfigkeit verachtet hatte. „Du hast recht“, flüsterte sie traurig. „Das kannst du ihm nicht antun.“
Vera sah überrascht auf. Hinter ihren Ponyfransen glitzerten ihre Augen immer noch verdächtig. Fast glaubte Mira, ihre Freundin hätte darauf gehofft, sie würde sie überreden. Jedenfalls hatte sie nicht damit gerechnet, dass Mira nachgab.
„Es ist in Ordnung. Du musst tun, was du für richtig hältst. Aber ich muss auch tun, was ich für richtig halte. Und ich glaube, ich muss mir zumindest anhören, was Herr Porter zu sagen hat.“