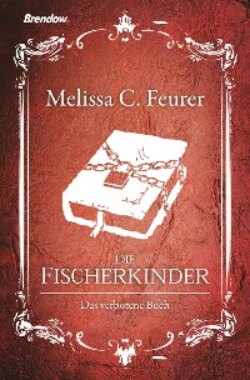Читать книгу Die Fischerkinder - Melissa C. Feurer - Страница 9
Familie Petersen
ОглавлениеMiras Familie hielt nicht viel von den Petersens. So wie jeder, der etwas auf sich selbst hielt, nicht viel von dieser sonderbaren Familie halten konnte. Herr Petersen war wohl einmal ein hohes Tier im Staatsdienst gewesen – in seinen Blütetagen, als seine beiden Kinder, Filip und Vera, noch ganz klein gewesen waren.
Heute war Herr Petersen in erster Linie eines: hektisch. Den größten Teil seiner Zeit verbrachte er außer Haus, und wenn er einmal da war, dann verließ er sein Arbeitszimmer nur, um im Chaos seines Zuhauses verloren gegangene Dinge zu suchen. Seitdem er wegen eines peinlichen und deshalb totgeschwiegenen Vorfalls aus dem höheren Dienst entlassen worden war, setzte die Regierung der Stadt ihn als Springer ein, der mal hier, mal da aushalf, mal hierhin, mal dorthin reiste und mal mehr, mal weniger gut verdiente.
Mira mochte ihn gerne. Er erinnerte sie mit seinem schütter gewordenen grauen Haar, das vielleicht einmal vom gleichen rötlichen Blond wie das seiner Kinder gewesen war, an den zerstreuten Professor aus einem der Bücher, die sie gelesen hatte, und sie freute sich stets, ihm zu begegnen, was aber nicht oft vorkam.
Frau Petersen bekam sie ebenfalls nur selten zu Gesicht, obwohl sie viele Nachmittage bei Vera und ihrer Familie verbrachte. Meist schlief sie – „am helllichten Tag!“, entsetzte sich Miras Mutter –, und auch wenn sie wach war, erinnerte sie an eine Schlafwandlerin. Mira schien sie sehr weit weg, aber sie hatte Vera noch nie danach zu fragen gewagt, ob sie in ihrem Kopf vielleicht tatsächlich an einem ganz anderen Ort war.
Mira war den ganzen Weg zum Haus der Petersens gerannt und musste erst einmal zu Atem kommen und das Buch wieder sicher unter ihrer Bluse verstauen, als sie schließlich vor der wurmstichigen Eingangstür stand. Das ganze Haus hätte eine Renovierung bitter nötig gehabt, ein wenig Putz, eine Menge Farbe und frisches Holz. Aber das traf auf die meisten Häuser zu, wenn Mira auch zugeben musste, dass das Haus der Petersens besonders schäbig aussah.
In einigen Räumen waren die Vorhänge zugezogen – ein Missstand, den Miras Mutter nie geduldet hätte –, darunter auch das Elternschlafzimmer, das Refugium von Veras Mutter. Wie ein Bär hielt sie dort ihren immerwährenden Winterschlaf und quälte sich nur gelegentlich für kurze Ausflüge an das grelle Tageslicht, wobei sie die Augen fest zukniff, als wären sie nicht mehr an die Helligkeit gewöhnt.
Kaum hatte Vera die Tür geöffnet und Mira in den Flur treten lassen, legte sie schon einen Finger an die Lippen und wisperte kaum hörbar: „Wir müssen leise sein. Meine Mutter schläft.“
Das war nichts Neues für Mira. Eigentlich war es sogar der Normalzustand im Haus der Petersens, sich auf Zehenspitzen fortzubewegen, um Veras Mutter nicht zu wecken.
Insgeheim fragte Mira sich häufig, ob ihre Krankheit wohl tödlich war. Als sie Frau Petersen zuletzt gesehen hatte, hatte sie ausgesehen wie ein Geist. Die spröde Haut beinahe vom gleichen gräulichen Weißton wie das Nachthemd, das spitze Gesicht hinter einem fast kinnlangen Vorhang aus hellblondem Haar verborgen. So musste jemand aussehen, der im Sterben lag.
Ob ihr Mann und ihre Kinder und auch sonst jeder, den Mira kannte, deshalb so beharrlich darüber schwieg, was ihr fehlte? Mira hatte sie oft Medikamente nehmen sehen. Ein einziges Mal hatte sie Vera gefragt, wozu sie gut waren. Ihre Freundin hatte derart barsch reagiert, dass Mira es danach nie wieder gewagt hatte.
Mira folgte Vera durch den Flur, an Frau Petersens nur angelehnter Tür vorbei und ins Wohnzimmer. Es war das Herz des Hauses; von dort führte eine stets offene Tür in die Küche und eine Holztreppe ins Obergeschoss. Den meisten Raum nahm der große, runde Esstisch ein.
Schmutziges Geschirr von mehreren Tagen stapelte sich darauf, und der Geruch von etwas Angebranntem lag in der Luft. Die Petersens hatten keine Bedienstete aus den Armenvierteln, und abgesehen von Vera hatte Mira hier noch niemals jemanden putzen, spülen oder Staub wischen sehen. Und das, obwohl Veras Mutter nicht einmal berufstätig war!
Wie gut, dass Miras Eltern den Zustand von Veras Zuhause nicht sahen. Sie hätten auf der Stelle vorgeschlagen, Vera zurück in eines der Erziehungshäuser zu bringen, damit man sich dort „anständig um sie kümmerte“. Dass zumindest die ersten Jahre der Erziehung Sache des Staates waren, hielt ihr Vater in Fällen wie dem der Petersens für lebensrettend. Ihre Mutter fand es grausam; sie hätte Mira gerne von klein auf bei sich gehabt und nicht erst zu ihrem dritten Geburtstag – zumindest für die meiste Zeit – nach Hause geholt. Aber das war natürlich ihr Geheimnis, denn man widersprach den Regeln des Staates nun einmal nicht.
Im Gegensatz zu ihrem Bruder Filip sah man Vera ihre Herkunft an. Zwar achtete Filip darauf, dass ihre Kleidung ordentlich und ihr Haar kurz war, doch war eben nichts gegen nachlässig in die Hosen gesteckte Blusen, unheimlich schnell herauswachsende Ponyfransen und schlichtweg fehlendes Talent für Staatsgeschichte zu machen. Letzteres war besonders verdächtig. Vera konnte sich einfach keine Zahlen merken und hatte zudem ein Talent, die falschen Fragen zu stellen. Aber sie hatte die für jemanden ihrer Herkunft wertvolle Begabung, unauffällig zu sein. Bisher hatte sie es noch immer in die nächste Klassenstufe geschafft, indem sie einfach im Durchschnitt versunken war und es anderen überlassen hatte, sich positiv oder negativ hervorzutun. Klein, zierlich und schüchtern, wie sie war, konnte man sie manchmal tatsächlich fast übersehen.
„Geht es deiner Mutter wieder –“ Mira kam nicht dazu, die Frage zu beenden, weil trotz ihrer Bemühungen, leise zu sein, eine dünne Stimme aus dem Schlafzimmer drang: „Vera?“
Vera blieb wie angewurzelt stehen und bedeutete Mira, still zu sein. Sie lauschte, ob ihre Mutter noch einmal etwas sagen würde oder ob sie bereits wieder eingeschlafen war.
„Meine Tabletten“, krächzte Frau Petersens Stimme von drinnen. „Ich brauche … meine Tabletten.“
Vera schluckte hörbar, dann zog sie die Tür auf und schlüpfte in das abgedunkelte Schlafzimmer. „Nein, Mutter“, hörte Mira sie leise erwidern. „Du hast deine Medikamente vorhin schon genommen.“
„Aber es … tut so weh“, stöhnte Frau Petersen. Eine Weile atmete sie nur gequält ein und aus.
„Trink etwas.“ Das Geräusch einer Flüssigkeit, die in ein Glas gegossen wurde, war zu hören, kurz darauf das Husten von Frau Petersen. Mira nahm an, dass Vera versuchte, ihrer Mutter ein wenig Wasser einzuflößen, und sie musste den Kloß in ihrem Hals hinunterschlucken. Ihre Eltern mochten nicht perfekt sein; ihr Vater war ein Kontrollfanatiker, der seine Familie als eine Art Vorzeigemodell der Gesetzestreue betrachtete, und ihre Mutter eine heimliche Rebellin, deren größte Sorge die Meinung der Nachbarn war. Aber Mira musste doch zugeben, dass sie zu Hause stets gut umsorgt und aufgehoben gewesen war. Nicht wie Vera, die nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre kranke Mutter sorgen musste, wenn Vater und Bruder im Dienst des Staates außer Haus waren.
Veras Schritte näherten sich bereits wieder der Tür, als Frau Petersen noch einmal das Wort ergriff. „Sag … sag es nicht Filip. Sag ihm nicht, dass ich … von meinem Zustand“, flehte sie schwach. „Hörst du, Vera? Sag ihm nichts. Er … er regt sich immer so auf.“
Mira konnte nicht hören, ob Vera es ihr tatsächlich versprach, weil in diesem Moment die Haustür aufgeschlossen wurde und kein anderer als Filip den Flur betrat.
Er war das genaue Gegenteil von Vera: groß, beherrscht und stets sehr exakt. Sein rotblondes Haar war einwandfrei geschnitten und betonte seine kantigen Züge, seine Kleidung war sauber, und an seiner blauen Uniformjacke prangten bereits die ersten beiden Abzeichen, auf die Filip mächtig stolz war. Bis vor Kurzem hatte er Orden nur dann aus der Nähe gesehen, wenn seine Vorgesetzten sie ihm zum Polieren überlassen hatten.
Filips gepflegtes Äußeres und seine nur zu deutlich zutage tretende Gesinnung waren es, die ihn in den Augen von Gerald und Rose Robins trotz seiner zweifelhaften Herkunft zu einem rechtschaffenen Bürger und durchaus vorstellbaren zukünftigen Schwiegersohn machten. Jedenfalls wurde Miras Mutter nicht müde, das zu betonen.
„Du beehrst uns auch wieder?“, begrüßte er Mira mit gewichtiger Miene. Filip Petersen hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als nicht freundlich zur Tochter seines großzügigen Gönners und Vorgesetzten Gerald Robins zu sein. Trotzdem wurde Mira das Gefühl nicht los, dass er manchmal nicht allzu erfreut war, sie zu sehen.
„Wenn mich nicht alles täuscht“, fuhr er fort, nachdem sie sich die Hände geschüttelt hatten, „dann sitzt Vera über ihren Hausaufgaben. Vielleicht möchtest du später wieder …“
In diesem Moment hörte er Veras sanft flüsternde Stimme und das Rascheln von Laken, und Mira konnte regelrecht zusehen, wie das Lächeln aus seinem Gesicht purzelte. „Ist es Mutter?“
In Miras Bauch machte sich ein Eisklumpen breit. Mit seinen glänzenden Orden und der tiefblauen Uniform mochte Filip ein Wachmann sein. Genauso kalt und pflichtversessen wie all seine Kollegen und Vorgesetzten auch. Aber hier in seinem unordentlichen und etwas schäbigen Zuhause mit den niemals ganz geöffneten Vorhängen war er in erster Linie ein Sohn, der eine viel zu große Last zu tragen hatte.
„Ich …“, stotterte Mira. „Ich glaube, es geht ihr heute sehr schlecht.“
Filip presste die Lippen zusammen. Innerlich schien er sich für das Schlimmste zu wappnen, und Mira fragte sich einmal mehr, ob Frau Petersen wohl tatsächlich im Sterben lag. Ohne ein weiteres Wort schob Filip sich an Mira vorbei, doch in der Tür zum Schlafzimmer hielt Vera ihn auf.
„Schon gut“, versicherte sie hastig. „Alles ist gut. Sie schläft jetzt.“
„Hat sie Tabletten genommen?“, fragte Filip in einem Ton, den Mira nur als barsch bezeichnen konnte.
„Heute Morgen. Lass sie schlafen, bitte, Filip. Komm doch mit uns nach oben.“
Filips Blick wanderte von der Schlafzimmertür zu Mira. Einen Wachmann – und sei es Veras Bruder Filip – dabeizuhaben war nicht unbedingt eine Freude, selbst wenn man kein verbotenes Buch unter der Bluse stecken hatte und darauf brannte, es hervorzuholen. Aber Vera hing nun einmal an ihrem Bruder und wollte ihn offenbar auf andere Gedanken bringen. Also rang Mira sich zu einem, so hoffte sie, aufmunternden Lächeln durch. Filip stieß die Luft aus und ließ sich von seiner kleinen, zierlichen Schwester durch das Wohnzimmer zur Treppe schieben.
„Wird sie wieder gesund werden?“, platzte Mira heraus, als sie Veras Zimmertür erreichten. Veras Blick huschte zu Filip, ehe sie zu einer Antwort ansetzte. „Nein. Mira, weißt du …“
Aber Filip fiel ihr ins Wort: „Ich würde einen Themenwechsel sehr willkommen heißen.“ Umständlich dirigierte er die beiden in Veras Zimmer, wo sie sich auf das nicht gemachte Bett setzten. Auch hier waren die Vorhänge nur halb aufgezogen. Im gedämpften Tageslicht sah Mira einen Stapel Schulunterlagen, einen benutzten Teller und ein Paar Socken auf dem Boden liegen. Filip nahm die Unordnung mit gekräuselter Nase zur Kenntnis, sagte jedoch nichts.
„Wie sieht es aus?“, fragte Vera, während Filip weiterhin schweigend auf das Chaos starrte. „Hast du wieder etwas dabei?“
Miras Herz begann schneller zu schlagen, als sie an das Buch dachte, das unter ihrer Kleidung verborgen war. Aber natürlich musste es in Filips Anwesenheit dortbleiben. Genau wie ihr Vater war Filip geradezu besessen von der Verfassung und jedem Gesetz, das seit Staatsgründung erlassen worden war.
Und natürlich meinte Vera auch keineswegs das Buch unter Miras Bluse. „Kekse? Gummitierchen? Ersatzschokolade?“, fuhr sie hoffnungsvoll fort und bekam hinter ihrem zu langen, rotblonden Pony ganz große Augen. Vera liebte Süßes.
„Oh“, machte Mira. „Das habe ich ganz vergessen.“ Ihr Vater machte sich nicht viel aus den Zusatzprodukten, die man nur für die wertvollen Sonderrationskarten bekommen konnte. Für den Großteil der Bevölkerung rückten Dinge wie Süßigkeiten, Schmuck oder Tabak damit in unerreichbare Ferne. Nur Staatsbeamte und Wachmänner verfügten über ein monatliches Kontingent solcher Karten.
Gerald Robins, der von keinem dieser Luxusartikel viel hielt, überließ seine Sonderrationen meist Mira. Und die suchte mit Vorliebe nach etwas, das sie mit ihrer Freundin teilen konnte. Gebackene Kekse mit einer dünnen Schicht Ersatzschokolade, geröstete Sonnenblumenkerne in Honig oder die zähen Gummitierchen, die Vera besonders gerne naschte.
„Wie um alles in der Welt kann man Süßigkeiten vergessen!“, entsetzte sich Vera und schüttelte ungläubig den Kopf. „Wenn wir solche Schätze zu Hause hätten, würde ich den ganzen Tag an nichts anderes denken!“
„Glaub mir“, schaltete Filip sich ein, der stocksteif auf der Bettkante saß, „du würdest nicht nur an sie denken, sondern den lieben, langen Tag nichts anderes tun, als zu essen!“
Er machte ein verdutztes Gesicht, als Mira in Lachen ausbrach, stimmte dann aber sogar ein klein wenig mit ein.
„Du lässt mich von deinen Sonderrationen ja nie Süßigkeiten aussuchen“, schmollte Vera.
„Und gewiss muss ich dir nicht die Gründe dafür darlegen. Mir steht lediglich eine einzige Sonderration im Monat zu, und die benötigen wir für Mutters Tabletten.“
Schuldbewusst senkte Vera den Kopf, und während auch sie so nachdenklich dreinschaute, sah sie ihrem ernsten Bruder sehr ähnlich. Mira konnte es nicht erwarten, Vera von dem Buch zu erzählen. Ein Geheimnis würde Vera aufheitern. Eines, das sogar spannender war als unzugängliche Lebensmittel.
Aber noch war Filip da und machte ihr das Sprechen unmöglich, obwohl Mira zugeben musste, dass auch er dringend eine Aufmunterung hätte gebrauchen können. Seine Miene versteinerte endgültig, als Vera irgendwann aufstand, um nach ihrer Mutter zu sehen, und Mira fühlte sich unbehaglich, mit ihm alleine zu sein. Filip konnte stundenlang schweigen, und wenn er sprach, dann oft so gewählt und umständlich, dass einem vom bloßen Zuhören schwindlig wurde. Vera sagte, das sei nur der Stress und die viele Verantwortung, aber Mira wurde den Gedanken nicht los, dass ihr Vater und seine Kollegen einen schlechten Einfluss auf Filip hatten. Bevor er in den Staatsdienst getreten war, war er eigentlich recht unbekümmert gewesen, und sie hatten sein breites, zähneblitzendes Lächeln viel öfter zu Gesicht bekommen.
„Kann man denn wirklich gar nichts machen?“, rang Mira sich zu einer Frage durch, weil sie das Gefühl hatte, von Filips eisernem Schweigen geradezu taub zu werden. Aber der schüttelte nur starr den Kopf.
„Ich könnte meinen Vater –“
„Nein, Mira“, unterbrach Filip sie. Wenigstens sprach er jetzt. „Du weißt, ich halte große Stücke auf deinen Vater. Aber in diesem Fall …“ Er stockte. „In diesem Fall sind auch ihm die Hände gebunden. Ich sollte aufbrechen“, fügte er im gleichen Atemzug hinzu und sprang auf, kaum war Vera wieder ins Zimmer getreten. „Ich erwarte, dass du dich um Mutter kümmerst. Ich habe Nachtschicht.“
Egal, wie schweigsam und ernst er war, konnte Mira es sich nur schwerlich vorstellen, dass ausgerechnet Filip einer der Wachmänner sein sollte, die des Nachts durch die Straßen patrouillierten. Sie kamen ihr, wohl auch wegen der regelmäßigen Mahnungen ihres Vaters, Angst einflößend und Respekt heischend vor. Filip, mit seinem rötlichen Haar und der gestelzten Ausdrucksweise, war keines von beidem. Sie hätte ihn sich gut als Rationenverteiler oder als Verwaltungsangestellten vorstellen können. Aber ihr Vater hatte ihm die Stelle in der Rechtsabteilung vermittelt und machte keinen Hehl daraus, dass er Filip, machte dieser seine Sache gut, auch weitere Türen im Staatsdienst öffnen würde. Türen zu höheren Posten, zu wichtigeren Aufgaben und zu größerem Ansehen.
„Jemand muss sich des Jungens annehmen“, wehrte er brüsk ab, wenn seine Frau ihn für sein fürsorgliches Verhalten rühmte. „Sein eigener Vater ist dazu ja nicht imstande.“
Dass ihr Vater so über Herrn Petersen sprach, missfiel Mira. Aber sie war auch froh, dass er zumindest eine so hohe Meinung von einem Mitglied der Familie Petersen – und sei es nur Filip – hatte. Deshalb beschwerte sie sich nicht.
Herr Petersen war vielleicht ein komischer Kauz, aber er war auch einer der nettesten Menschen, denen Mira je begegnet war. Und heute zählte Mira sogar auf seine Zerstreutheit, die sich für ihren Plan als ausgesprochen praktisch erweisen konnte, denn Herr Petersen bekam beinahe ebenso wenig von dem mit, was um ihn herum geschah, wie seine meist schlafende Frau.
Erst einmal war Mira jedoch, nachdem Filip zum Dienst aufgebrochen war, mit Vera alleine. Kaum war die Haustür hinter ihrem Bruder ins Schloss gefallen, fragte diese: „Sagst du mir jetzt, was dir auf der Zunge brennt?“
Mira sog überrascht die Luft ein, und das raue Leder des Buches stieß dabei gegen ihren Bauch. Die meiste Zeit hatte sie es deutlich in seinem Versteck fühlen können.
Vera pustete sich die Ponyfransen aus der Stirn und lachte. „Wusste ich es doch, dass du ein Geheimnis hast! Wenn man dich kennt, bist du ein offenes Buch, Mira.“
Auf dieses Stichwort hin zog Mira ihre Bluse aus der Hose und ließ das kleine Büchlein auf die Bettdecke fallen. Vera sah ihr zuerst verwirrt, dann mit geweiteten Augen dabei zu. „Mira“, wisperte sie. „Ich werd verrückt! Sag nicht, dass das eine der verbotenen Schriften ist!“ Sie schien hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, das Buch zu berühren, und dem Impuls, möglichst weit von dem verbotenen Gegenstand wegzurutschen, der da auf ihrem Bett lag. Sie entschied sich dafür, wie versteinert dazusitzen und ihn anzustarren. „Wo hast du das her?“ Ihr Blick war fest auf das Buch geheftet.
Mira senkte die Stimme. Nur für den Fall, dass jemand sie belauschte. „Das kann ich dir hier nicht sagen.“ Mira konnte an Veras Reaktion ablesen, dass ihr Misstrauen sie verletzte, deshalb fuhr sie hastig fort. „Aber ich kann es dir zeigen. Ich muss noch einmal dorthin. Die letzten Seiten der Geschichte fehlen.“
Vera nickte langsam, und Mira fügte schnell den Rest ihres Plans hinzu: „Heute Nacht.“ Sie konnte Edmund Porter nicht auf ein verbotenes Buch ansprechen, während ein Wachmann in der Buchhandlung herumlungerte.
„Und da willst du, dass ich … nein, Mira. Ich kann nicht mitkommen!“ Vera wandte sich von dem Buch ab und sah Mira mit aufgerissenen Augen an. „Was ist mit der Ausgangssperre? Was ist mit meinen Eltern? Und meinem Bruder?“
„Filip arbeitet.“ Mira hatte sich alles genau überlegt. „Deine Mutter wird schlafen wie ein Stein, und dein Vater …“ Sie verstummte.
Vera nickte grimmig und sah wieder das Buch an. „Mein Vater interessiert sich kein bisschen dafür, ob wir uns nachts rausschleichen. Sag es ruhig. Es stimmt ja. Er wird es nicht einmal bemerken.“ Sie stieß die Luft aus. „Aber trotzdem, Mira, was ist mit den Wachposten? Es ist verboten, nachts draußen herumzuschleichen. Weißt du, was sie mit Leuten machen, die nach Ausgangssperre draußen erwischt werden?“
Es war kein Geheimnis, dass Vera nicht mutig war. Aber sie war auch eine zu treue Freundin, um Mira allein gehen zu lassen.
„Mit diesem Buch spielt es keine große Rolle, ob wir am Tag oder in der Nacht erwischt werden“, erwiderte Mira brüsk, aber auch ihr Herz klopfte bei dem Gedanken an die nächtlichen Straßen wie wild. Sie war, abgesehen von wenigen, kaum nennenswerten Minuten, noch nie innerhalb der Sperrstunde draußen gewesen. „Es ist eine der alten Geschichten. Du müsstest sie lesen! Sie ist …“
„ … so was von verboten!“, ergänzte Vera und hielt sich die Ohren zu, als Mira Luft holte. „Nein! Nein, nein, nein! Du musst mir wenigstens die Wahl lassen, ehe du mich da mit hineinziehst!“
Mira verstummte. „Oh … okay. Ähm … möchtest du mit hineingezogen werden?“, fragte sie leichthin.
„Mira!“, rief Vera aus – ein bisschen belustigt, aber größtenteils entsetzt. „Du redest darüber, als ginge es nur um verbotene Ersatzschokoladenkekse!“
Sie hatte recht: Mira versuchte, die Angelegenheit so harmlos wie möglich klingen zu lassen. Vera musste einfach mitkommen. Mira war nicht sicher, ob sie alleine den Mut aufbringen würde.
„Das ist viel besser als verbotene Kekse“, beharrte sie, immer noch flüsternd.
„Und gefährlich ist es obendrein“, entgegnete Vera. „Dein Vater würde …“
„Mein Vater hat damit überhaupt nichts zu tun“, fiel Mira ihr ins Wort. Sie wollte, während sie hier mit Vera und einem verbotenen Buch auf einem zerwühlten Bett saß, nicht einmal an ihn denken. Er hielt nichts von Büchern jedweder Art, und obwohl er wusste, wie gerne seine Tochter las, würde er sie nie für fähig halten, den Staat so zu hintergehen. Er wäre maßlos von ihr enttäuscht. Und wütend. Mira wusste nicht, was schlimmer war.
„Lass mich dir davon erzählen.“ Mira schob den Gedanken an ihren Vater so weit weg wie irgendwie möglich. „Dieses Buch ist …“
Doch Vera sollte vorerst nicht herausfinden, was an diesem Buch so besonders war und warum ihre Freundin dafür Kopf und Kragen riskieren wollte, denn Mira verstummte schlagartig, als sich ein schütterer, grauer Haarschopf und Bart samt dem dazugehörigen Kopf durch den Türspalt schoben. Der Körper, zu dem dieser Kopf gehörte, blieb hinter der Tür verborgen, war aber vermutlich genauso nachlässig gekleidet wie immer. Was Flecken, Risse und andere Makel an seiner Kleidung anging, schien Herr Petersen mit Blindheit geschlagen.
„Hallo, Mira“, begrüßte er sie. Im Gegensatz zu ihren eigenen Eltern nannte Herr Petersen Mira bei dem Namen, den sie sich selbst gewählt hatte. Mira gefiel das, und obwohl sie insgeheim vermutete, dass die Petersens schlichtweg nicht wussten, dass sie eigentlich Miriam hieß, erfüllte es sie mit dem warmen, heimeligen Gefühl des Willkommenseins.
„Ihr habt nicht rein zufällig meine Brille gesehen?“ Herr Petersen rieb sich die Nasenwurzel.
Vera schüttelte den Kopf und versuchte unauffällig so weit nach rechts zu rutschen, dass sie auf dem Buch saß, das immer noch zwischen ihnen auf der Bettdecke lag.
Herr Petersen zuckte die Schultern. „Sie ist nicht im Badezimmer, auch nicht im Kühlfach, und sie sitzt nicht auf meiner Nase“, zählte er auf. „Aber unter diesen Umständen will ich eure hochgeheimen Mädchengespräche nicht weiter stören.“ Er gluckste, und Vera sprang auf.
„Komm, Mira, lass uns meinem Vater helfen, seine Brille zu suchen. Sie könnte ja auch im Schlüsselkasten hängen. Da war sie letztes Mal“, plapperte sie, ohne auch nur ein einziges Mal Luft zu holen.
„Oh, lasst nur“, winkte Herr Petersen ab und zog schon den Kopf durch den Türspalt zurück. „Im Schlüsselkasten habe ich zuallererst nachgesehen. Aber weit kann sie nicht sein. So ein Haus verliert nichts.“ Seine Stimme entfernte sich bereits.
Vera stand noch einen Moment mit am ganzen Körper angespannten Muskeln in der Zimmermitte, ehe sie sich neben Mira und das verbotene Buch auf das Bett fallen ließ und sich den Pony aus der Stirn wischte. „Meine Güte, ich weiß noch nicht einmal, was in diesem Ding steht, und schon bringt es mich in Schwierigkeiten!“
„Dann lass mich dir die Geschichte erzählen“, nutzte Mira ihre Chance. „Bitte, Vera. Danach kannst du immer noch entscheiden, ob sie das Risiko wert ist.“
„Nichts ist dieses Risiko wert“, erwiderte Vera. Aber sie verschränkte die Arme vor der Brust und bedeutete Mira, zu erzählen.
Zum Abendessen setzte Herr Petersen ihnen gebratenes Brot und lauwarme Milch vor. Mira war nicht sicher, ob das ein Zeichen für die beschränkten Möglichkeiten einer Familie ohne nennenswerte Sonderrationen war oder schlicht darauf hinwies, dass es früher Frau Petersen gewesen war, die gekocht hatte.
Vera und Mira verschlangen das leicht angebrannte Mahl ohne Beschwerden und erklärten sich nur allzu übereifrig dazu bereit, den Abwasch zu übernehmen, damit Herr Petersen sich in sein Büro zurückziehen konnte. Keiner wusste so recht, was er darin eigentlich tat, aber Vera konnte versichern, dass er am Abend für gewöhnlich an seinem Schreibtisch einschlief.
„Und ihr kommt wirklich ganz und gar alleine zurecht?“, fragte er, nahm seine Brille – er hatte sie im Brotkorb wiedergefunden – ab und drehte sie in den Händen. Seine Nachfrage entsprang purer Freundlichkeit: Niemand hätte beim Anblick des sich türmenden Geschirrs von scheinbar mehreren Tagen Hilfe abgelehnt. Niemand, außer zwei Mädchen, die nur zu offensichtlich etwas im Schilde führten. Doch Herr Petersen atmete nur erleichtert auf, fischte ihnen einen frischen Lappen aus dem Putzschrank und stahl sich in sein Büro davon.