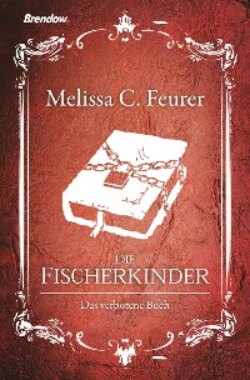Читать книгу Die Fischerkinder - Melissa C. Feurer - Страница 15
Eine andere Welt
ОглавлениеVera, die ohnehin eher schüchtern und still war, gab sich an diesem Tag besonders grüblerisch und in sich gekehrt. Wie automatisch ging sie neben Mira her zum Ausgang des Staatsgebäudes, in dem der Unterricht stattfand. An der Tür hatte sich wie immer eine kleine Schlange gebildet. Ärmel wurden zurückgeschoben und Armbänder unter den Scanner gehalten. Kein staatliches Gebäude durfte von jemandem ohne das Bändchen mit dem neunstelligen Identifikationscode betreten oder verlassen werden.
„Du hättest es wirklich schlimmer treffen können“, erklärte Mira betont vergnügt, während Vera ihr seit dem nächtlichen Ausflug übel zerknicktes Bändchen unter dem Scanner hin und her drehte. „Ein Interview mit einem Fachmann … ich meine, das ist spannend, oder?“
Veras sarkastisches Schnauben stand dem von Professor Winkelbauer in nichts nach.
„Ich würde das alles ja zu gerne einmal sehen“, fuhr Mira fort. Hinter ihnen reckten ihre Mitschüler schon die Hälse, um zu sehen, wer den Strom nach draußen so lange aufhielt. Endlich gelang es Vera, das ramponierte Band mit der freien Hand zu glätten und die Drehtür zu passieren. Hastig streckte Mira ihren eigenen Arm unter die blaue Lichtschranke und folgte ihrer Freundin.
„Wir können gerne tauschen“, brummte Vera.
Der Himmel über der Stadt war verhangen, und der Geruch drohenden Regens lag in der Luft. Die Kälte des Winters war endgültig verflogen, aber noch gab es nur wenige Vorboten des nahenden Sommers. Die Blumen in den Vorgärten und in den Kübeln vor so manchem Fenster hatten heute ihre Kelche geschlossen, und Mira fröstelte in ihrer dünnen Bluse.
„Warst du schon mal draußen auf den Feldern?“, fragte sie im Plauderton, damit Vera ihr die Anspannung nicht anmerkte.
„Klar. Als Kinder haben Filip und ich uns manchmal hinausgeschlichen und da draußen gespielt.“ Widerwillig wandte Vera sich Mira zu. „Wir wussten nicht, dass es verboten ist, sich dort draußen herumzutreiben“, setzte sie nach, als müsse sie sich rechtfertigen. Dabei war kein Wort des Tadels oder der Missbilligung über Miras Lippen gekommen. Im Gegenteil: Sie staunte. Aber mit einem Staatsbeamten als Vater hätte sie wahrscheinlich entsetzt sein müssen, dass Veras Eltern ihren Kindern nicht verboten hatten, dort draußen herumzustreunen.
„Die Leute sind arm dort“, fuhr Vera fort. „Sie tragen zerlumpte Kleider und strecken das Mehl mit Laub oder Stroh, weil sie nicht genug davon haben. Staatliche Erziehungshäuser gibt es nicht, aber dafür jede Menge Kinder. Sie spielen den ganzen Tag auf der Straße.“
Mira hing an Veras Lippen. „Das wusste ich nicht“, gestand sie. „Ich dachte, alle Kinder wachsen in Erziehungshäusern auf. Wie machen die Eltern das dort?“
„Die Mütter arbeiten nicht. Sie kümmern sich um die kleinen Kinder, aber für die größeren hat keiner Zeit. Sie hängen auf der Straße herum und gründen Banden.“
Miras lebhafte Fantasie malte ihr sofort eine wilde Szene vor Augen, in der einige nachlässig gekleidete Jugendliche mit schmutziger Haut und zu langem Haar einen Kampf mit aus Scherben gebastelten Waffen austrugen. „Woher weißt du das alles?“, fragte sie und schob den erschütternden Gedanken beiseite.
„Wir hatten Freunde unter den Jüngeren. Sie haben mit uns auf den Feldern gespielt.“ Sie hatten das Haus der Petersens erreicht, und Vera schloss die Tür auf. „Leider hilft mir solches Wissen nicht im Unterricht. Winkelbauer macht nichts lieber, als mich vor der versammelten Klasse zu schikanieren. Und die anderen genießen es.“
„Daphné genießt es“, sagte Mira. „Und Daphné ist nicht ‚die anderen‘.“
„Daphné ist so etwas wie die Klassenkönigin. Mit einem Justizstaatsbeamten als Vater ist sie wie geboren für diese Rolle.“ Vera warf ihre Schuhe auf einen chaotischen Haufen aus Zeitungen, Schuhen und Mänteln unter dem Garderobenhaken.
Mira stellte ihre daneben. „Mein Vater ist auch ein Justizstaatsbeamter.“
Nun sah Vera auf. „Ich weiß“, sagte sie, aber ihre Miene strafte sie Lügen. Für einen Moment schien sie es tatsächlich vergessen zu haben. Ausgelöscht, dass ihre beste Freundin eine von denen war. Dass Mira prädestiniert dafür war, an Daphné Barons Seite die weniger Angesehenen zu drangsalieren. Dass Mira und Daphné ein Herz und eine Seele sein könnten. Ihre Väter hatten sich das vom ersten Schultag an gewünscht. Aber Mira hatte sich eine andere Freundin gewählt. Eine, die nicht so gut zum Ruf ihrer Familie passte, die aber viel ehrlicher und vertrauenswürdiger war, als Daphné Baron es je sein würde.
„Lass die kleine Baronesse doch spotten, so viel sie will.“ Mira zuckte die Achseln. „Und ihrem Vater soll sie doch über dich erzählen, was auch immer ihr einfällt. Er ist nicht mal Filips Vorgesetzter.“ Genau wie Miras Vater hatte Baron eine Einheit Wachleute unter sich, die ihm auf Gedeih und Verderb folgen mussten. Aber Filip gehörte zur Einheit von Gerald Robins.
„Außerdem werden Winkelbauer und Daphné gar nichts gegen dich in der Hand haben. Mit einem Fachmann als Quelle wirst du ihnen überhaupt keine Gelegenheit zu spotten geben.“
Vera warf ihre Tasche in eine Ecke und nahm zwei Gläser aus dem fast leeren Küchenschrank. Das meiste Geschirr türmte sich schon wieder schmutzig am Spülbeckenrand. „Als würde Winkelbauer nicht trotzdem etwas finden, was ihm an meinem Vortrag nicht passt.“
„Nicht mit mir als Ghostwriter. Ich könnte das Referat für dich schreiben.“
Vera blieb der Mund offen stehen. „Du willst Winkelbauer hintergehen?“
Mira zuckte die Schultern, als sei nichts weiter dabei. „Wenn ich dir damit helfen kann.“ Sie zögerte gerade lange genug, um den Nachsatz nicht übereilt wirken zu lassen: „Natürlich müsste ich mit auf die Felder kommen. Morgen Nachmittag, wenn du den Landwirt triffst.“
Sie beäugte Vera aus dem Augenwinkel und fragte sich, ob sie wohl Verdacht schöpfte. Aber Vera war nicht misstrauisch, und das verursachte Mira fast ein schlechtes Gewissen. Stattdessen fiel ihre Freundin ihr um den Hals: „Ich will sowieso auf keinen Fall allein dorthin!“
Miras Angebot hatte Veras Stimmung erheblich gebessert. Sie kochten sich Nudeln zu Mittag, die sie aus Mangel an weiteren Zutaten mit einer Prise wertvollem Zucker verspeisten, den Vera erst am Vortag gegen gleich drei Rationskarten eingetauscht hatte.
Anschließend klappten sie ihre Schulbücher auf und machten sich an die Staatsgeschichtshausaufgaben. Immerhin verlangte Frau Dr. Steinlein nur selten Essays von ihnen. Die eigene Meinung hatte, wie sie stets betonte, im Staatsgeschichtsunterricht nichts verloren. Hier drehe sich alles um Fakten, Fakten und nochmals Fakten.
Stattdessen ließ sie die Schüler zu Hause ellenlange Texte lesen und zusammenfassen oder gab ihnen Rechercheaufgaben. Der heutige Text erstreckte sich über vierundzwanzig Buchseiten und war nur gelegentlich durch Fotografien wichtiger Dokumente und Personen unterbrochen. Bei solcherlei Aufgaben war es Mira und nicht Vera, die heilfroh war, dass sie die Hausaufgabe meist zusammen erledigten. Vera machte es nichts aus, laut vorzulesen, und Mira hörte ihr zur Hälfte zu und ließ zur anderen Hälfte ihre Gedanken schweifen, weil das meiste dank der regelmäßigen Vorträge ihres Vaters ohnehin nicht neu für sie war.
„ … nach Nicholas Auttenbergs Krönung unklar, ob die in der Verfassung grundgelegte Erbmonarchie in Kraft treten kann, da der Verbleib seines einzigen Sohnes, Carl Auttenberg, weiterhin unbekannt ist. Um die Zukunft der Monarchie zu sichern –“
„Das ist doch nicht zu fassen!“ Mira hatte die Knie angewinkelt und die Fersen auf die Stuhlkante gestützt, während sie sich mit den Knien vom Tisch wegdrückte, sodass ihr Stuhl gefährlich auf den beiden Hinterbeinen wankte. Jetzt ließ sie ihn so heftig nach vorne fallen, dass Vera vor Schreck das Buch zuklappte.
„Was ist nicht zu fassen?“, fragte sie atemlos, während sie die Seite wiederzufinden versuchte. Wahrscheinlich hatte auch sie begonnen, mit ihren Gedanken ein wenig abzuschweifen, doch jetzt waren sie beide hellwach.
„Dass sie dieses Thema wieder einmal nur anreißen!“, erwiderte Mira hitzig. „Weißt du noch, als ich Frau Dr. Steinlein damals gefragt habe, wie es sein kann, dass der Kronprinz eines Landes einfach so mir nichts, dir nichts verschwindet?“ Mira schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, und Vera verlor abermals die Seite, die sie eben erst wiedergefunden hatte. „Sie hat gesagt: Frau Robins, dieses Thema behandeln wir ein andermal zu geeigneterem Zeitpunkt. Und seitdem? Nichts, gar nichts!“
„Warum interessiert es dich denn so brennend?“ Vera ließ das Buch nun einfach zugeklappt auf dem Tisch liegen.
„Na, hör mal“, rief Mira aus. „Das lädt ja geradezu zu Spekulationenein! Ist er tot? Hat er sich einer konspirativen Kleinstgruppe angeschlossen und bekämpft sein eigenes Land als gesuchter Rebell? Hat sein eigener Vater ihn vielleicht verschleppen oder hinrichten lassen? An die Theorie mit der Entführung glaube ich jedenfalls nicht. Warum sollte ein anderes Land unseren Thronfolger entführen? Dann krönen wir eben einen anderen. Damit ist doch keinem geholfen!“
Vera pustete sich die Ponyfransen aus der Stirn und beobachtete Mira eingehend. Insgeheim interessierte es Vera bestimmt ebenso brennend wie Mira, was mit ihrem Thronfolger geschehen war. Aber Vera hatte gelernt, den Mund zu halten und sich nicht mit übermäßiger Neugier in Schwierigkeiten zu bringen. Ganz anders als Mira, mit der manchmal die Fantasie durchging.
„Überleg doch mal!“, ereiferte sie sich. „Wer weiß, was sie uns da verschweigen. Man findet ja kaum Informationen über ihn. Und wenn du mich fragst, ist das ganz schön verdächtig! Noch nicht einmal ein Foto haben sie uns je gezeigt!“
Nun begann Vera doch wieder, zu blättern. „Es gibt ein Foto. Hier in genau diesem Text.“
Sie beugten sich beide darüber und betrachteten die winzige Kopie eines Familienportraits, das Nicholas Auttenberg mit Frau und Sohn zeigte. Sie war blond und mager, Vater und Sohn hatten tiefschwarzes Haar in militärisch kurzem Schnitt und beide den gleichen harten Zug um den Mund.
„Hm … wie ein Rebell sieht er nicht gerade aus“, lenkte Mira ein. Zugegeben, er hatte schöne Augen. Dunkle Wimpern, wie die seiner Mutter, und einen nach innen gekehrten Blick, als wäre er in Gedanken ganz woanders. Aber Haltung, Kleidung und Gebaren erinnerten unverkennbar an seinen steifen Vater. Als König wurde Nicholas Auttenberg verehrt, aber insgeheim konnte Mira sich nicht vorstellen, dass irgendjemand ihn besondersgut leiden konnte. Eiskalt war er und reichlich wenig menschlich, nach allem, was man so hörte. Einer, der dazu geboren war, Befehle zu geben und im Reichtum zu leben, während sein Volk ums Überleben kämpfte.
„Auttenberg traue ich es trotzdem zu, seinen eigenen Sohn verschleppen zu lassen“, sagte sie entschieden. „Wenn es um den Thron geht, ist Blut bestimmt nicht dicker als Wasser. Und stell dir nur vor, wenn Carl Auttenberg andere Ansichten hatte als sein Vater. Da hätte der doch –“
Sie war gezwungen, ihre Ausführungen zu unterbrechen, weil Schritte im Flur ankündigten, dass sie nicht mehr alleine waren. Aber es war zu Miras Leidwesen nicht nur Veras liebenswerter, zerstreuter Vater, der sich zu ihnen gesellte, sondern auch Filip mit Uniform und Abzeichen.
„Dennoch heißt Pflichtbewusstsein nicht, dass man es jedem recht machen muss“, sagte Herr Petersen gerade, verstummte aber schlagartig, als er die Tür aufschwang und in die erstaunten Gesichter von Vera und Mira blickte.
Eisern schweigend zog er seine abzeichenlose Jacke aus, hängte sie auf und sah Vera eine Weile beim Lesen über die Schulter. Mit dem lauten Lesen und vor allem dem Debattieren über den Verbleib von Kronprinz Carl Auttenberg war es nun natürlich vorbei. Vera und Mira beugten sich still über ihre Bücher.
Filip holte unter lautem Poltern das Bügelbrett aus der Besenkammer und stellte es neben ihnen auf. Mira starrte noch eine Weile auf das Foto der Königsfamilie, ehe sie wieder zu lesen begann. Das Schweigen füllte jeden Winkel des Raumes. Nur hin und wieder ein Seitenrascheln, das Zischen des heiß werdenden Bügeleisens und Herrn Petersens schweres Atmen waren zu hören.
„Was machst du da?“, fragte er schließlich Filip, der eben ein schwarzes Jackett auf dem Bügelbrett ausbreitete.
„Antoine Herder hat mich gebeten, seinen Anzug in eine anständige Form zu bringen“, entgegnete er, ohne auch nur von seiner Arbeit aufzusehen. Mira dagegen hatte ihr Staatsgeschichtsbuch schnell vergessen. Sie sah zu Vera, die sich mit zusammengekniffenen Lippen unnötig tief über ihr Buch beugte. Ihre Nasenspitze berührte fast die Seiten.
„Seinen Anzug in eine anständige Form zu bringen“, echote Herr Petersen. Er stand immer noch hinter ihnen, weshalb Mira ihn nicht sehen konnte. Aber seiner Stimme nach zu urteilen, missfiel ihm, was er hörte. Sie war mit einem Mal entsetzlich dankbar, dass sich Iliona um die Wäsche, und damit auch um die Anzüge ihres Vaters, kümmerte. Sie würde sich in Grund und Boden schämen, wenn Filip eines Nachmittags das Jackett ihres Vaters mitbrächte, um es für ihn zu bügeln.
„Du bist jetzt ein Wachmann“, sagte Herr Petersen tonlos. „Kein Handlanger mehr. Sie können dich nicht mehr zwingen –“
„Keiner zwingt mich, Vater. Es handelt sich nur um eine Gefälligkeit.“
Mira beobachtete Filip unauffällig über ihr Buch hinweg. Er sah seinen Vater nicht einmal an, sondern pflügte nur weiter mit dem dampfenden Bügeleisen über den schwarzen Stoff.
„Antoine Herder kann seinen Anzug selbst bügeln“, sagte Herr Petersen mit Nachdruck. „Du bist nicht sein Diener. Was kommt als Nächstes? Dass du ihm die schmutzigen Stiefel putzt?“
Filips Gesicht nahm die rötliche Farbe seines Haars an, und er tat es Vera gleich, sich über seine Arbeit zu lehnen, als nehme er nichts um sich herum wahr.
„Um alles in der Welt!“, entfuhr es Herrn Petersen. „Sag, dass das nicht wahr ist!“
Nun stellte Filip das Bügeleisen doch zur Seite. Angriffslustig funkelte er seinen Vater über das Brett hinweg an. „Ich werde mir sicher keinen meiner Vorgesetzten zum Feind machen, weil ich mir zu schade dafür bin, seinen Anzug aufzubügeln.“ Er sah seinen Vater unverwandt an. „Und es wäre mir lieber, du hieltest dich heraus. Du hast deine Arbeitsmoral und ich meine. Und wir wissen alle, wohin deine dich geführt hat.“
Mira konnte nicht anders: Sie wandte sich zu Herrn Petersen um. Er hatte die Brille abgenommen und sah seinen Sohn an. Auf seiner gerunzelten Stirn standen die Schweißtropfen. Langsam nickte er. Dann legte er Vera, die ebenfalls gewagt hatte, den Kopf zu heben, die Hand auf die Schulter und sagte mit belegter Stimme: „Lern nur fleißig“, ehe er aus dem Zimmer schritt.
Mira begegnete Filips zornfunkelndem Blick und konzentrierte sich wieder auf ihre Hausaufgabe. Sie fühlte sich wie ein ungebetener Eindringling, nachdem sie diesen Streit im Haus der Petersens mitbekommen hatte. Normalerweise herrschte hier eine heimelige, friedliche Atmosphäre. Auf ihren Staatsgeschichtstext konnte sie sich nun natürlich nicht mehr konzentrieren, und als sie einmal zu Vera blinzelte, sah sie, dass auch sie auf die Buchseite starrte, ohne die Augen zu bewegen.
„Warum lässt Filip das mit sich machen?“, fragte sie ihre Freundin, als diese sie später zur Tür brachte.
Vera tat zuerst so, als wisse sie nicht, wovon Mira redete, dann jedoch ergriff sie schnell Partei: „Er hat ja keine Wahl.“ Sie sah Mira nicht an, während sie sprach. „Wenn er es im Staatsdienst zu etwas bringen will, muss er tun, was man ihm sagt.“
„Aber dein Vater hat recht!“, protestierte Mira. „Es ist nicht fair, dass sie von Filip verlangen, dass er –“
„Mein Vater hat seinen Posten und seinen Ruf schon vor Jahren verloren. Filip versucht nur, es besser zu machen. Um für uns zu sorgen. Von Vaters Rationen könnten wir gerade so überleben. Und das auch nur, wenn Mutter nicht … wenn wir nicht die Tabletten für sie bräuchten.“
Mira klappte den Mund auf, um abermals zu widersprechen, doch Vera schüttelte niedergeschlagen den Kopf. „Wir alle müssen tun, was man von uns verlangt. Filip muss Anzüge bügeln, und ich muss ein Zusatzreferat in Staatswirtschaft halten. Jemand mit unserem Ruf kann nicht so wählerisch sein wie …“ Sie verstummte schlagartig.
„Wie ich, meinst du.“ Mira umklammerte den Schulterriemen ihrer Tasche fester und sah Vera herausfordernd ins Gesicht. Aber Vera war niemand, der sich leicht provozieren ließ. Lieber nahm sie alle Schuld auf sich, als Feindseligkeit oder Streit in Kauf zu nehmen.
„Entschuldige“, murmelte sie. „Weißt du … ich rechne es dir hoch an, dass du mich morgen auf die Felder begleiten willst. Du müsstest das genauso wenig tun wie Filip das Bügeln dieser Anzüge.“
„Das ist doch etwas ganz anderes“, wehrte Mira ab, doch Vera schüttelte den Kopf. „Ich weiß, du tust es nicht nur für eine Beförderung oder eine gute Note. Sondern für mich. Und dafür bin dir sehr dankbar, Mira.“
Mira wusste, dass Veras Worte dazu dienen sollten, ihr schlechtes Gewissen wegen des scharfen Kommentars zu beruhigen. Dass sie Miras damit nur noch schürte, konnte Vera ja nicht ahnen.
Ihre Eltern waren nicht begeistert davon, dass Mira mit Vera hinaus auf die Felder gehen wollte. „Was denkt sich dieser Professor nur dabei, zwei Schülerinnen quer durch die Armenviertel zu schicken!“ Aber weil es sich um Staatswirtschaft handelte und das fast genauso wichtig war wie Staatsgeschichte, ließen sie Mira gehen. Ihre Mutter wies Iliona sogar an, ein paar belegte Brote und eine Packung Ersatzschokoladenkekse für Mira einzupacken. Falls es später werden sollte. Mira hatte mehrfach betont, dass sie zum Abendessen bestimmt nicht zurück sein würde.
„Die Landwirtschaft ist in der Tat eine spannende Angelegenheit“, lenkte ihr Vater ein, während ihre Mutter protestierte. „Ein Einblick in unser aufblühendes Versorgungssystem ist mit Sicherheit wichtiger als das Abendessen.“
Vera hatte zu Hause erst gar nichts von dem Referat erzählt. Ihre Mutter, so argumentierte sie, würde sich nur aufregen, und ihr Vater interessierte sich nicht dafür, mit welchen Lehrern Vera aus welchen Gründen aneinandergeriet.
Filip freilich wäre außer sich gewesen. Aber der schob mal wieder Überstunden im Staatsdienst.
So war Veras und Miras Aufbruch in Richtung Stadtrand doch recht unspektakulär. Mira tat ihr Bestes, ihre Nervosität zu verbergen. Immerhin hatte Vera keine Ahnung, warum sie wirklich so erpicht darauf gewesen war, sie zu ihrem Treffen mit dem Landwirt zu begleiten.
„Ich würde sagen, du stellst die Fragen und ich mache Notizen“, erklärte Mira fachmännisch. „Dann kann ich die Informationen gleich in Formulierungen bringen, die Winkelbauer entgegenkommen.“
„Und ich kann mich mit meinen dummen Fragen blamieren.“ Vera – ohnehin schon deutlich kleiner als Mira – sank sichtlich in sich zusammen. Mira musste wirklich geschickte Formulierungen finden, um Winkelbauer daran zu hindern, ihre Freundin vor versammelter Klasse vorzuführen.
„Winkelbauer hört am liebsten seine eigene Meinung“, erklärte Mira aufmunternd. „Wenn du ihn dann noch Glauben machst, du wärst selbst drauf gekommen, hast du schon fast gewonnen.“
Vera erwiderte nichts. Mit hängenden Schultern trottete sie vor sich hin, und Mira folgte ihr, während sie versuchte, sich eine gute Ausrede zu überlegen, sich in den Armenvierteln von Vera zu trennen. Nach dem Vortrag natürlich. Auch wenn sie aus eigennützigen Gründen mitgekommen war, wollte sie ihre Freundin nicht im Stich lassen.
Sie durchquerten das Zentrum von Leonardsburg, passierten „Porters Höhle“ und die Staatsgebäude: Schule, Rathaus und Gericht. Mira war schon viele Dutzend Male hier gewesen, und auch die Siedlung dahinter war ihr vage bekannt. Aber dann folgte sie Vera durch einen Torbogen in eine gepflasterte Gasse, und sofort war ihr klar, dass sie den Stadtkern hinter sich gelassen hatten.
Die Hausfassaden waren heruntergekommener, die Straßen schmaler, und ein Wachposten stand wie eine Statue auf der anderen Seite des Tores.
Augenblicklich versperrte er ihnen den Weg. „Ihr habt euch wohl verlaufen. Zwei junge Mädchen wie ihr!“ Er musterte sie von oben bis unten. „Ihr habt hier draußen nichts verloren.“
Obwohl sie einen guten Grund für ihren Spaziergang hatten, schlug Mira das Herz bis zum Hals, und die ihr von klein auf eingeimpfte Angst vor den städtischen Wachposten machte es ihr beinahe unmöglich, dem Mann in die Augen zu sehen. Auch Vera, der sie stattdessen einen Hilfe suchenden Blick zuwarf, starrte auf ihre Füße und machte nicht den Eindruck, als habe sie vor, zu antworten.
„Wir haben einen Termin.“ Mira reckte den Hals und zwang sich, dem Wachmann ins Gesicht zu sehen. Er konnte kaum älter als Filip sein, und das beruhigte Miras rasenden Herzschlag ein wenig. Vielleicht hatte auch dieser Mann Geschwister in ihrem Alter, und da war es doch natürlich, dass er sich um zwei Mädchen sorgte, die den sicheren Stadtkern verließen. Filip hätte Vera jedenfalls bestimmt nicht gerne hier draußen gewusst.
„Was für ein Termin soll das sein?“, fragte der Wachmann schroff, und Mira musste sich nun ernstlich bemühen, sein offensichtliches Misstrauen noch als Fürsorge zu entschuldigen.
„Herr Professor Winkelbauer“ – sie betonte den Namen mit Nachdruck – „schickt uns aus Recherchegründen zu einem Landwirt auf die Felder.“
Sie konnte sehen, wie der Wachmann beim Namen des Professors die Schultern noch ein wenig fester anspannte. Wahrscheinlich hatte er vor gar nicht allzu langer Zeit selbst bei Winkelbauer im Unterricht gesessen und wusste, dass man besser tat, was er einem auftrug.
„Viel zu gefährlich“, konstatierte er jedoch nach kurzem Ringen mit sich selbst. „Die Felder liegen jenseits der Armenviertel.“ Zwischen seinen buschigen Augenbrauen hatte sich eine steile Falte gebildet, und er wollte nicht aufhören, sie zu mustern. „Ohne eine erwachsene Begleitperson kann ich euch unmöglich passieren lassen.“
Miras Herz drohte ihr in die Hose zu rutschen. Aber nur für einen Moment. Dann straffte auch sie die Schultern und sagte langsam, als denke sie ernsthaft darüber nach: „Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als Herrn Professor Winkelbauer zu bitten, uns zu begleiten.“
Veras Augen weiteten sich vor Entsetzen. Aus Angst, sie könne ausgerechnet jetzt ihre Sprache wiederfinden, legte Mira noch nach: „Oh, Vera, das wird ihm aber gar nicht gefallen, wenn wir ihn damit belästigen.“
Nun endlich flackerte Verstehen in Veras Augen auf, und mit etwas zittriger Stimme fiel sie in das Spiel ein: „Wo er doch immer so viel zu tun hat.“
Der junge Wachmann schien nun ernsthaft in der Zwickmühle zu stecken. Seine linke Augenbraue zuckte, während er von Mira zu Vera und wieder zurücksah. Offenbar hatte Winkelbauer selbst bei einem Schüler, dessen Noten gut genug gewesen waren, um in den Staatsdienst zu treten, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ich könnte euch wohl ein Stückchen begleiten. Um Herrn Professor Winkelbauer ein wenig Arbeit abzunehmen.“
Und so machten sie es. Der junge Wachmann begleitete sie energischen Schrittes die Straße hinab, während die Häuser zu beiden Seiten immer kleiner und immer schäbiger wurden.
„Ein Glück, dass dieses Staatswirtschaftsprojekt wirklich existiert!“, raunte Mira Vera zu. Sie gingen einige Schritte voraus. „Ich wäre vor Panik, aufzufliegen, gestorben, wenn ich einen Wachmann hätte anlügen müssen.“
Vera runzelte die Stirn, und Mira hätte sich auf die Zunge beißen können. „Wenn es das Referat nicht gäbe, hätten wir doch gar keinen Grund, hier herauszukommen.“
„Stimmt!“ Mira lachte leise auf, in einer Tonlage, die – wie sie hoffte – befreit und nicht hysterisch klang.
Je weiter sie sich von der Mauer, welche die Innenstadt säumte, entfernten, desto mehr Menschen tummelten sich in den schmalen Gassen. Je mehr Menschen, desto schäbiger sahen sie aus. Und je schäbiger sie aussahen, desto argwöhnischer betrachteten sie die beiden Mädchen in Begleitung eines blau uniformierten Wachpostens.
Zu Beginn bemühte Mira sich noch, den Blick gesenkt zu halten, doch schon bald sah sie sich ungeniert um und versuchte, jedes noch so kleine Detail der ungewohnten Umgebung in sich aufzusaugen.
Die Häuser standen dicht gedrängt; einen Garten hatte keines, dafür hingen schiefe Balkone an etlichen Stockwerken und von deren Geländern wiederum trockene Pflanzen. Vorhänge, die man hätte geschlossen lassen können, gab es hinter kaum einem Fenster. Frauen in gelblichen Schürzen fegten Vortreppen, ein bärtiger Mann bot lauthals Ware von einem klapperigen Wagen voller Krimskrams an. Ein Fahrradreifen war darunter, ein abgenutztes Schachbrett ohne Figuren und zahlreiche Töpfe und Pfannen mit Rostflecken.
„Günstige Gebrauchsware!“, rief er, als er sie erblickte. „Der Herr, die Damen, Töpfe heute im Sonderangebot! Oder eine Spieluhr für die jungen Damen!“
Mira hätte sich den Stand gerne angesehen. Nicht dass sie Rationskarten oder irgendetwas zum Tauschen gehabt hätte – außer der Notiz aus „Porters Höhle“ trug sie nichts bei sich. Aber sie war neugierig und überwältigt von all den fremden Eindrücken in dieser sonderbaren Welt, die jahrelang ohne ihr Wissen Seite an Seite mit der vertrauten Umgebung der Innenstadt existiert hatte. Es roch sogar anders als im Stadtkern: Eine Mischung aus feinem Staub, dem Duft, der durch unzählige offene Küchenfenster wehte, und dem salzigen Geruch von Schweiß lag in der Luft.
Sie überquerten eine hölzerne Brücke über einem Rinnsal von einem Fluss, wichen einer Horde von Kindern aus, die einem zerfledderten Ball nachjagten, und stiegen über zerbeulte Mülltonnen, die umgefallen waren und über die Straßen rollten.
„Kein Platz für Jugendliche wie euch“, sagte der Wachmann gerade, als aus einer Seitengasse ein greller Schrei ertönte: „Stehen bleiben! So halte jemand den Dieb auf!“
Ein Junge mit tiefschwarzen Locken stürmte die Straße entlang, die sich mit der kreuzte, auf der sie gingen. Unter einem Arm trug er ein winziges, braunes Bündel, während er mit dem anderen heftig ruderte, als könne er sich selbst dadurch antreiben, noch schneller zu rennen. Immer wieder wandte er den Kopf nach hinten, um die zeternde Frau im Auge zu behalten, die seine Verfolgung aufgenommen hatte. Er war so beschäftigt mit ihr, dass er Mira, Vera und den Wachmann gar nicht bemerkte und beinahe direkt auf Vera knallte, die ihm am nächsten stand.
Bevor das jedoch passieren konnte, machte der Wachmann einen Satz und packte den Jungen am Kragen. Sofort begann dieser, wild um sich zu schlagen. Das braune Bündel fiel zu Boden, und Mira hob es auf. Es war ein Laib Brot.
„Habe ich dich“, lachte der Wachmann, der offenbar eine diebische Freude verspürte, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein. Weniger glücklich war die Frau, die in diesem Augenblick zu ihnen aufschloss. Sie riss Mira das Brot aus der Hand und begann, damit auf den Jungen, der wehrlos im Griff des Wachmanns festsaß, einzuprügeln.
„Du Rotzlöffel! Brot aus meinem Laden zu stehlen! Brot, das ich im Schweiße meines Angesichts gebacken habe!“
„Hören Sie sofort auf!“ Miras Einschreiten geschah so abrupt, dass nicht nur die Frau zurückwich, sondern auch der Wachmann den Griff um den Hemdkragen des Jungen lockerte. Das Kind stolperte einen Schritt zurück und geradewegs in Veras Arme, die in die Hocke gesunken war und es schnell an den Handgelenken festhielt. Intuitiv trat Mira halb zwischen die beiden und die aufgebrachte Frau.
„Schon gut“, beruhigte Vera hinter ihr den Jungen mit ihrer leisen Stimme. „Dir geschieht nichts. Es war ja nur ein Laib Brot. Du hast Hunger, was?“
„Nur ein Laib Brot!“, kreischte die Bestohlene. Mira fiel auf, dass sie keine verfärbte Schürze trug wie die anderen Frauen, die sie gesehen hatten. Überhaupt sah sie, bis auf ein paar Mehlspuren im dunklen Haar und den hochroten Kopf, sehr gepflegt aus. Sie trug eine weiße Bluse, deren Ärmel sie hochgekrempelt hatte, und unverkennbar glänzend neue Schuhe. Die meisten Menschen, denen Mira hier draußen begegnet war – einschließlich des schwarz gelockten Jungen neben Vera – trugen überhaupt keine Schuhe. Dabei war erst Frühjahr und das Wetter zwar trocken, aber kühl.
„Jedes einzelne Körnchen Getreide hat mein Mann eigenhändig auf den Feldern angebaut, geerntet und gemahlen!“, wetterte die Frau nun an den Wachmann gewandt. „Und nun ist das Brot nutzlos. Ich kann es nicht verkaufen, nachdem der da es mit seinen schmutzigen Händen angefasst hat!“ Angewidert nickte sie in Richtung des Kindes, über dessen staubige Wangen jetzt Tränen liefen. Trotzdem hatte sein Blick etwas unbestreitbar Trotziges. Mira ahnte, dass der Junge auf und davon wäre, sobald Vera ihn losließe. Fast wünschte sie, ihre Freundin täte es.
„Nur gut, dass ein Wachposten alles mitbekommen hat!“, fuhr die Frau fort. „In der Innenstadt verhängen sie lange Gefängnisstrafen für Diebstahl.“
„Aber er ist doch nur ein Kind!“ Miras entsetzter Ausruf wurde von einer Frauenstimme übertönt, die markerschütternd „Ari!“ schrie. Innerhalb von Sekunden war sie zu ihnen gestürzt.
Vera landete auf dem Hosenboden, so ungestüm fiel die Frau neben ihr auf die Knie und zog den Jungen an sich. Sie hatte die gleichen schwarzen Locken wie er, und ihre Kleidung war zerschlissen. In einem Tuch hatte sie sich einen Säugling umgebunden, der wie am Spieß brüllte.
„Ihr Sohn wurde auf frischer Tat beim Stehlen erwischt“, schaltete nun der Wachmann sich ein, während die Mutter ihr Gesicht in das zerzauste Haar des Jungen drückte und wehklagte. „Was machst du nur, Ari? Was machst du nur? Fünf Söhne, nichts als Sorgen! Nicht weinen. Es ist gut. Keiner darf dir wehtun, hörst du? Mama kümmert sich um alles.“
„Ich muss ihn mit in die Stadt nehmen“, sagte der Wachmann, als hätte er nichts von alledem mitbekommen, und griff nach Ari. Doch die Umklammerung der Mutter war stärker.
„Nein!“ Sie erhob sich und schob das Kind hinter ihren Rücken. „Nicht meinen Jungen mitnehmen. Ich zahle zurück, was er gestohlen hat. Ich verspreche es.“
„Zurückzahlen?“ Die Bestohlene bleckte die Zähne. „Richtiges Brot, ohne Laub oder Stroh, könntest du dir gar nicht leisten!“
Als wäre ihre kleine Menschenansammlung nicht schon aufsehenerregend genug gewesen, stieß in diesem Moment ein dickbäuchiger Mann zu ihnen. „Aber, aber“, sagte er und legte der Frau mit dem Brotlaib eine massige Hand auf den Rücken. „Was ist geschehen, Liebes? Warum bist du nicht in deinem Laden?“
„Wir wurden schon wieder bestohlen, Othmar.“ Seine Frau straffte die Schultern und hielt ihm anklagend das Brot entgegen. „Seit Monaten geht das nun so. Und immerzu sage ich dir, du musst härter durchgreifen. Aber dieses Mal …“ Sie sah zu Ari, der ihren Blick verbissen erwiderte. Die Tränen hatten glänzende Linien auf seinem schmutzigen Gesicht hinterlassen. „ … dieses Mal kommen sie damit nicht davon.“
„Sie wollen doch nicht etwa die Mutter dieser beiden Kinder mitnehmen?“, wandte der Dickbäuchige sich an den Wachmann.
„Den Jungen“, erwiderte dieser mit militärischer Knappheit. Die Frau quittierte dies mit einem grimmigen Nicken, und Aris Mutter begann wieder zu schluchzen, kniete neben ihrem Sohn nieder und drückte ihn so fest an sich, dass der Säugling zwischen ihnen noch lauter schrie.
„Meine Güte, wem ist denn damit gedient?“, entfuhr es Othmar. „Arbeitet dein Mann nicht auf meinen Feldern?“ Er wandte sich an die auf dem Boden kniende Mutter. Diese nickte mit steinerner Miene.
„Er soll die nächste Woche unentgeltlich arbeiten, und ich will die Sache vergessen.“
„Aber Othmar!“, protestierte seine Frau, doch er hatte schon ein ledergebundenes Notizbuch aus einer unter seinem mächtigen Bauch verborgenen Hosentasche gezogen und schrieb etwas darin auf.
„Ich wollte dich fragen, ob du Hilfe im Laden brauchst“, wandte Othmar sich schließlich wieder an seine Frau, als hätte er den Zwischenfall bereits vergessen. „Aber daraus wird nun nichts mehr. Ich muss schon in fünf Minuten wieder an der Scheune sein und Professor Winkelbauers Schülerin treffen.“
Mira riss den Blick von Ari und seiner Mutter los und besah sich Othmar genauer. Er trug Hemd und Stoffhosen wie jeder andere auch. Zwar zierten große Schweißflecken den Stoff unter seinen Armen, doch war er ansonsten kaum weniger gepflegt als jeder Staatsbeamte in der Innenstadt. Wie ein Landwirt sah er rein gar nicht aus.
„Das sind wir“, sagte Mira jedoch und streckte ihm die Hand entgegen. „Wir sind Professor Winkelbauers Schülerinnen.“
Othmar führte Vera und Mira durch eine Gasse, an deren Ende ein massiges Holzgebäude stand. Es hatte kein zweites Stockwerk, war dafür aber mehr als zehnmal so breit wie hoch. Neben den schmalen Häusern, die sich dicht an dicht in den Straßen des Armenviertels drängten, wirkte es geradezu lächerlich groß.
„Da wären wir.“ Othmar öffnete ein schweres Schiebetor und ließ sie in das Halbdunkel dahinter treten. Es handelte sich um einen Lagerraum. Leinensäcke, vermutlich voller Getreide, stapelten sich bis an die niedrige Decke; Fässer, Eimer, Bewässerungsschläuche und allerlei Gerätschaften lagen in gut sortiertem Chaos bereit. Alles sah ungeheuer alt und abgenutzt aus, abgesehen von dem blitzsauberen, silbernen Scanner neben der Hintertür und einem Schreibtisch, der in einer Ecke zu ihrer Rechten auf einem Teppich stand und nicht so recht zum Rest der Einrichtung passen wollte.
„Ich wusste nicht, dass ihr zu zweit kommt.“ Othmar ging geradewegs zu dem Tisch, auf dem Unterlagen zu ordentlichen Türmen gestapelt waren.
„Ich begleite Vera“, beeilte Mira sich zu erklären und versuchte, zu wiederholen, was ihr Vater gesagt hatte: „Die Landwirtschaft halte ich für eine spannende Sache. Ein Einblick in das aufblühende Versorgungssystem unseres Staates k-“
„Schon gut!“ Othmar lachte. „Ich dachte, die Jugend interessiere sich nicht für die Landwirtschaft. Aber wenn ihr das alles für so spannend haltet, will ich euch erst einmal herumführen.“ Er zerrte das ledergebundene Notizbuch aus seiner Hosentasche und legte es auf seinen Schreibtisch. „Muss mir alles aufschreiben“, meinte er, als er den Blicken der beiden Mädchen folgte. „Der Kopf ist das reinste Sieb. Wahrscheinlich würde ich am Morgen vergessen, zur Arbeit zu gehen, wenn ich es mir nicht notieren würde.“ Lachend tätschelte er das Notizbuch und kam schließlich um den Schreibtisch herum zu Mira und Vera. „Dann wollen wir mal!“
Sie folgten Othmar durch den Lagerraum und zur Hintertür. Mira staunte, als er die Torflügel aufschwang und stolz nach draußen wies. Aber es war kein gutes, beeindrucktes Staunen, auch wenn Othmar ihren Blick hoffentlich so deutete, sondern eines, das sich mit Entsetzen mischte.
Leonardsburg lag hinter ihnen. Auf der anderen Seite des Gebäudes erstreckten sich nur noch die Felder. Hellbraune, dunkelbraune, grüne und gelbliche Quadrate, die sich wie ein Flickenteppich bis zum Horizont aneinanderreihten. Kein Strauch, kein Baum, nichts, das in den heißen Sommermonaten Schatten spenden konnte oder bei Regen Schutz vor Wind und Wetter bot.
Nun wusste Mira auch, warum Othmar nicht aussah, wie sie sich einen Mann vorgestellt hatte, der sommers wie winters draußen auf den Feldern arbeitete, pflügte, pflanzte, pflegte, bewässerte und erntete. Die Wahrheit war, dass Othmar vermutlich einen Großteil seiner Zeit am Schreibtisch verbrachte und andere für sich schuften ließ.
Sie beugten die Rücken über ihre Arbeit. Ganze Reihen von ihnen tummelten sich dort draußen. Von Hand lockerten die einen mit kleinen Harken die Erde auf, während andere Unkraut ausrissen und in große Körbe warfen, die sie bei sich trugen. Mit Sensen wurden Wiesen gemäht, aus schwarzen Säcken Dünger verteilt und mit monströsen Spritzen winzige, grüne Pflänzchen mit Insektiziden besprüht.
„Wir sind eines der größten Unternehmen der Region“, erklärte Othmar stolz, „das fast zu hundert Prozent ohne Fahrzeuge auskommt. Es gibt Firmen, die alte Düngerstreuer, Mähdrescher und Traktoren zu Elektrofahrzeugen umbauen. Aber Strom ist teuer. Ich spare eine Menge durch die billigen Arbeitskräfte aus den Armenvierteln.“ Er lachte, sodass sein dicker Bauch wackelte. „Es gibt so viele, die Arbeit suchen, dass ich gar nicht alle einstellen kann. Und genügsame Menschen sind das. Verlangen nicht viel für ihre Arbeit.“
„Oder gar nichts“, überlegte Mira bitter und dachte an Aris Vater, der in der nächsten Woche umsonst hier draußen würde arbeiten müssen. Was würde aus der Familie werden, wenn er eine ganze Woche lang keine Rationskarten nach Hause brachte? Ari hatte einen Laib Brot gestohlen – sicher kein Lausbubenstreich. Wahrscheinlich reichten die Rationen, die Aris Vater für seine Arbeit auf den Feldern zugeteilt bekam, schon so kaum zum Leben.
Vera schien Ähnliches durch den Kopf zu gehen. Mit offensichtlicher Bestürzung beobachtete sie die Menschen, die Othmar für sich auf den Feldern schuften ließ. Sie sahen nicht einmal von ihrer Arbeit auf, gönnten sich kein Innehalten und keine Unterbrechung. In ewig gleichbleibenden Bewegungen verrichteten sie ihre mühsame Tätigkeit.
Wenn Othmar Vera ins Gesicht sah, würde er dort nichts sehen, das regem Interesse an seiner Arbeit auch nur nahekam. Und wenn er wirklich Winkelbauers Freund war, dann war es alles andere als ratsam, sich ihn zum Feind zu machen.
Mira gab sich einen Ruck. „Welche Getreidesorten bauen Sie an?“, fragte sie so interessiert wie möglich. „Und wann ist Zeit für die Ernte? Wie viele Bürger können Ihre Erträge mit Brot versorgen?“ Es spielte keine Rolle mehr, dass sie Vera die Aufgabe zugewiesen hatte, die Fragen zu stellen. Sie waren beide nicht auf das hier gefasst gewesen.
Nur allzu bereitwillig gab Othmar Auskunft. Er erklärte so ausführlich und redete so viel, dass er gar keine Gelegenheit hatte, den Blick zu bemerken, mit dem Vera immer noch seine Arbeiter musterte, oder mitzubekommen, wie sie angeekelt zur Seite trat, als der Wind eine feuchte, scharf riechende Wolke Insektizide in ihre Richtung wehte.
„ … arbeiten ganzjährig hier. Dazu kommen im Sommer über hundert Erntehelfer.“
„Und wie viele von ihnen lassen Sie umsonst für Sie arbeiten?“, fragte Vera unvermittelt.
Mira, die Othmars Antworten in Kurzform notierte, glaubte einen Moment, sich verhört zu haben. Othmar schien es ähnlich zu gehen.
„Umsonst?“, fragte er irritiert und sah Vera mit schief gelegtem Kopf an. „Ich sagte, die Leute aus den Armenvierteln verlangen nicht viel. Natürlich bekommen sie Lohn für jeden Arbeitstag.“ Er nickte durch das geöffnete Tor zum Ausweisscanner an der Wand. „Jeden Abend werden ihre Arbeitsstunden verbucht und an die Zuteilungsstelle für Rationen übermittelt.“
Ehe Vera an den Vorfall mit Ari und dem gestohlenen Brot erinnern konnte, platzte Mira mit der nächstbesten Frage heraus, die ihr einfiel: „Was machen die Sommerarbeiter im Winter, wenn Sie nichts für sie zu tun haben?“
„Sie suchen sich anderswo Arbeit“, erwiderte Othmar, warf Mira aber nur einen Seitenblick zu, während er weiterhin Vera musterte, die seinen Blick so fest erwiderte wie Ari vorhin den der wütenden Frau. So verbissen kannte Mira sie gar nicht. Vera musste ernstlich erschüttert sein über das, was sie hier sahen.
„Es gibt genügend Fabriken“, fuhr Othmar fort. „Auch wenn die Stellen dort nicht so beliebt sind wie die auf den Feldern. Fabrikarbeit ist undankbar. Vieles, was früher automatisch ablief, muss heute mühsam von Hand erledigt werden. Und manche der Arbeiter sehen nie etwas von ihrem Lohn.“ Er zuckte die Schultern. „Immerhin werden sie, wenn sie eine Stelle haben, in die Zuteilungslisten für die Grundrationen aufgenommen. Das sichert vielen Familien das Überleben.“
„Sie meinen, wer keine Stelle hat, bekommt auch keine Rationen?“
Othmar runzelte die Stirn. „Natürlich nicht. Warum sollte der Staat für jemanden aufkommen, der nichts zu seinem Erhalt beiträgt?“
„Aber was machen diese Leute?“
„Ich dachte, euch interessiert die Landwirtschaft“, sagte Othmar und erinnerte Mira wieder daran, dass er mit Winkelbauer unter einer Decke steckte und dass mit ihm deshalb – auch wenn er wesentlich freundlicher als der boshafte Staatswirtschaftslehrer schien – nicht zu spaßen war. Die falschen Fragen zu stellen konnte gefährlich sein; möglicherweise nicht nur für ihre Note in Staatswirtschaft.
Sie gaben sich wirklich Mühe. Vera kehrte zu ihrer gewohnten Schüchternheit zurück, doch wenn man sie so gut kannte wie Mira, konnte man in ihren Blicken und Gesten die Feindseligkeit erkennen, die sie dem Landwirt entgegenbrachte. Es war nicht schwer zu erraten, woran sie dachte: Sie konnte es nicht ertragen, welches Unrecht diesen Menschen, insbesondere Ari und seiner Familie, geschah.
Sie war ganz still geworden, als sie sich schließlich mit drei Seiten handschriftlichen Notizen und schwirrenden Köpfen von Othmar verabschiedeten. Er brachte sie zur hinteren Lagertür zurück, öffnete sie ihnen und verabschiedete sich herzlich, aber knapp. „Ihr findet den Weg alleine, nicht wahr?“, fragte er mit einem Blick auf seine schuftenden Angestellten. „Euer Professor meinte, ich könnte euch vielleicht jemanden mitschicken, der euch zum Rand der Innenstadt begleitet …“
Er verstummte, und Mira ergriff die Gelegenheit beim Schopf. „Aber nein“, winkte sie ab. „Sie brauchen vermutlich all Ihre Leute hier draußen auf den Feldern. Wir haben ja gesehen, wie beschäftigt alle sind. Den Weg zu finden ist kein Problem.“
Othmar schien das nur gelegen zu kommen. Kaum einige Sekunden später war er davongeeilt, so schnell sein Bauch es zuließ, und Mira und Vera fanden sich alleine im Lagerraum wieder.
Das Tor auf der anderen Seite ließ sich nur schwer öffnen. Mira musste sich mit aller Kraft dagegenstemmen. In Gedanken war sie bereits dabei, sich eine Ausrede zurechtzulegen, warum sie nicht mit Vera in die Innenstadt zurückging. Ihr Gespräch mit dem Landwirt hatte länger gedauert, als sie erwartet hatte. Mittlerweile war es halb sechs, und die Sonne stand tief. Draußen auf den Feldern hatten sie zusehen können, wie sie sich dem Flickenteppich aus verschiedenfarbigen Flächen genähert hatte.
„Warum hilfst du mir denn nicht?“ Mira, die sich immer noch mit der Tür abmühte, sah sich ärgerlich nach Vera um. Doch die war nicht wie vermutet direkt neben ihr. Ein paar Meter hinter Mira war sie stehen geblieben und starrte auf den Schreibtisch in der Scheunenecke, der so furchtbar deplatziert aussah. Othmars kleines Notizbuch lag zuoberst.
„Oh nein, denk nicht mal daran!“, flüsterte Mira. Ärger konnte sie jetzt wirklich nicht gebrauchen. In einer halben Stunde musste sie am Westturm sein, um mehr über das verbotene Buch herauszufinden. Vera durfte diesen Plan unter keinen Umständen durchkreuzen.
„Was soll aus Ari und seinen Geschwistern werden, wenn sein Vater nicht einmal den Lohn für seine harte Arbeit nach Hause bringt?“, fragte Vera. „Das alles ist eine schreiende Ungerechtigkeit! Wenn ein Kind so hungrig ist, dass es Brot stiehlt –“
„Was sollen wir denn machen?“
Vera schluckte hörbar und starrte wie gebannt auf den Schreibtisch. „Er hat gesagt, ohne sein Notizbuch kann er sich nichts merken.“
„Wir können es aber doch nicht einfach stehlen!“, sträubte sich Mira. „Ich weigere mich, sein Buch zu –“ Sie verstummte. Immerhin wäre das Notizbuch des Landwirts nicht ihr erstes gestohlenes Buch. Und Vera wusste das genau.
„Na schön!“ Sie ging an ihrer Freundin vorbei. Selbst würde diese ja doch nicht den Mut haben, sich dem Schreibtisch auch nur einen einzigen weiteren Schritt zu nähern. Sie keuchte bereits entsetzt auf, als Mira nach dem Büchlein griff und es aufklappte. Das Leder unter ihren Fingern fühlte sich samtig und teuer an. Wie alles an Othmar und seiner Frau passte es nicht in die karge Umgebung der Armenviertel.
Othmar schien sich tatsächlich einfach alles zu notieren: die Zeit des Abendessens, die Mengen an Saatgut und Insektiziden, die wann von wo geliefert wurden, und solche Dinge wie: „Rasieren und Haare kürzen.“
Auf der letzten Seite standen lediglich ein Termin mit einem anderen Landwirt und die Erinnerung, Aris Vater für die kommende Woche den Lohn zu streichen. Ohne länger zu zögern, packte Mira das dicke Papier und riss es mit einem lauten Ratschen aus dem Büchlein.
„So“, sagte sie zufrieden zu Vera und legte das kleine Buch wieder auf den Schreibtisch. Aber Vera schüttelte nur den Kopf und legte den Finger an die Lippen.
Wie erstarrt stand Mira auf dem weichen Teppich, der unter dem Schreibtisch verlegt war. Jetzt hörte sie es auch: die sich nähernden Schritte von der jenseitigen Hallenhälfte.
Wie auf ein unsichtbares Zeichen rannten sie beide los. Zu zweit und in Panik ließ sich das Tor beinahe mühelos aufschieben, und schon Sekunden später stürmten sie die Straße hinab.
„Du bist mir etwas schuldig“, keuchte Mira, als sie zwei Gassen weiter zum Stehen kamen und sich vorlehnten, um nach Luft zu schnappen. Sie hatte die Hände auf die Knie gestützt und sog die kühl gewordene Abendluft in ihre Lungen, bis ihr Atem wieder langsamer ging. Nur ihr Herzschlag wollte sich nicht beruhigen. „Ich habe Kopf und Kragen riskiert, um etwas zu tun, das dir am Herzen liegt.“ Sie sah Vera an, der die Ponyfransen an der Stirn klebten. In ihrem Blick lag etwas Ahnungsvolles, gemischt mit ein bisschen Furcht. „Jetzt“, sagte Mira jedoch ruhig, als hätte sie davon nichts bemerkt, „bist du an der Reihe.“