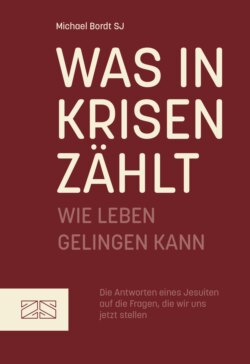Читать книгу Was in Krisen zählt - Michael Bordt - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеWas in Krisen zählt, das zählt auch im Leben. Denn es sind vor allem Krisenzeiten, persönliche und gesellschaftliche, in denen wir herausgefordert werden uns zu fragen, auf was es uns eigentlich im Leben ankommt, welche unsere Prioritäten und Lebensziele sind und ob wir etwas an unserem Leben ändern sollten. Wir stellen diese Fragen nicht nur, um besser durch die Krise zu kommen. Wir nutzen die Krise, um uns Gedanken darüber zu machen, ob wir eigentlich ganz generell auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht sind wir ja in die Krise gekommen, individuell und gesellschaftlich, weil wir schon vor der Krise nur so vor uns hingelebt haben. Wir haben uns nie fragen müssen, ob das Leben, das wir führen, tatsächlich zu uns passt und ob die Werte und Lebensziele, um die wir uns bemühen, uns tatsächlich glücklich machen werden. Krisen können solche Fragen herausfordern. Es sind Fragen, mit denen sich die Philosophie seit ihren Anfängen vor weit über 2000 Jahren in Griechenland beschäftigt hat.
Krisen sind aber auch Zeiten, in denen die Orientierung schwerer fällt. Aufgrund eines erhöhten Handlungsdrucks und wachsender Komplexität ist es mühsam, Klarheit und Sicherheit in der eigenen Gedanken- und Gefühlswelt zu erreichen. Die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind unsicherer und folglich belastender. Dabei lassen sich zwei Fragen voneinander unterscheiden: Was für unmittelbare Maßnahmen müssen ganz konkret ergriffen werden, damit die Krise nicht zur Katastrophe wird, sondern die Chance, die in jeder Krise steckt, genutzt werden kann? Um diese Frage zu beantworten, ist Sachkompetenz gefordert. Und: Welche ist die richtige Grundorientierung des eigenen Lebens und des Zusammenlebens in einer Gesellschaft? Die Grundorientierung ist dabei wie ein Kompass. Wenn ein Kompass nicht richtig eingenordet ist, wird man trotz bestem Willen und aller Mühen keinen gangbaren Weg aus einem Dschungel finden. Wenn unklar ist, was im Leben zählt, dann fehlt jeder einzelnen Entscheidung ein sicheres Fundament. Um die Skizze eines solchen Fundaments geht es mir in diesem kleinen Buch.
Als ich das Manuskript dazu vor knapp 13 Jahren abgegeben habe, war der unmittelbare Anlass zu meinen Überlegungen die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 in den USA begonnen und auch die europäische Wirtschaft in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht hatte. Die Finanzkrise war zwar der äußere Anlass, aber nicht die einzige Krise, die die Welt damals beschäftigte. Zwei weitere, der internationale Terrorismus und die stetige Erderwärmung, bedrohten damals schon die Welt. Und auch sie provozieren die Frage: Leben wir richtig? Setzen wir in unserem Lebensstil und in dem, woran wir hängen und auf was wir nicht verzichten wollen, auf die richtigen Ziele?
In den 13 Jahren hat sich viel verändert. Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist mehr oder weniger überwunden. Der internationale Terrorismus hat durch den Sieg über den Islamischen Staat 2019 einen Rückschlag erlitten; allerdings ist nicht ganz klar, ob und in welcher Form er sich davon erholen und noch einmal erstarken wird. Das Bewusstsein für die Klimakrise ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, aber es ist nach wie vor nicht sicher, ob aus den hehren und auch ambitionierten Zielen verschiedener internationaler Abkommen tatsächlich politische Entscheidungen folgen, die den Klimawandel aufhalten werden. Zwei neue Krisen sind seit 2008 hinzugekommen, die man damals noch nicht einmal erahnen konnte: Die Infragestellung liberaler Demokratien und die verheerende Pandemie. Wer hätte damals gedacht, dass ein Donald Trump ernsthaft Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte? Aber nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern, selbst in Europa, steigt die Gefahr autoritär geführter Demokratien, und manche bezweifeln gar, dass liberale Demokratien zukünftig überhaupt noch in der Lage sein werden, Antworten auf die globalen Herausforderungen zu geben. Stehen wir vor einem elementaren Umbruch in unserer politischen Kultur?
Es mag sein, dass sich nicht jeder die Frage nach der Zukunftsfähigkeit politischer Systeme stellt. Vielen mag das Problem eher theoretisch erscheinen. Die Pandemie aber betrifft oder betraf jeden von uns. Die Einschnitte in unsere Freiheit, in unsere Beziehungen und Freundschaften, in unsere Art zu arbeiten und zu leben, die Freizeit zu verbringen, zu reisen, sind für alle gewaltig, für viele sehr schmerzhaft. Auch die Folgen der Pandemie lassen sich heute, zu Beginn der dritten Welle im März 2021, nicht seriös abschätzen. Wird man nach der Pandemie noch so sorglos, aber nicht selten ja auch etwas gedankenlos, weiterleben wie bisher? Werden wir weiter in dem bisherigen Stil die Welt bereisen? Weiter so konsumieren und wirtschaften? Wie wird sich die Arbeitswelt durch die Pandemie verändert haben? Werden wir so tun, als sei die Pandemie nur ein kurzer Unfall gewesen, aus dem nichts zu lernen ist, schon gar nichts über uns selbst?
Auch wenn ich nicht zu den Zeitgenossen gehöre, die nun meinen, die Krise führe notwendig zu einer Neubesinnung und jetzt sei es endgültig an der Zeit, politische Entscheidungen zu fällen, die man immer schon für richtig gehalten hat, so gibt es doch Grund zu Hoffnung und Zuversicht. Denn anders als vor 13 Jahren haben die Krisen, vor allem die zunehmende Erderwärmung und die Infragestellung liberaler Demokratien, Menschen dazu bewegt, aus ihrer privaten Komfortzone herauszugehen und sich öffentlich zu engagieren. Bei allen kritischen Anfragen, die man an eine Bewegung wie „Fridays for Future“ haben kann: Es gibt mir Hoffnung, dass junge Menschen sich auf einmal für Fragen interessieren und engagieren, die über private Karriere- und Reiseplanung weit hinausgehen. In den 30 Jahren, in denen ich an der Hochschule für Philosophie mittlerweile lehre, habe ich noch nie eine so wache und politisch engagierte Generation erlebt.
Und auch in der Pandemie machen viele Menschen trotz aller enormen wirtschaftlichen und menschlichen Einschränkungen und Probleme auch gute Erfahrungen. Sie spüren, wie wichtig ihnen familiäre Bindungen und Beziehungen sind – und sei es nur dadurch, dass sie sie vermissen. Manche erleben die Natur ganz neu, als eine Quelle von Kraft und Trost. Andere trauen sich kaum zu sagen, dass sie das Alleinsein, die Einsamkeit durchaus auch schätzen, und sind erleichtert darüber, dass viele oberflächliche, anstrengende Kontakte auf einmal weggefallen sind. Es wäre schade, wenn das, was uns in der Pandemie wichtig geworden ist und was wir neu über uns erfahren haben, nach dieser harten Zeit schnell alles wieder vergessen wird. Denn es gehört zu den Dingen, die in Krisen zählen und die das Fundament bilden, das uns nicht nur in Krisen, sondern in unserem ganzen Leben Kraft und Zuversicht geben kann. Denn Krisen kommen und gehen. Wenn aber unser Fundament stimmt, ist es für uns deutlich leichter mit ihnen umzugehen und sie zu bewältigen.
Um eine kurze, aber klare Skizze eines solchen Fundaments, einer solchen Grundorientierung ging und geht es mir in diesem Buch. Es freut mich, dass der Verlag sich entschlossen hat, das Buch mit einem neuen Vorwort und einigen wenigen Veränderungen noch einmal aufzulegen. Denn das, was ich darin zeigen möchte, ist unabhängig von konkreten Krisen. Dass meine Überlegungen vor allem auch von oberen Führungskräften in der Wirtschaft so positiv angenommen worden sind, hat mich besonders gefreut. Vor allem von Topmanagern wird in Krisen erwartet, dass sie anderen Menschen Orientierung geben können. Und dazu müssen sie erst einmal sich selbst Orientierung erarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl die abendländische Philosophie als auch die jahrhundertealte Tradition des Jesuitenordens dazu wichtige Impulse geben können.
Aber lesen Sie selbst …