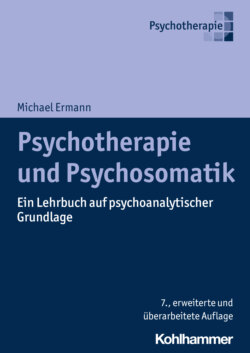Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.2 Komorbidität
ОглавлениеKrankheiten und Störungen können einzeln bestehen. Es können aber auch mehrere nebeneinander vorliegen. So können körperliche und seelische Erkrankungen gleichzeitig bestehen, ebenso wie mehrere seelische seelische Störungen zusammen auftreten können. Dieses Zusammentreffen von zwei oder mehreren Erkrankungen bezeichnet man als Komorbidität.
In der Psychotherapie bestand lange die Neigung, psychische Symptome einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer einzigen, möglichst ätiologisch begründeten Hauptdiagnose zusammenzufassen. Es bestand Zurückhaltung, Symptome auf mehrere diagnostische Entitäten und Achsen zu verteilen. Dahinter stand die Vorstellung, dass es zu einer gegebenen Zeit nur eine psychodynamische Dekompensation geben könne, aus der sich auch nur eine psychogene Erkrankung speisen könne.
Mit den Klassifikationssystemen ICD und DMS hat sich das Komorbiditätsprinzip der Diagnostik durchgesetzt. Es zentriert auf die Ebene der Phänomenologie. Das Zusammentreffen von zwei oder mehreren Erkrankungen wird danach – unabhängig von der Ätiologie – in Mehrfachdiagnosen dokumentiert.
Im Bereich der Psychotherapie ist Komorbidität häufig. Man findet sie vor allem bei Persönlichkeitsstörungen ( Kap. 8) und posttraumatischen Störungen ( Kap. 7.4). In einer Studie von 1994 fand man bei 52 Prozent der Teilnehmer keine, bei 21 Prozent eine, bei 13 Prozent zwei, und bei 14 Prozent drei oder mehr psychische Störungen. Persönlichkeits- und posttraumatische Störungen können zusammen mit Symptomneurosen auftreten. Es können aber auch mehrere Persönlichkeitsstörungen gleichzeitig diagnostiziert werden.
Neben Angststörungen bestehen häufig Somatisierungsstörungen oder bei depressiven Syndromen Sexualstörungen. Auch bei Verhaltensstörungen werden oft Mehrfachdiagnosen vergeben, z. B. Essstörung und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es sich zumeist nicht um das gleichzeitige Auftreten von zwei ätiologisch unterschiedlichen Störungen handelt, sondern dass die Psychodynamik, die zugrunde liegt, sich auf verschiedene Weise auf der Symptomebene niederschlägt. Hier macht das Konzept der Komorbidität bei genauerer psychodynamischer Betrachtung keinen Sinn.
Aber auch die Komorbidität von psychischen und körperlichen Störungen und Erkrankungen ist relativ häufig.18 Zwischen 10 und 20 Prozent der Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen dürften zugleich psychische bzw. psychosomatische Störungen aufweisen. Wenn eine primär körperliche Erkrankung zur Auslösesituation einer psychogenen Störung wird, z. B. ein Herzinfarkt zum Initiator einer Angststörung, dann kann man von einer sekundären psychogenen Störung sprechen. Diese Komorbidität ist bedeutungsvoll, weil die Patienten vor einer doppelten Bewältigungsaufgabe stehen, welche doppelte psychische Anpassungsarbeit erfordert, und zumeist ein zweigleisiges Vorgehen in der Behandlung erforderlich ist.
Die Beurteilung der Komorbidität ist kompliziert, weil die Ätiologie oft schwer einzuschätzen ist. Dabei kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht:
• Mehrere psychogene Störungen können nebeneinander bestehen, z. B. eine Zwangsstörung und eine bulimische Essstörung. Dabei nähren sich beide in der Regel nachvollziehbar aus derselben Psychodynamik. Aus deskriptiver Sicht bestehen zwei Störungen; aus psychodynamischer kann man annehmen, dass die Spannungsabfuhr durch Erschöpfung der Abwehr oder zusätzliche belastende Faktoren ausgeschöpft ist und deshalb eine »Zweitkrankheit« erforderlich ist. Man wird dieses Syndrom als ein Phänomen behandeln.
• Reine Koinzidenz besteht, wenn keine plausible Verknüpfung zwischen den Erkrankungen zu erkennen ist, z. B. eine Angststörung und ein Diabetes.
• Eine sekundäre psychogene Störung kann man annehmen, wenn eine Verknüpfung in dem Sinne besteht, dass die körperliche Erkrankung als psychodynamisch spezifische Auslösesituation fungiert und eine psychische Dekompensation bewirkt. Im Allgemeinen führt die körperliche Grunderkrankung dann zur Regression und aktiviert Affekte, die dann mit der Symptomatik abgewehrt werden. So kann ein Herzinfarkt verdrängte Todesängste aktivieren und eine depressive Störung triggern.
• Auch bei den somatopsychischen Störungen kann man von einer Komorbidität sprechen. Hier erscheint die psychogene Störung als seelische Reaktion auf eine primär körperliche Erkrankung. Im Unterschied zu den sekundären psychogenen Störungen gibt es hier aber keine vorbestehende neurotische Disposition. Beispiele sind depressive Reaktionen nach einer Krebsdiagnose oder Brustamputation.
• Auch symptomatische psychische Störungen sind in Betracht zu ziehen. Psychische Störungen können nämlich auch durch pathophysiologische Prozesse hervorgerufen werden. So gibt es symptomatische Depressionen und Angstzustände als Folge von Entgleisungen der hormonellen Steuerung (Hypo- und Hyperthyreose) oder durch Toxine (z. B. in der Rekonvaleszenz nach einer Infektion) ( Kap. 14.13).
• Schließlich ist als verwandtes Phänomen auch die Ätiologie der Psychosomatosen ( Kap. 12) zu bedenken: So kann eine Depression im Zusammenwirken mit körperlichen Krankheitsfaktoren und einem belastenden Life event eine körperliche Krankheit im Sinne einer Psychosomatose hervorrufen, z. B. ein Magengeschwür.