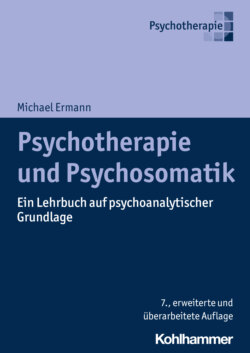Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
Zur 7. Auflage
Dieses Lehrbuch hat nach mehr als zwanzig Jahren seine eigene Geschichte. Ursprünglich von meinen Studenten1 angeregt, hatte ich es 1994 für den Gebrauch im Medizinstudium geschrieben. Damals war das Fach »Psychosomatische Medizin und Psychotherapie« neu in den Lehrplan eingeführt worden und es gab nur ganz wenige Lehrbücher für das neue Fach, in dem die psychodynamischen Konzepte dominierten. Es erwies sich aber rasch, dass das komplexe psychoanalytisch orientierte Denken zu weit vom Interesse des künftigen Allgemeinarztes wegführt, auf den das Medizinstudium ausgerichtet ist. Wir haben für den Leserkreis der jungen Mediziner deshalb bald parallel zu diesem Buch eine Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie herausgegeben, die sich großer Beliebtheit erfreut.2
So fand dieses Buch seine Leser hauptsächlich unter Ärzten und Psychologen in psychotherapeutischer Weiterbildung. Zum Leserkreis gehören aber auch praktizierende Psychotherapeuten und Psychiater, die für den psychodynamischen, psychoanalytisch orientierten Ansatz aufgeschlossen sind. Für diesen Leserkreis wurde die Bearbeitung der verschiedenen Neuauflagen konzipiert.
Als Idee dieses Lehrbuchs zieht sich die Systematisierung des psychodynamischen Zugangs zur Psychopathologie durch alle Auflagen. Sie beruht auf den drei Säulen reaktive, neurotische und posttraumatische Störungen, wobei die neurotische Pathologie anhand der Kategorien der Strukturdiagnostik weiter aufgeschlüsselt wird. Daraus ergibt sich ein differenzieller psychodynamischer Behandlungsansatz mit den Polen einer einsichtsorientierten und einer erfahrungsorientierten Behandlungsstrategie. Diese Systemtisierung stellt eine Brücke her zu Ergebnissen der Säuglings- und Bindungsforschung sowie der Gedächtnis- und Hirnforschung der letzten Jahrzehnte.
Für die 7. Auflage wurde das gesamte Buch gründlich überarbeitet und aktualisiert. Aufgrund der internationalen Entwicklung und meiner persönlichen Orientierung wurde dabei der intersubjektive Ansatz weiter ausgearbeitet. Damit erhält auch der wachstumsfördernde implizite Behandlungsansatz immer stärkeres Gewicht.3 Phänomene wie die Entwicklung des Selbst oder die Gestaltung der therapeutischen Beziehung erscheinen uns heute als intersubjektive Prozesse in einer neuen Perspektive.
Dieses Buch ist von der Überzeugung getragen, dass das psychoanalytische Denken einen unvergleichlichen Zugang zum Menschen in Gesundheit und Krankheit, zu seinem hintergründigen Erleben, seinen Beziehungen, seiner Sozialisierung und seinen kulturellen Schöpfungen eröffnet. Mit der aktualisierten Neuauflage verbinde ich den Wunsch, dass es dazu beiträgt, dieses Denken auf einer soliden modernen Grundlage für die Annäherung an unsere Patienten zu erhalten. Es soll ein Beitrag für die Sicherung unseres Faches in der Zukunft sein. Dabei denke ich vor allem an die Herausforderungen, die das Fach in der anstehenden Umstrukturierung der Ausbildung psychologischer Psychotherapeuten zu bewältigen hat.
Die Unterstützung der Helfer und Berater bei den früheren Auflagen ist nach wie vor unvergessen. Mein Dank gilt auch wieder dem Kohlhammer-Verlag, der die Entwicklung dieses Lehrbuchs weiter mit Engagement und Interesse begleitet. Ganz besonders danke ich meinem Partner Werner J. Stauten. Er hat die Arbeit an der Neuauflage mit Sorgfalt, viel Geduld und Sachverstand mit getragen.
Berlin, im Frühjahr 2020
Michael Ermann
Aus dem Vorwort zur ersten Auflage (1994)
Die Psychotherapie, und mit ihr die Psychosomatische Medizin, stand in Deutschland Anfang der 1990er Jahre mit der Einführung eines ärztlichen Fachgebietes »Psychotherapeutische Medizin« in einer neuen Phase der Institutionalisierung. Es besteht seither die Möglichkeit, dass Ärzte, die hauptsächlich Psychotherapie betreiben wollen, nach ihrer Ausbildung als Fachärzte tätig werden können. Sie wurden damit anderen Fachärzten gleichgestellt.
Diese Neuregelung war vor allem im Kreise der Psychoanalytiker, die einen großen Teil der Psychotherapeuten ausmachen, umstritten, weil weitgehende Veränderungen der Ausbildungsstrukturen und der Ausbildungsinhalte an die neue Regelung geknüpft wurden. Ähnliches wird für die nächsten Jahre von einem sog. Psychotherapeutengesetz erwartet, das auch die psychotherapeutische Tätigkeit von Diplompsychologen in Deutschland regeln soll.
So problematisch diese Veränderungen einerseits sind, der Psychotherapie und Psychosomatik haben sie im Medizinalsystem ein größeres Gewicht gegeben. Auch das Studienfach »Psychosomatische Medizin und Psychotherapie«, das vor 25 Jahren in die Ausbildung der Medizinstudenten eingeführt wurde, hat damit größeren Einfluss erhalten.
Ob es angesichts einer besseren, auch wirtschaftlich vorteilhafteren Institutionalisierung allerdings gelingt, den hohen wissenschaftlichen Standard der bisherigen Psychotherapie und Psychosomatik aufrechtzuerhalten, hängt vorrangig von der Qualität, daneben natürlich auch von der Struktur der Ausbildung ab. Damit hat die Ausbildung von Medizinern und Psychologen während und nach dem Universitätsstudium eine Neubewertung erfahren.
Für mich als Hochschullehrer und als Beteiligter an der Psychotherapieausbildung war das eine Herausforderung und war Anlass dafür, unser heutiges klinisches Wissen und den Stand unserer psychotherapeutischen Erfahrungen in einem Leitfaden für das Studium und die spätere Weiterbildung zusammenzutragen.
Zum Konzept dieses Buches
Der Darstellung liegt ein psychoanalytisch orientierter Ansatz zugrunde, der die Beziehungserfahrungen des Menschen in das Zentrum der Betrachtung rückt und mit trieb-, ich- und selbstpsychologischen Aspekten verknüpft. Er kann als weithin repräsentativ für das heutige psychoanalytische Denken gelten. Innerhalb dieses Ansatzes wird ein entwicklungsdynamisches Strukturmodell zugrunde gelegt. Daneben werden reaktive Störungen und chronische posttraumatische Störungen als besondere Störungsformen betrachtet.
Neben diesem psychoanalytischen Ansatz werden bei der Darstellung allgemeine psychotherapeutische und psychosomatische Basisinformationen vermittelt. Zusätzlich werden grundsätzliche verhaltenstherapeutische Aspekte erörtert.4
Zur Lektüre dieses Buches
Dieses Buch gliedert sich in die Teile Grundlagen, Diagnostik, Krankheitsbilder und Behandlung. Als Basis für das Verständnis ist das Kapitel 3 über die Neurosenentstehung gedacht. Weil immer wieder auf die Grundformen der psychogenen Pathologie Bezug genommen wird, empfiehlt es sich, vor dem Studium spezieller Fragen auf jeden Fall auch das Kapitel 4 durchzuarbeiten. Im Übrigen sind die einzelnen Kapitel so gestaltet, dass sie unabhängig voneinander gelesen werden können.
Die Literaturverweise in den Fußnoten enthalten einerseits Grundsatzarbeiten zu zentralen Konzepten; hier kann die Auswahl angesichts der Fülle der Literatur nur willkürlich sein. Wo verfügbar, wurden deutschsprachige und leicht erreichbare Arbeiten angegeben. Andererseits werden einige zentrale Begriffe durch Hinweise auf die Erstbeschreiber oder wichtige Neuformulierungen belegt. Bei Begriffen und Konzepten, die heute zum »allgemeinen Wissensstand« unseres Fachs gehören, wurde auf solche Hinweise verzichtet, um das Literaturverzeichnis überschaubar zu halten.
1 Wenn im Folgenden bei der Nennung von Personen im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit des Textes lediglich die Form des generischen Maskulinums verwandt wird, sind stets alle Geschlechter gemeint.
2 Ermann u. a. (2006)
3 Ermann (2014)
4 Die Idee, in diesem Buch auch grundlegende Informationen über die Verhaltenstherapie als zweite führende Methode in der Versorgung zu vermitteln, hat sich nicht bewährt. Ich habe mich anlässlich der 6. Auflage daher entschlossen, auf das Kapitel über die Verhaltenstherapie zu verzichten, und mich bei einzelnen Themen auf kurze Hinweise zur verhaltenstherapeutischen Sichtweise beschränkt. Im Übrigen sei auf die inzwischen vorliegende große Zahl hervorragender Einführungen in die Verhaltenstherapie verwiesen.