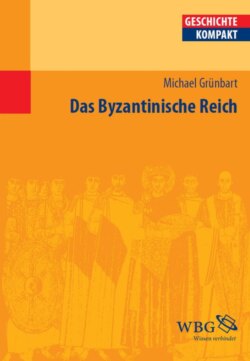Читать книгу Das Byzantinische Reich - Michael Grünbart - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E
ОглавлениеTetrarchie Diocletian (284–305) wollte den chaotischen Zuständen seiner Vorgänger und den raschen Kaiserwechseln ein Ende bereiten. Da er keinen leiblichen Sohn als Nachfolger hatte, bestimmte er den fast gleichaltrigen Offizier Maximianus zunächst zum caesar, dann zum augustus. Zum 1. März 293 wurden den beiden älteren augusti zwei jüngere caesares beigestellt, denen die augusti nach einer bestimmten Zeit ihre Positionen überließen. Die vier Machthaber bekamen informell vier Kompetenzbereiche zugewiesen, jeweils zwei im Westen und im Osten, wo sie auch ihre Residenzen errichteten (Mailand, Trier, York, Thessalonike, Sirmium und Nikomedeia). Rom büßte seine realpolitische Funktion ein, da eine zentralisiert gesteuerte Regierung des Imperiums nicht mehr möglich war. Prinzipien der Tetrarchie waren der Ausschluss der leiblichen Söhne von der Herrschaftsfolge, die theokratische Ideologie und die Freiwilligkeit der Amtsübergabe. Die Tetrarchen regierten als Stellvertreter der Götter Iuppiter und Hercules. Jeglicher Umsturzversuch galt demnach als Sakrileg.
Galerius, augustus des Ostens, tolerierte Konstantinos nur als caesar. Im selben Jahr wurde in Rom Maxentius, der Sohn des Maximianus, öffentlich zum Kaiser ausgerufen. Der Akt des Ausrufen eines Kaisers, die acclamatio, blieb über Jahrhunderte das wichtigste Element für einen Herrschaftsantritt, fehlte diese, dann stand die Legitimation eines Thronanwärters auf tönernen Füßen. Maxentius versuchte, der Stadt Rom wieder Glanz zu verleihen, die Stadt war ins Hintertreffen geraten, da Diocletian Nikomedeia (İzmit) zu seinem Stützpunkt bestimmt hatte und mit entsprechenden Bauten (Hippodrom, Palast, dazu Waffenschmieden und eine Münzstätte) ausstatten ließ. Um die Spannungen innerhalb der Tetrarchie beizulegen, traf man sich 308 in Carnuntum bei Wien, eine Tetrarchie kurzer Dauer wurde eingerichtet: Galerius regierte mit Maximinus Daia im Osten und Licinius mit Konstantinos im Westen. Der abgedankte Maximianus usurpierte wieder den Kaisertitel, Konstantinos konnte ihn in Massilia (Marseille) in den Selbstmord treiben (310). Über ihn wurde die damnatio memoriae verhängt, d.h. sein Name wurde von allen Kaiserbildern und Inschriften getilgt. 311 starb Galerius in Serdica (Sofia), wodurch die Tetrarchie zu Ende ging. Noch kurz vor seinem Tod hatte Galerius ein Edikt zur Duldung der Christen herausgegeben. Das Christentum wurde als religio licita („geduldete Religion“) eingestuft. Das Machtvakuum auf der südlichen Balkanhalbinsel füllten Licinius und Maximinus Daia aus, als Grenzzone zwischen ihren Verwaltungsgebieten bestimmten sie das Marmarameer. In der Folge kam es zu einer Annäherung zwischen Maxentius und Maximinus Daia sowie Konstantinos und Licinius.
Schlacht an der Milvischen Brücke
Der Auslöser für die folgenreiche und legendäre Schlacht an der Milvischen Brücke (28. Oktober 312) ist darin zu suchen, dass Maxentius Konstantinos des Vatermordes bezichtigte, seinen Vater Maximinian unter die Götter erheben (Apotheose) und daraufhin Statuen des Konstantinos in Rom stürzen ließ. Dadurch provoziert machte sich Konstantinos nach Rom auf, in dessen Nähe er Maxentius, wie es dann erklärt wurde, mit göttlichem Beistand überwinden konnte. Die Schlacht wurde später zu einer Götterschlacht (Theomachie) stilisiert, die Konstantinos im Zeichen des Kreuzes für sich entschied. Die Soldaten Konstantinos’ hatten auf ihren Schilden das Christogramm (Chi-Rho, die ersten beiden Buchstaben des Namens Christi) angebracht. Er zog triumphal in Rom ein, verzichtete aber auf einen Besuch des Kapitols, wo die kapitolinische Trias (Iuppiter, Iuno und Minerva) verehrt wurde. Konstantinos ließ sich vom Senat einen Ehrenbogen sponsern und den Titel des Rangältesten augustus übertragen, was gegen Licinius gerichtet war. Auf dem aus Spolien (bewusst ausgewähltes Bruchmaterial aus älteren Bauten) errichteten Triumphbogen wurde der Sieg Konstantinos über einen anonymen Tyrannen (= Maxentius) dargestellt. Der Erfolg sei instinctu divinitatis („durch den Wink der Gottheit“) errungen worden. Diese Formulierung erlaubte allen religiösen Lagern, das Denkmal zu akzeptieren. Konstantinos tolerierte zu dieser Zeit zwar schon das Christentum, aber er war noch lange kein aktiver Unterstützer.
Konstantinos und Licinius
Mit Licinius musste er sich über die Kompetenzaufteilung verständigen, da mit dem Ausfall eines Tetrarchen das Gleichgewicht wiederhergestellt werden musste. 313 einigte man sich in Mailand, dass Konstantinos als der senior augustus angesehen werden durfte. Es wurde vereinbart („Mailänder Edikt“), dass der Christenverein (corpus Christianorum) fortan geduldet und verfolgte Christen entschädigt werden würden. Licinius wurde das Territorium des Maximinus Daia, der mit Maxentius zusammengearbeitet hatte und nach der Schlacht bei Heraclea Pontica aus nicht ganz geklärten Umständen in Tarsos im August 313 zu Tode kam, von Kleinasien bis nach Ägypten zugesprochen. Damit war aus einem Herrscherviergespann ein Doppelkaisertum geworden, denn weder Licinius noch Konstantinos kümmerten sich um die Einbindung jüngerer Kollegen. Konstantinos dürfte früh über eine Alleinherrschaft, eine Monarchie, nachgedacht haben. Spannungen traten 316 offen zum Vorschein: Licinius ließ Bildnisse Konstantinos’ in den von ihm kontrollierten Gebieten zerstören; dieser marschierte daraufhin gegen Osten und besiegte die Truppen Licinius’ in Sirmium und Adrianopel. Im Zuge des Waffenstillstands wurden Licinius Thrakien, Moesien und Scythia Minor zugesprochen. Konstantinos wählte Sirmium als Basis für Expeditionen Richtung Donaugebiete, wodurch er zwangsläufig in das Gehege Licinius’ kam. 317 setzte Konstantinos eigenmächtig drei Caesares (Crispus und Konstantinos II., zwei Söhne von ihm, und Licinianus, Sohn Licinius’) ein. Licinius begann, gegen die Vereinbarung von Mailand ab 320 Güter von christlichen Funktionären zu konfiszieren. Konstantinos hatte nun einen Vorwand. Er zog, Licinius brüskierend, gegen die Sarmaten, ein Steppenvolk, das nördlich des Schwarzen Meeres siedelte und sich dem Römischen Reich feindlich annäherte. Nach erfolgreicher Zurückdrängung ließ Konstantinos 323 seinen Sieg durch Goldprägungen feiern, wodurch die Schwäche des Licinius deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. Als Reaktion ließ der Gedemütigte die Münzen einschmelzen, was einer Majestätsbeleidigung gleichkam. Konstantinos marschierte daraufhin von Thessalonike nach Adrianopel, wo sich Licinius verschanzt hatte (324). Konstantinos führte hier zum ersten Mal sein neues Feldzeichen, das Labarum, mit.
Labarum
Das Labarum war eine Standarte, die von einem Christusmonogramm (Chi-Rho) bekrönt war (beschrieben bei Eusebius, Vita Constantini, XXXI). Licinius zog sich über Byzantion nach Chrysopolis zurück, wo er aufgegriffen wurde. Die Flotte Licinius’ wurde von Konstantinos’ Sohn Crispus vernichtet, Licinius wurde zunächst in Thessalonike inhaftiert, ein Jahr später aber getötet, da seine angebliche Rückkehr bei Soldaten Tumulte ausgelöst hatte. Licinius verfiel der damnatio memoriae und aus einer Zweierherrschaft war nun eine Monarchie geworden. Am 3. Juli 325 feierte Konstantinos sein 20-jähriges Regierungsjubiläum in Nikomedeia (Vicennalia), welche Stadt zu diesem Zeitpunkt noch die bedeutendste in dieser Region war, im nächsten Jahr wiederholte er das Fest in Rom. Nach der Ausschaltung seines Gegners kam es innerhalb der Familie Konstantinos’ zu dramatischen Ereignissen. Auf Anstiften seiner zweiten Frau Fausta ließ er Crispus in Pola durch Gift beseitigen. Fausta selbst ließ er in einem Bad ersticken, weitere Verwandte (sein Neffe Licinianus und seine Schwester Constantia) wurden ebenfalls getötet. Möglicherweise fürchtete Konstantinos zu starke Konkurrenz seitens seines Sohnes oder vielleicht störte ihn der Lebenswandel Faustas. Später wurde gemutmaßt, dass Konstantinos sich durch diese Taten zum Christentum bekehren ließ, da heidnische Vorstellungen solches nicht reinigten.
Konstantinopel
„Rom ist, wo immer der Kaiser ist“, formulierte schon um 240 der römische Geschichtsschreiber Herodianus, diesem Motto entsprechend richteten sich alle augusti und caesares Residenzen ähnlich wie am Tiber ein. Wahrscheinlich bereits 324 wurde die Stadt in antiker Tradition „gegründet“ und nach dem Herrscher benannt. Angeblich war auch an Troia, Serdica, Chalkedon oder Thessalonike gedacht, doch gaben die geopolitischen Vorteile (Kreuzungspunkt zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer sowie zwischen Kleinasien und dem südlichen Balkanraum) des historisch eher unbedeutenden Byzantion den Ausschlag. Die Siedlung wies einen sicheren natürlichen Hafen („Goldenes Horn“) auf. Zudem konnte von Konstantinopel aus die Donaugrenze und das Sassanidenreich im Osten relativ rasch erreicht werden.