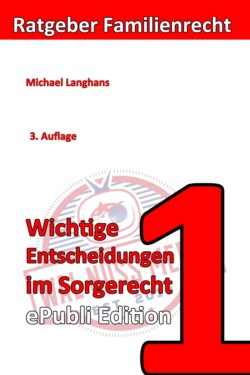Читать книгу Wichtige Entscheidungen im Sorgerecht ePubliEdition - Michael Langhans - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2. Rechtliche Grundlagen
ОглавлениеRechtliche Grundlagen finden sich im Grundgesetz (GG), der UN Kinderrechtskonvention (Übereinkommen über die Rechte des Kindes), der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über Verfahren in Familiensachen (FamFG) und auch dem SGB VIII (Jugendhilferecht). Bei Behinderungen ist ggf. noch auf die UN Behindertenkonvention abzustellen.
Nur wenigen Paragraphen und Normen regeln, ob und wie der Staat in Familien eingreift. Eigentlich also ein überschaubarer Rechtsbereich, der einfach zu handeln wäre.
Wenn die einfach gesetzlichen Regeln oftmals wenig aussagekräftig sind, finden sich Erklärungen und Erläuterungen oft in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts.
Während also die einfach gesetzlichen Regelungen und das Grundgesetz durch ihre Allgemeinheit dem Richter eine Möglichkeit an die Hand geben, viele Möglichkeiten der Interpretation zuzulassen, grenzen diese genannte Rechtsprechung den Richter wieder erheblich ein, weshalb dieses Buch sich hauptsächlich mit dieser entscheidenden Rechtsprechung auseinandersetzt. Das ändert aber nichts daran, dass zur Rechtsanwendung auch der relevante Gesetzestext gekannt werden muss:
Art 6 GG:
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
Art. 6 des Grundgesetzes ist die Grundlage aller anderen Regelungen der elterlichen Sorge. Auf ihn muss jede Gesetzesanwendung und jede einfach gesetzliche Regelung zurückzuführen sein. Jede Regelung oder Entscheidung, die Familie nicht besonders schützt und insbesondere nicht den Eltern das natürliche Recht auf Pflege und Erziehung zugebilligt, ist verfassungswidrig. Es heißt natürlich nicht, dass diese Rechte schrankenlos zugebilligt würden. Dies heißt aber, dass der Regelfall davon ausgeht, dass Eltern Kinder erziehen und hierzu auch in der Lage sind. Weil die Gemeinschaft hier überwacht, kann man hieraus schließen dass nur bei Verstößen gegen diese Erziehung der Kinder zu deren Wohl den Staat zum Handeln legitimiert.
Weiter erfolgt die Ausgestaltung dieser verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere im bürgerlichen Gesetzbuch.
§1626 BGB
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.
(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.
§1631 BGB
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.
§1666 BGB
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.
(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
3.Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,
4.Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen,
5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen.
§ 1666 BGB ist überschrieben mit „gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls". Hierin geregelt wird also, unter welchen Voraussetzungen ein Gericht tätig werden darf.
Wichtig ist, dass nach einhelliger Rechtsauffassung diese Eingriffsnorm nur bei Verfehlungen der Eltern relevant wird, nicht wenn der Staat selbst z. B. durch einen Ergänzungspfleger identische Fehler begeht. Zwar könnte man Maßnahmen mit Wirkung gegen Dritte auch so auslegen, dass Dritter im Sinne dieser Situation auch der Staat sein kann. Die bisherige Rechtsprechung geht aber davon aus, dass Eingriffe gegen Stadt nicht notwendig sind und daher expressis verbis über diesen Paragraphen auch nicht zulässig sind. Relevant sind die Merkmale der Unmöglichkeit der Eltern, die Gefahr für ein Kind abzuwenden, was die Eingriffsmöglichkeiten auf Fälle beschränkt, in denen die Eltern nicht identischen Maßnahmen des Gerichts treffen möchten. Das Gericht darf auch nur dasjenige ausüben, was zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist, also nur das was möglich ist, was den geringstmöglichen Eingriff darstellt, wie Juristen sagen, verhältnismäßig ist. Verhältnismäßig ist all das, was das bestehende Problem beseitigt und dabei den am wenigsten starken Eingriff darstellt. Die Verhältnismäßigkeit ist aber gesondert in § 1666A BGB geregelt.
§1666a BGB
(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist.
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen.
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit sind dabei nicht Synonym. Erforderlich ist jede Maßnahme, deren Problem beseitigt. Verhältnismäßig ist nur diejenige, die den geringstmöglichen Eingriff darstellt.
Diese Paragraphen sind diejenigen, die in Sorgerechtsstreitigkeiten am häufigsten eine Rolle spielen. Nachdem dieses eine einfache Handreichung für alltägliche Probleme darstellen soll, verzichte ich auf eine weiterführende Kommentierung. Diese ist den gängigen juristischen Kommentaren des bürgerlichen Gesetzbuches und der Nebengesetze vorbehalten. Ich möchte, auch um den richterlichen Spielraum einzuschränken, mit diesem Werk gerade nur dasjenige ansprechen, was sich unmittelbar aus höchstrichterlicher Rechtsprechung ergibt. Dabei wäre es kontraproduktiv, Auslegungsdiskussionen mit dem Gericht zuführen. Leider ist dem Zeitpunkt dieser Formulierung der kostenfrei zugängliche öffentliche BGB Kommentar im Sorgerechtsbereich noch unzureichend gefüllt, kann sie aber im Bedarfsfall lohnen dort nachzuschlagen - https://bgb.kommentar.de/.