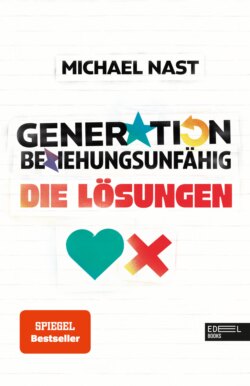Читать книгу Generation Beziehungsunfähig. Die Lösungen - Michael Nast - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Konsumenten der Liebe »Tinder für Hässliche«
ОглавлениеIch habe mich oft gefragt, warum ich Dating-Apps gegenüber so voreingenommen bin. Bisher nahm ich an, mich würden die üblichen Klischees stören, das ewige Chatten, bevor man miteinander telefoniert oder sich trifft, die unrealistischen Profilbilder oder die Psychopathen und Sexsüchtigen, von denen mir meine Freundinnen immer mal wieder erzählen, wenn sie mir von ihren Dating-App-Erfahrungen berichten. Aber daran liegt es gar nicht. Es ist eher ein Grundgefühl, das ich bisher nicht in Worte fassen konnte. Seitdem ich mich vor einiger Zeit mit drei Freunden in der Goldfisch Bar in Friedrichshain getroffen habe, kann ich es.
Es ist ja so: Wenn man sich heutzutage mit Freunden trifft, gibt es immer mal diese Momente, in denen einer sein Handy aus der Tasche holt, was dazu führt, dass auch alle anderen ihre Handys herausholen, um sich dann letztlich schweigend gegenüberzusitzen. Ich versuche immer, solchen schweigsamen Momenten aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, nur wenn ich mich zu zweit treffe und der oder die andere kurz auf die Toilette muss, habe ich sofort mein Handy in der Hand. Es ist wie ein Reflex, und es ist einer dieser Augenblicke, in denen ich begreife, wie abhängig ich bin.
Und auch am Dienstagabend holte irgendwann einer von uns sein Handy heraus. Wir saßen an dem langen Tresen und schwiegen inzwischen schon seit acht Minuten. Philipp, der neben mir saß, überprüfte, welche Neuigkeiten es auf seinen Dating-Apps so gab. Er nutzte drei: Tinder, OkCupid und eine App namens Jaumo, von der ich bisher noch nie etwas gehört hatte.
»Jaumo?«, fragte ich.
»Also: Das ist praktisch Tinder für Hässliche«, fasste Philipp sein Jaumo-Nutzererlebnis zusammen. »Eher was für die originelle Phase.«
»Aha«, erwiderte ich mit einem irritierten Blick.
Und dann – genau in diesem Moment – passierte es. Ich hatte ein Déjà-vu. Zumindest hielt ich es anfangs dafür, aber ich stellte schnell fest, dass es gar kein Déjà-vu war. Es waren nur zwei Bilder, die sich sehr ähnlich waren.
Während Phillips Finger über das Display seines Handys glitten und er mir hin und wieder Fotos von attraktiven oder bei Jaumo eben sehr unattraktiven Frauen zeigte, fiel mir auf, wie sehr er mich an meine Freundin Magda erinnerte.
Philipp bewegt sich auf Dating-Apps, wie Magda sich auf den Onlineshops von Mango, Zara und H&M bewegt, wenn sie einkauft. Auch ihre Finger bewegen sich mit beeindruckender Geschwindigkeit, auch sie scannt Listen mit Produkten ab, und auch sie zeigt mir Teile, die ihr gefallen, Kleidungsstücke, zwischen denen sie sich nicht entscheiden kann, und Teile, die eine Zumutung sind. Diese Ähnlichkeit war mir bisher gar nicht so aufgefallen. Beide konsumieren, dachte ich. Magda Kleidung und Philipp eben Menschen, und das war der Moment, in dem mir unser eigentliches Dilemma klar wurde.
Es ist schon beunruhigend, wie sehr Dating-Apps an Onlineshops erinnern. Die Struktur ist ähnlich. Die Mechanismen, die in unserem Kopf stattfinden, sind dieselben. So gesehen geben wir bei der Partnerwahl den gleichen Impulsen nach wie beim Produktkauf. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit es uns beeinflusst, wenn wir Menschen nach ähnlichen Prinzipien auswählen, nach denen wir auch Produkte kaufen. Ob es uns auch zu Verbrauchern macht, wenn es um Liebesbeziehungen geht? Ob wir zu Konsumenten der Liebe geworden sind?
Ich fange mal mit mir an.
Wenn ich ganz ehrlich bin, scheint mein Liebesleben der vergangenen Jahre diese These zu bestätigen. Mir fällt auf, wie sehr es einem Zalando-Bestellvorgang ähnelt. Bei Zalando kann man Produkte bestellen, anprobieren und dann zurückschicken, wenn sie einem nicht gefallen. Genauso bin ich oft mit Frauen umgegangen, und genauso gingen auch nicht wenige Frauen mit mir um. Mein Liebesleben ist unverbindlicher geworden. Und auch wenn ich es mit meiner Haltung vergleiche, mit der ich Produkte konsumiere, die ich nicht zurückgeschickt habe, entdecke ich beunruhigende Parallelen.
Viele kaufen Kleidungsstücke heutzutage nicht, damit sie ein Leben lang halten. Man setzt voraus, dass ihre Qualität mit der Zeit nachlässt oder sie irgendwann aus der Mode gekommen sind. Wenn ich sie kaufe, bezahle ich sie schon in dem Bewusstsein, sie zu ersetzen. Obwohl meine Kleidung teilweise so teuer ist, dass Freunde mit unkontrollierten, verständnislosen Lauten reagieren, wenn ich ihnen widerwillig die Preise verrate, zeigen meine Erfahrungen, dass meine Jacketts, T-Shirts und Schuhe schon nach zwei oder drei Jahren ersetzt werden müssen – wenn es gut läuft. Meistens läuft es allerdings schlecht.
Ähnlich geht es mir bei Dates.
Wenn ich Frauen date, geht etwas in mir schon instinktiv davon aus, dass die Beziehung nicht lange halten wird. Während des Dates nehme ich das gar nicht so wahr, aber die Überzeugung ist da. Und auch sie ist aus meinen Erfahrungen entstanden. Jede Frau, mit der es nicht funktioniert hat, ist ein weiterer Beweis, der diese Überzeugung bestätigt. Aus der Summe meiner vergangenen Erfahrungen schließe ich auf die Erfahrungen meiner Zukunft. Ich gehe von einer Trennung aus. Obwohl ich mich nach einer Beziehung sehne, die lange Bestand hat, geht etwas in mir bereits beim ersten Date davon aus, dass ich sie ersetzen werde. Wie ein Kleidungsstück in der nächsten Saison.
Scheiße!, dachte ich. Offensichtlich hatte ich ein Konsumproblem. Und zwar in der Liebe. Schon nach dem ersten flüchtigen Blick war mein Liebesleben voller Beweise für diese These.
Die Frage war jetzt allerdings, ob ich überhaupt tiefer schürfen wollte. Ob das den Blick auf meine Liebesbeziehungen entstellen würde. Oder auf meine Gefühle. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte mir den Zauber bewahren. Aber offensichtlich steckte ich ja fest. In einem endlosen Kreis, den ich in keiner meiner Beziehungen verließ, bis sie zu einer Folge von Wiederholungen geworden waren. Ich fing immer wieder neu an, um mit jeder Frau an denselben Endpunkt zu gelangen. Variabel war nur der Zeitraum, den wir miteinander verbrachten, bevor einer von uns absprang.
Der Konsument in mir
Man sagt ja, dass uns Algorithmen inzwischen besser kennen als wir uns selbst. Das ist ein Gedanke, der mich beunruhigt. Aber es ist auch eine interessante Frage, wie viel die Daten, die ich permanent von mir preisgebe, eigentlich über mich erzählen. Inwieweit meine Bewegungsprofile, Browserverläufe und Einkäufe auf irgendwelchen Servern Diagramme entstehen lassen, aus denen man herauslesen kann, wer ich wirklich bin. Inwieweit diese Diagramme meine wahre Identität abbilden, besser, als ich sie jemals einschätzen kann.
Aber dann fällt mir mein Denkfehler auf, denn die Algorithmen analysieren ja nicht meine Persönlichkeit als Mensch, sie bewerten meine Identität als Konsument. Sie durchleuchten, inwiefern ich als Verbraucher funktioniere. Sie sollen herausfinden, welche Produkte ich kaufen würde und wie ich am besten davon zu überzeugen bin, dass ich sie kaufe. Jedes ProductPlacement in einem Film, jeder Werbespot, jede Anzeige, jedes Foto und Video eines Influencers ist darauf ausgerichtet, den Konsumenten in mir anzusprechen.
Die Frage ist, inwieweit diese Einflüsse unser Bewusstsein bestimmen.
»Der Verbraucher ist vielleicht die zentrale Sozialfigur der westlichen Gegenwart«, schreibt die Zeit. Von Geburt an werden wir darauf konditioniert, zu konsumieren. Wir bewegen uns in einem Wertesystem, das auf der Annahme beruht, dass Konsum den Menschen glücklich macht und uns erfüllt. Unsere Antriebe und Wünsche, unser Denken und Fühlen sind von der Überzeugung durchdrungen, dass uns nur Konsum ein Gefühl von Lebendigkeit gibt. Auch mir geht es um neue Reize. Sie vermitteln mir das Gefühl zu leben. Ich verstehe unter Lebensqualität eine Folge von Momenten, die mein Belohnungssystem aktivieren, weil sie mich bestätigen oder befriedigen. Durch den Konsum von Produkten, Dates, Partys und Konzerten, Sex, Alkohol, Netflix-Serien und Matches.
Ich saß auf meiner Couch, meinen Laptop vor mir. Genau genommen musste ich sogar herausfinden, inwieweit der Konsument in mir beeinflusste, wie ich dachte, wie ich mich verhielt und wie ich reagierte. Das verstand ich jetzt. Ich musste herausfinden, inwieweit der Konsument in mir meine Identität ausmachte. Wie weit er sich ausgebreitet hatte, inwieweit er sie bestimmte. Vielleicht legte genau das den Punkt frei, an dem ich ansetzen konnte, um wirklich etwas zu ändern. Um den Kreis, in dem ich mich seit Jahren bewegte, aufzubrechen und zu verlassen.
Ich klappte meinen Laptop zu, stand auf und ging in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen. Während der Wasserkocher rauschte, sah ich aus dem Fenster und beobachtete die Passanten auf der Promenade fünf Stockwerke unter mir. Der Weg vor meinem Haus war voller junger Menschen, und ich fragte mich, wie viele von ihnen Single waren. Wie viele von ihnen Tinder nutzten. Und dann fragte ich mich, wie viele der Frauen da unten ich schon auf Tinder gesehen hatte. Wie viele ich weggewischt hatte und wie viele von ihnen mich.
In der Überflussgesellschaft der Liebe
Der Vorteil von Dating-Apps ist ja, dass man über sie Menschen kennenlernen kann, denen man in seinem Alltag nie begegnet wäre. Dieser Vorteil kann allerdings zu einem großen Nachteil werden. Dating-Apps machen mir nämlich auch klar, wie groß der Pool potenzieller Partner ist. Und je größer dieser Pool ist, aus dem man wählen kann, desto mehr verliert die einzelne Person in ihm an Bedeutung.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass ich sehr wählerisch bin, während ich diesen Pool durchforste. Meistens wähle ich aus – sagen wir mal – hundert Profilen nur eine, in Ausnahmefällen auch mal zwei Frauen aus, die mir gefallen. Für einen Mann ist das eher ungewöhnlich. Die meisten Männer, die ich kenne, haben da vollkommen andere Quoten.
Am Wochenende hat mir zum Beispiel ein Bekannter erzählt, dass er einfach mal hundert Frauen bei Tinder gelikt hat und jetzt mal guckt, was so passiert.
Das ist dann das Endstadium, dachte ich. Wahllos hundert Frauen bei Tinder zu kontaktieren – das ist ja schon eine Discountermentalität. Mein Bekannter stellt Quantität über Qualität. Mit der Suche nach Liebe hat das nichts mehr zu tun. Sein Konsumverhalten orientiert sich wohl eher an den Möglichkeiten und weniger an der Notwendigkeit.
Wenn man die Konsumgesellschaftsschablone auf sein Liebesleben legt, entdeckt man beunruhigende Parallelen. Er empfindet jede Frau als Substitutionsgut für die andere. Bei Wikipedia steht: »Als Substitutionsgüter bezeichnet man Güter, die dieselben oder ähnliche Bedürfnisse stillen und daher vom Konsumenten als gleichwertiges Ersatzgut angesehen werden.«
Frauen sind für meinen Bekannten austauschbar, ob er es sich eingesteht oder nicht, er empfindet sie schon bei der Suche als ersetzbar. Der Wert einer einzelnen Person verschwindet in der Masse. Der Konsument hat die Kontrolle übernommen.
Wenn man so will, entspricht mein Konsumverhalten dem Gegenteil. Ich wische eher nach links. Wenn ich auf Tinder die Profile in immer höherer Geschwindigkeit nach links wische, spüre ich allerdings schon die Auswirkungen. Ich spüre die Übersättigung. Es ist ein Profilfoto-Overkill, der mich abstumpft. Die vielen Gesichter beginnen miteinander zu verschwimmen. Obwohl ich weiter unzählige Frauen nach links wische, schalte ich ab.
Wenn ich bei einem Serienmarathon zu viele Folgen sehe, entsteht ein ähnlicher Effekt. Auch wenn ich die Serie mag, beginne ich irgendwann abzustumpfen. Mit jeder neuen Folge berührt mich der Inhalt weniger. Darum kann ich mich über etwas freuen, was viele als Nachteil empfinden: Wenn sich die Streamingdienste entscheiden, bei neuen Staffeln von Serien immer nur eine Folge pro Woche zu veröffentlichen. Ich sehe die einzelnen Episoden dann viel bewusster. Ich genieße sie. Hätte ich sie in einem zehnstündigen Serienmarathon gesehen, wäre sie irgendwann Teil eines mehrstündigen Grundrauschens geworden. Ein Grundrauschen, in dem die Folgen mit der Zeit verschwimmen und die Grenze zwischen wichtig und unwichtig unkenntlich wird. Ich übersehe wichtige Szenen, weil sie in der Masse bedeutungslos geworden sind. Genauso geht es mir bei Tinder.
Es kommt nicht selten vor, dass meine Wischgeschwindigkeit bei Tinder so hoch ist, dass ich die Fotos von Frauen, die mir gefallen, aus Versehen ebenfalls ablehne. Ich registriere das meistens erst, wenn ich schon zwei Profile weiter bin. Ich habe den Rhythmus so sehr verinnerlicht, dass er zur Routine geworden ist. Und Routine lässt einen die Dinge übersehen, auf die es ankommt.
Ich befürchte, ich bin da kein Einzelfall, denn in der Bezahltversion der App ist es möglich, ein Profil zurückzuwischen, das sonst unwiederbringlich verloren wäre. Wenn eine solche Funktion so wertvoll ist, dass sich Tinder ihre Freischaltung bezahlen lässt, bin ich offensichtlich nicht allein.
Manchmal spüre ich sogar, dass mir durch diese Übersättigung das Gefühl dafür verloren geht, dass sich hinter den unzähligen Profilbildern wirkliche Menschen befinden. Ich bin nicht mehr in der Lage, die Identität der Personen hinter den Profilen wahrzunehmen. Sie sind zu Objekten geworden. Zu Katalogware.
Offensichtlich bin auch ich auf Shoppingtour.
Fast Food, Fast Fashion, Fast Love
Wir leben in einer Zeit, in der wir mehr Dates haben als jede Generation zuvor und in der sich mehr Menschen als je zuvor nach relativ kurzer Zeit sagen, dass es nicht passt, um dann mit anderen Partnern auszuprobieren, was mit dem vorherigen nicht geklappt hat. Ich glaube, dass diese Umstände etwas mit einem machen. Sie ändern die Ziele.
Einmal habe ich bei einem Essen in der Wohnung eines Freundes einen Mann namens Julian kennengelernt, der damit prahlte, mit zweihundert Frauen geschlafen zu haben.
»Zweihundert?«, fragte ich.
»Mindestens«, betonte er ernst. »Irgendwann hab ich aufgehört zu zählen. Ich hab da einfach nicht mehr durchgesehen.«
»Klar«, sagte ich und dachte konsterniert: Wie unsympathisch.
Julian sah mich abwartend an. Während wir schwiegen, mischte sich in seine Selbstzufriedenheit eine Spur Unsicherheit. Offensichtlich reagierte ich nicht so beeindruckt, wie er es erwartet hatte.
»Ich weiß ja auch nicht, woran es liegt«, fuhr er fort, um das Schweigen zu brechen. »Aber sobald ich mit einer Frau geschlafen habe, beginne ich schon, das Interesse zu verlieren. Wenns schlecht läuft, schon beim ersten Mal, wenns gut läuft, nach dem dritten oder vierten.«
»Dein eigentliches Element ist also eher die Eroberung«, sagte ich nach einer Pause.
»Vielleicht«, sagte er, als hätte ich ihn damit auf einen Gedanken gebracht. Wahrscheinlich würde er die Formulierung verwenden, wenn er dem Nächsten von seinen sexuellen Erfolgen erzählte. Ein Gedanke, der in mir einen leichten Brechreiz erzeugte.
Erst später habe ich begriffen, dass ich damals einem Prototyp gegenüberstand. Einem Prototyp, der erfolgreich das kapitalistische Prinzip unserer Wegwerfgesellschaft auf sein Liebesleben adaptiert hatte. Der Mann befand sich gewissermaßen in der Endphase. Sein Liebesleben war zu einer Art Fließbandproduktion geworden, bestimmt zu schnellem, effizientem und reichlichem Konsum.
Ihm ging es ausschließlich um die Anzahl, er verstand sich als Jäger und die Frauen waren seine Trophäen. Er hatte keine der Frauen kennengelernt, er hatte sie nur für eine Nacht besessen. Der Reiz, der ihn antrieb, bestand aus dem Erfolgserlebnis, sie davon überzeugt zu haben, mit ihm zu schlafen. Wenn der Reiz schwächer wurde und ihm nicht mehr die nötige Befriedigung verschaffte, wurden sie nutzlos für ihn. Der Reiz entstand erst durch eine neue Eroberung.
So sehr es mir auch widerstrebt, mich mit einem so unangenehmen Menschen wie ihm zu vergleichen, muss ich mir dann doch eingestehen, was mich eigentlich abstößt: Ich entdecke Ähnlichkeiten.
Dates als Routine
Vor einigen Jahren hatte ich ziemlich viele Dates. Genau genommen waren es sogar zu viele. Es waren Dates dabei, bei denen es zu keinem zweiten kam, Dates, die zu mehrwöchigen oder -monatigen Liebschaften führten. Aber mit den meisten hatte ich zwei- oder dreimal Sex, bevor wir wieder aus dem Leben des anderen verschwanden.
Irgendwann stellte ich jedoch etwas Beunruhigendes fest. Mit jedem neuen Date verlor sich das Gefühl ein wenig mehr, das ein Date zu etwas Besonderem machte. Sie wurden immer beliebiger. Jedes neue Date war eine Wiederauflage des vorherigen, eine Art Kopie. Sie unterschieden sich nur durch leichte Variationen voneinander. Sie fügten sich aus Routinen zusammen, bis sie selbst zu einer Routine geworden waren.
Und irgendwann spürte ich einen anderen Effekt, der mich beunruhigte: Wenn einem die Frauen, mit denen man sich trifft, mit jedem neuen Date immer weniger bedeutend erscheinen, wenn sie immer beliebiger und austauschbarer werden, weil sie ein Gesicht in einer Folge von Gesichtern werden, verschiebt sich etwas. Mein Ziel verlagerte sich. Obwohl ich mich mit den Frauen traf, weil ich mich nach einer Beziehung sehnte, hatte ich diese Sehnsucht ganz unbemerkt im Laufe unzähliger Dates ersetzt. Ohne dass ich es mir eingestand, ging ich gar nicht mehr davon aus, mit der Frau zusammenzukommen, die mir gerade gegenübersaß. Meine Sehnsucht nach einer Beziehung war durch die Suche nach Sex ersetzt worden. Ohne dass es mir auffiel, war ich zu einem Verbraucher geworden, zu einem Konsumenten der Liebe. Auch ohne eine Dating-App zu benutzen. Es funktionierte offensichtlich auch analog.
Ich habe mich auf dem Weg verfangen. Wie ein Konsument, der immer weiterkonsumiert, damit die Wirtschaft funktioniert. Es geht nicht um eine tiefe, nachhaltige Befriedigung, die die tiefgehende Liebesbeziehung auslöst, sondern um eine Aneinanderreihung vieler intensiver Kurzstrecken. Aber schnelle Reize, die keine tiefgehenden Erfahrungen auslösen, sind austauschbar, eine Wiederholung, um den Pegel zu halten.
Im Grunde genommen machte ich das Gleiche wie Julian. Ich gestand es mir nur nicht ein.
Die Illusion von Liebe
Am Ende meiner – nennen wir sie mal – maßlosen Datingphase hatte ich eine Liaison mit einer Frau, mit der ich nicht zusammenkommen wollte. Schon als wir uns nach unserem ersten Date wieder verabredeten, war mir klar, dass wir uns bereits im Trennungsprozess befanden, den wir mit jedem weiteren Treffen verlängern würden. Als wir uns zum zweiten Mal trafen, sagte ich Mia nach dem Sex, dass ich keine Zukunft mit ihr sah.
Das ist ein Geständnis, das gefährlich sein kann. Ich kenne Männer, die die Beziehung mit einer Frau monatelang aufrechterhalten können, obwohl sie nicht an ihr interessiert sind. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht allein sein können, oder daran, dass ihnen durch die Frau die Sicherheit gegeben wird, regelmäßig mit jemandem schlafen zu können. Mir ist so etwas fremd. Ich kann das nicht. Es hat etwas Scheinheiliges, ein Gefühl, das sich nicht richtig anfühlt.
Trotz dieses Gefühls mache ich solche Geständnisse erst, wenn ich mit einer Frau geschlafen habe. Ein seltsamer Zwiespalt, über den ich wohl mal nachdenken sollte.
Mia reagierte allerdings nicht so entschieden, wie ich es von Frauen erwarten würde, wenn man ihnen nach dem ersten Sex sagt, dass man eigentlich nicht interessiert ist. Ich stellte mich schon auf die Vorwürfe ein, mit denen mich Mia gleich überschütten würde, aber sie blieb vollkommen entspannt.
Sie wandte ein, dass wir ja beim Sex gut harmonierten, also könnten wir uns gern weiterhin sehen. Ich sah sie erstaunt an, während sie sich wieder sanft an mich schmiegte.
In dem Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins wird eine Regel benannt, die man befolgen sollte, wenn man sich nur trifft, um miteinander zu schlafen: Entweder zwischen den Treffen liegen drei Wochen oder man trifft sich generell nur dreimal.
Die Abstände hielt ich zwar ein, aber wenn ich mich mit einer Frau treffe, folgt das einem Gesamtkonzept. Ich will mit ihr einen angenehmen Abend verbringen, der mit Gesprächen gefüllt ist, um dann – sozusagen als Höhepunkt, auf den alles zuläuft – miteinander zu schlafen.
Die Autorin Anna Zimt, die in einer offenen Ehe lebt, hat mal zu mir gesagt: »Ich ficke immer den ganzen Menschen.«
Ich würde es nicht so vulgär ausdrücken, aber ich sehe es genauso. Wenn ich mit einer Frau schlafe, will ich nicht nur mit ihrem Körper schlafen, Erotik ist ja das Zusammenspiel aller Facetten, wie man sich gibt, was man denkt oder fühlt.
Es waren Sextreffen, die sich nicht so anfühlen sollten. Ohne dass ich es so benannt hätte, war das wohl die Idee. Wir saßen auf meinem Balkon, redeten stundenlang, während wir eine Flasche Wein leerten, manchmal auch eine zweite anbrachen, bevor wir miteinander schliefen.
Mia sagte mir, dass sie den Sinn dieser Gespräche nicht verstand, auch weil sie ja eine Bindung aufbauten, die eine Trennung schmerzvoller werden lassen könnte. Ich sagte, dass unsere Gespräche, die Stimmung auf meinem Balkon und der anschließende Sex zusammengehörten.
Sie verspätete sich absichtlich, kam erst um 23 Uhr, um unsere Gespräche umgehen und schneller Sex haben zu können. Ich nahm an, einen gemeinsamen schönen Abend zu haben, aber durch die Vertrautheit, die dadurch entstand, fing sie an zu leiden, weil sie sich mehr wünschte.
Erst als ich dieses Erlebnis rückblickend durch den Filter betrachtete, verstand ich mich wirklich.
Der Konsument in mir bestimmte mein Denken, Fühlen und Handeln. Ihm ging es nur darum, dass ich mich gut fühlte, er kannte keine Empathie.
Ich wollte einen vorübergehenden Rausch. Ich war nicht an Mia interessiert, ich war an dem Gefühl interessiert, das in mir entstand, wenn wir auf meinem Balkon saßen. Ich wollte das Gefühl konsumieren, wie eine Droge. Es ging mir nur um meine Befriedigung. Ich wollte eine Liebesbeziehung spielen, für einige Stunden in der Rolle aufgehen, meinen Gefühlen glauben und kurz vergessen, dass sie verschwunden sein würden, wenn wir am nächsten Morgen erwachten. Und ich sie wieder auf Distanz hielt. Ich wollte eine Liebesbeziehung imitieren. Ich wollte mich einige Stunden lang einer Illusion hingeben. Herausgehoben aus den Umständen. In einem in sich geschlossenen Fragment der Zeit, auf das Vergangenheit und Zukunft keinen Einfluss hatten. Ich wollte eine Illusion von Liebe. Sozusagen eine portionierte, künstliche Liebe, die Teil eines hedonistischen Entwurfs geworden war.
Eben genau wie Julian.
Die Liebe in unserer Bedarfsweckungsgesellschaft
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, dass sich die Prinzipien einer Konsum-, Überfluss- und Wegwerfgesellschaft so gut auf das moderne Singleleben anwenden lassen. Auch auf meins. Das ist schon erschreckend, gerade weil es mir ja auch klarmacht, wie gut sich mein Liebesleben der letzten Jahre in diese Mechanismen eingepasst hat.
Ich finde es erstaunlich, wie sehr mein Denken von den Prinzipien durchdrungen ist, nach denen sich die Konsumgesellschaft richtet, in der wir leben.
Wie bei der Produktauswahl in Onlineshops erscheinen mir die Auswahlmöglichkeiten in Dating-Apps scheinbar endlos. Wenn ich dann doch einmal an die Grenze stoße, ändere ich einfach die Suchparameter. Es hört nie auf. Es gibt immer Nachschub. Und das ist mir bewusst. Bei Produkten und bei Menschen. Das ist ein Wissen, das einen überfordern kann. Der Mensch scheitert an zu vielen Möglichkeiten. Je mehr Möglichkeiten man hat, desto schwerer fällt es, sich festzulegen.
Wir sind Konsumenten in einer Bedarfsweckungsgesellschaft, deren Prinzip es ja ist, uns erst das Gefühl zu vermitteln, Produkte kaufen zu müssen, die wir gar nicht vermisst hatten. Wir sind darauf konditioniert, nicht damit zufrieden zu sein, was wir haben. Wir werden permanent mit neuen vermeintlichen Bedürfnissen überschüttet. Sie werden uns eingeredet. Viele scheinen dieses Prinzip so verinnerlicht zu haben, dass sie dessen Mechanismen auch im Zwischenmenschlichen anwenden.
Wenn die Gefühle abebben und mir nicht mehr die nötige Befriedigung verschaffen, müssen sie wiederholt werden, um nach ihrem Abebben wiederum erneuert zu werden. Ein endloser Prozess, dem ich mich nur entziehen könnte, wenn ich mein Wertesystem ändere. Mein Verständnis von Glück und davon, was ein wahrhaftiges Leben ausmacht oder mit welchem Selbstverständnis ich meine Liebesbeziehungen betrachte.
Konsum gibt uns nur einen kurzen Moment der Befriedigung, es ist kein nachhaltiges Gefühl. Darum geht es ja auch nicht. Wir sollen schließlich immer mehr kaufen, damit unsere Wirtschaft funktioniert. Beim Kauf von Kleidung hört man ja nicht auf zu suchen, wenn man ein Kleidungsstück ausgewählt hat. Das neue Kleidungsstück ist etwas Vorübergehendes – bis die nächste Saison kommt.
Beunruhigend wird es allerdings, wenn man dieses Prinzip auch auf Menschen anwendet. Wenn uns Menschen als Katalogware offeriert werden. Wie in Onlineshops werden wir ja auch in Dating-Apps mit einer Unmenge von »Angeboten« überschüttet. Da fällt es schwer, sich festzulegen.
Wir sind permanent auf der Suche, die zu einem Selbstzweck geworden ist. Und wenn man permanent auf der Suche ist, kommt man nie an. Dann hat man sich in einem Übergang eingerichtet. In einem ewigen Provisorium gewissermaßen.
Alles kann durch eine bessere Version ersetzt werden, die für das eigene Leben mehr Wert haben kann. Vielleicht ist diese Überzeugung inzwischen wirklich so tief in unserem Bewusstsein verankert, dass viele sie auch auf das Zwischenmenschliche anwenden.
Wir sind auf einen Verbrauch konditioniert, bei dem die Neuanschaffung eines Produktes weniger kostet als dessen Reparatur. Es ist komfortabler, etwas zu ersetzen, als es zu reparieren.
Tinder ist gut
Das Design jedes Onlineshops wurde so entworfen, dass wir uns intuitiv in ihm zurechtfinden. Es geht um den effizientesten Weg zum Kaufabschluss. Genauso funktionieren Dating-Apps.
Erst kürzlich habe ich mal wieder einen dieser Artikel gelesen, in dem Tinder analysiert wurde. Weil der Artikel in der FAZ stand, fand die Analyse auf hohem Niveau statt. Die Autorin hat sich ziemlich kompliziert ausgedrückt, aber letztlich wollte sie wohl sagen, dass uns Tinder zu pathologischen Nymphomanen erzieht. Zu Sexsüchtigen, die ihr Leben als Pornofilm verstehen und das auch so umsetzen.
Tinder ist eine Sex-App, rief mir der Artikel zu. Eine Schlussfolgerung, die sich offen gestanden auch mit meinen Erfahrungen deckt.
Es gibt ja bei Tinder diese Funktion, Profile per Nachricht an andere zu verschicken. Sie ist eigentlich für den Fall gedacht, dass man eine Person entdeckt, von der man annimmt, sie würde einem Freund gefallen. Ich habe einen Bekannten, der diese Funktion häufig nutzt. Er schickt mir gefühlt jeden zweiten Tag Profile von Frauen auf mein Handy. Allerdings nicht, weil ihm mein persönliches Glück am Herzen liegt. Nein. Er nutzt sie eher zweckentfremdend.
Er leitet mir nämlich die Profile der Frauen weiter, mit denen er geschlafen hat. Mich zu informieren, scheint zu seinem Vollzugsritual zu gehören. Mir war offen gestanden gar nicht klar, wie wenig Sex ich eigentlich habe, seitdem ich über die Frequenz seiner Liebschaften so umfassend informiert bin. Damit fügt er sich in ein Konzept, mit dem Tinder ja inzwischen generell assoziiert wird.
Vor zwei Jahren war ich auf dem 34. Geburtstag meiner Nichte Sophie. Im Laufe des Abends passierte etwas Außergewöhnliches. Mein Tinder-Bild wurde erschüttert.
Als ich eintraf, stellte sich ziemlich schnell heraus, dass ich der einzige Single auf der Party war. Wenn ich als Single auf Paare treffe, interessiert mich immer, wie sie sich kennengelernt haben. Dabei geht es mir weniger um die Geschichte, die sie später ihren Kindern oder Enkeln erzählen werden. Mir geht es eher darum herauszufinden, wie oder wo man Frauen kennenlernen kann, mit denen man dann tatsächlich eine gesunde Beziehung führt. An den Orten, an denen ich mich abends aufhalte, findet man eher Frauen, die keine Beziehung, sondern eher eine Therapie bräuchten. Darum interessiert mich immer, wie sich Paare begegnet sind, deren Beziehung anscheinend funktioniert.
Nun ja.
Als ich meine Nichte fragte, wie sie ihren Freund kennengelernt hat, mit dem sie jetzt seit einem guten Jahr zusammen ist, sagte sie: »Auf Tinder.«
»Tinder?«, wiederholte ich, und es klang wohl fassungsloser, als es eigentlich sollte.
Sophie sah mich mit unschuldigem Blick an.
Auf dem Geburtstag gab es noch zwei weitere Paare, die sich über die App kennengelernt haben. Beide Paare sind inzwischen verheiratet. Ich sah sie irritiert an, weil ich ja bisher ausschließlich Menschen kannte, die Tinder als App für schnellen, unverbindlichen Sex nutzten.
Plötzlich passierte es. Ich verstand, dass diese drei Paare Tinder einfach nur richtig benutzt haben.
Tinder hat viele Vorteile. Man kann zum Beispiel Menschen kennenlernen, die man sonst nie getroffen hätte. Man weiß von vornherein, ob sie an Sex oder einer Beziehung interessiert sind, was hilfreich sein kann, um schon im Voraus erste Missverständnisse auszuschließen. So gesehen ist Tinder ein wertvolles Tool.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, finde ich es erstaunlich, dass sich so viele über dieses Werkzeug aufregen. Tinder wird genau genommen nur als Sex-App empfunden, weil so viele sie als Sex-App nutzen. Das Problem ist nicht die App. Es sind die Menschen, die sie bedienen. Wie man Tinder nutzt, sagt wesentlich mehr über einen selbst aus als über die App. Ein Prinzip, das sich so ziemlich auf alle neuen Technologien anwenden lässt.
Vor einer Woche rief mich Sophie an, um mir freudestrahlend mitzuteilen, dass ich Großonkel werde. Sie war im dritten Monat schwanger. Während wir telefonierten, vibrierte mein Handy. In der Nachricht, die ich erhielt, war ein Ultraschallbild meiner Großnichte.
»Es ist also ein Tinder-Kind«, sagte ich. Aber in dem Zusammenhang hatte das Wort keinen schalen Beigeschmack.
Dass Dating-Apps wie Onlineshops entworfen worden sind, ist nicht das Problem. Die Probleme gibt es auch ohne Tinder. Aber die Technologie ist ein Katalysator für Eigenschaften, die ohnehin in uns angelegt sind. Die meisten haben nicht gelernt, sie richtig zu benutzen.
Dating-Apps zeigen nur, wie viele in der Liebe als Konsumenten agieren.
Welche Art Konsument will ich in der Liebe sein?
Das moderne Liebesleben der jüngeren Generationen ist ein Rätsel. Die Kommentatoren und Psychologen betrachten, erforschen und bewerten, was da seit einigen Jahren geschieht, sind aber im Grunde genommen ratlos. Ich bin es ja auch. Sonst würde ich andere Bücher schreiben. Ich gelte als Beziehungsexperte, obwohl meine längsten Beziehungen immer nur kurz gehalten haben. Ich suche nach Antworten. »Er ist ein Suchender, der zu den Suchenden spricht«, hat die Zeit mal über mich geschrieben. Vielleicht beschreibt mich das am besten.
Aber während ich mich durch immer neue Artikel las und ständig neue Anhaltspunkte entdeckte, wie sehr unser Konsumverhalten dem Verhalten in Liebesbeziehungen entspricht, kam mir ein Gedanke.
Eigentlich war alles da. Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler hatten die Lösungen in unzähligen Büchern und Artikeln beschrieben. Man musste nur ein paar Substantive austauschen. Vielleicht musste man nur den Filter anwenden, und aus den Erkenntnissen darüber, wie wir gesünder, bewusster und nachhaltiger konsumieren, könnte man ableiten, wie wir gesünder und nachhaltiger lieben. Vielleicht war das ein erster Schritt zur Lösung. Vielleicht war es tatsächlich so einfach.
Um von einer Wegwerfgesellschaft wegzukommen, müssten Konsumenten ihr Verhalten ändern. Und ihr Verständnis von Konsum. Das fällt nicht leicht, weil es für viele ein Selbstverständnis geworden ist. Und wenn etwas Selbstverständliches geändert wird, empfindet man es schnell als Einschränkung. Die Fragen, die man sich stellen sollte, werden nicht gestellt.
Was brauche ich wirklich? Welche Befriedigung wünsche ich wirklich? Welche hat einen tieferen Wert? Das sind die Fragen, auf die es ankommt.
Kürzlich habe ich ein Interview mit dem Soziologen Hartmut Rosa gelesen, in dem es darum ging, welche Art von Konsum uns glücklich macht und welche unglücklich.
»Zum befriedigenden Konsum gehört ein Resonanzversprechen«, sagt Rosa. »Das, was wir kaufen, muss uns auch berühren. Es muss uns versprechen: Hinterher bist du ein anderer Mensch.«
Vielleicht sollte man sich gar nicht die Frage stellen, ob man in der Liebe als Konsument agiert. Man sollte es voraussetzen. Vielleicht sollte man sich eher fragen, als welche Art Konsument man in der Liebe agieren will. Ob wir nachhaltig und gesund konsumieren oder in einer Discountermentalität gefangen sind.
Wenn man davon ausgeht, dass der Konsument in einem auch im Zwischenmenschlichen die Entscheidungen trifft, sollten wir damit beginnen, unser verzerrtes Verständnis von Konsum zu korrigieren. Wir benutzen das Wort offensichtlich falsch. Wir haben den Begriff »konsumieren« durch »kaufen« ersetzt. Aber kaufen macht nur zufrieden, wenn wir die Dinge wirklich auch benutzen. Wir müssten also durch das Kaufen und Benutzen ein anderes Selbstverständnis unserer selbst bekommen. »Dazu aber«, sagt Hartmut Rosa, »müssen wir uns die Dinge auch aneignen und anverwandeln können, sonst bleiben sie uns fremd.«
Und genau das gilt auch für die Liebe. Man muss nur ein paar Worte austauschen.