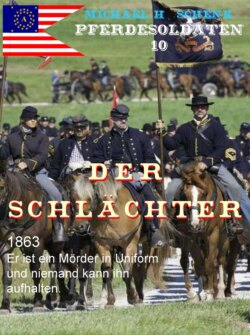Читать книгу Pferdesoldaten 10 - Der Schlächter - Michael Schenk - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5 Der First-Lieutenant
ОглавлениеKompanie „H“ der 5th Wisconsin Volunteer Cavalry bewegte sich entlang des Santa Fe Trails am Platte River. Vor einer Stunde war die Truppe, rund achtzig Kilometer von Fort Laramie entfernt, scharf nach Süden abgebogen und hatte den Trail verlassen. Fern aller Wege ritt sie durch das einstige Indianergebiet, um zwischen Denver City und dem Stammesgebiet von 1861 nach Fort Lyon zu gelangen. Die Kompanie sollte die dortige Besatzung verstärken.
Eigentlich war dies die Truppe von Captain Sam Larner, doch der hatte vorübergehend eine Abteilung in Fort Laramie übernehmen müssen, da es dort dramatisch an Offizieren fehlte. Einige der Captains und Lieutenants wurden gebraucht, um Kompanien zu befehligen, die gegen die Konföderierten kämpften, andere waren gefallen, erkrankt oder verwundet. Der Bürgerkrieg und der Dienst an der Indianergrenze erwiesen sich gleichermaßen als verlustreich.
Vor einigen Wochen war Mark Dunhill siebzehn Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hatte der Staat Wisconsin ihn, begrenzt auf Kriegszeit, zum First-Lieutenant der Wisconsin-Volunteer-Cavalry ernannt.
Sam Larner, der Mark nicht nur ein Vorgesetzter, sondern stets auch ein väterlicher Freund gewesen war, hatte aufrichtig gratuliert, doch auch ein paar mahnende Worte an ihn gerichtet: „Mark, du bist nicht nur der Sohn eines verdienten Kriegshelden, sondern hast selbst deinen Mut und deine Fähigkeiten bereits bei schwierigen Einsätzen unter Beweis gestellt. Trotz deiner jungen Jahre hast du dir diese Beförderung wahrhaftig verdient. Dennoch muss ich dich warnen, mein Freund, denn diese Beförderung ist keineswegs nur als Anerkennung gedacht. Da steckt mehr dahinter und ich hoffe, du erkennst, was das ist. Nun, was meinst du?“
Als Sohn eines Offiziers der regulären U.S.-Kavallerie hatte Mark Dunhill sein gesamtes Leben in Militärstützpunkten verbracht und kannte sich weit besser mit den Gepflogenheiten des Militärs aus, als dies sonst bei Freiwilligen der Fall war. Er brauchte nicht lange zu überlegen. „Man kann mir das eigenständige Kommando über eine Kompanie anvertrauen, Sam. Einem Second-Lieutenant gibt man vielleicht einen Platoon, aber als First-Lieutenant bekommt man weitaus mehr Verantwortung.“
„Genau so ist es, mein Junge. Damit hat sich die Army die Gelegenheit verschafft, dich mit unseren Jungs quer durch die Staaten zu schicken. Überall dorthin, wo es gerade einmal brennt und Leute fehlen. Unser Regiment hat das Los aus einem besonders großen Topf gezogen. Uns wirft man nicht die Rebellen, sondern die Roten zum Fraß vor.“
Sie hatten sich beide angegrinst, denn hinter den groben Worten von Larner verbarg sich das große Verständnis, welches sie beide gleichermaßen für die indianische Ur-Bevölkerung empfanden. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, notfalls gegen diese zu kämpfen, was beide in diesem Jahr bereits in der deutschen Siedlung Farrington bewiesen hatten. Dennoch waren sie erleichtert, nicht im Bürgerkrieg gegen Ihresgleichen antreten zu müssen, sondern weiterhin zur Sicherung der Indianergebiete beitragen zu dürfen. Sam Larner und Mark Dunhill gedachten dabei durchaus, das Leben von Weißen und Roten gleichermaßen zu schützen.
Mit Beginn des Bürgerkrieges verschärfte sich die Lage an den Grenzen zu den Indianergebieten zunehmend. Die meisten regulären U.S.-Truppen waren aus den Forts und Camps abgezogen worden, um gegen den Süden zu kämpfen. Mancher Stützpunkt war verwaist und das Netz der schützenden Vorposten dünn geworden. In dieser Zeit bemerkten die Indianer sehr wohl, wie sehr die weißen Männer mit sich selbst beschäftigt waren und wie günstig die Gelegenheit damit für sie wurde, alte Stammesgebiete zurückzuerobern und einen Schlag gegen die Besatzer zu führen.
Glücklicherweise blieben die meisten Stämme bisher friedlich.
Die Regierungen in Washington und in den einzelnen Unionsstaaten erkannten die gefährlich schwache Sicherung der Indianergebiete. Einige der geräumten Stützpunkte wurden wieder besetzt, andere neu gebaut, um entstandene Lücken zu stopfen. An Stelle der Bundestruppen rückten dort nun Freiwillige ein. Männer, die sich ihren Regimentern für ein bis drei Jahre verpflichteten und den Schutz der Weißen gewährleisten sollten. Die Indianer sahen dies mit wachsender Sorge, denn in den aktiven Camps und Forts waren nun weitaus mehr Freiwilligen-Soldaten stationiert als zuvor reguläre U.S.-Truppen. Das Misstrauen wuchs und der junge Mark Dunhill hatte in der deutschen Siedlung Farrington selbst erleben müssen, wie rasch daraus ein Kampf auf Leben und Tod werden konnte. Zudem versuchten Sympathisanten der Südstaaten immer wieder, die Indianer zum Aufstand zu bewegen.
Es war in dieser Zeit nicht leicht, den Frieden aufrecht zu erhalten. Sam Larner und Mark Dunhill sahen gerade dies jedoch als ihre vornehmste Aufgabe.
Nun war Sam in Laramie zurückgeblieben und Mark führte die „H“-Kompanie nach Süden.
First-Sergeant Jim Heller, ein ehemaliger Fallensteller, ritt an seiner Seite. Hinter ihnen folgte Trompeter Luigi Carelani, ein stets gut gelaunter Italiener, der als erster Hornist der Kompanie diente. Neben ihm hielt Corporal Tanner den Wimpel der Kompanie aufrecht. Cardigan, der zweite Trompeter, hielt sich beim hinten reitenden dritten Platoon auf, welcher von Sergeant Willard kommandiert wurde, einem begeisterten Hobbykoch, dem es irgendwie gelang, auch aus dem miesesten Armeefraß noch ein schmackhaftes Essen zu zaubern.
In Marks erstem Platoon befanden sich auch jene Männer, die sich, gemeinsam mit Mark, hatten anwerben lassen. Sie waren inzwischen zu Freunden und einer verschworenen Gemeinschaft geworden, auch wenn die militärische Tradition ihnen nun, aufgrund des Rangunterschiedes, gewisse Umgangsformen abverlangte. Zu diesen Freunden zählten Hermann, mit dreißig Jahren der Älteste, ein Deutscher aus Baden, Patrick „Paddy“ Donelson, ein junger Ire mit feuerrotem Haarschopf und schließlich Bill Jefferson, ein stämmiger Junge aus Brooklyn, der wahrscheinlich noch jünger als Mark war.
Sie waren siebenundsechzig Männer, die durch eine herbstliche Landschaft ritten. Alle trugen himmelblaue Mäntel mit langen, gelb gefütterten Capes. Alle, bis auf Mark, denn Offiziere besaßen einen dunkelblauen Mantel, mit ebenso auffällig gefüttertem Umhang. Die Ausrüstung von Offizieren unterschied sich in manchen Dingen von denen der Unteroffiziere und Mannschaften. Meist war sie von besserer Qualität, doch das wurde mit größerer Auffälligkeit bezahlt. Mark wusste sehr wohl, dass ihn der dunkelblaue Mantel und die weißen Stulpenhandschuhe als Offizier kenntlich und somit zu einem bevorzugten Ziel für jeden Gegner machten. Die Vorschriften ließen nichts anderes zu, aber Mark hatte davon gehört, dass sich mancher Offizier im Feld mit einem schlichten Mannschaftsmantel tarnte.
Er dagegen hatte in Fort Laramie lediglich den Vorteil seines Ranges genutzt, um dort ein paar gefütterte Stulpenhandschuhe zu erwerben. Sie würden im anstehenden Winter seine Hände angenehm warm halten, während sich seine Männer nur schützen konnten, indem sie die überlangen Ärmelumschläge der Mäntel nach unten klappten und ihre Hände notdürftig darin verbargen. Jetzt, im September, waren die Temperaturen tagsüber noch angenehm. Die Karabiner hingen in ihren Gurten an der rechten Seite der Kavalleristen, nur die Laufenden in einem ledernen Köcher am Sattel fixiert, so dass sich die Waffen im Takt des Ritts bewegten. Das galt ebenso für die am Waffengurt hängenden Säbel und andere Ausrüstungsteile. So rief die Kompanie während ihres Ritts ein stetes Klappern und Klirren hervor, die schon auf größere Entfernung deutlich machten, dass sich hier eine Abteilung Pferdesoldaten bewegte.
Sobald der erste Schnee fiel, würden die Kavalleristen die Karabiner quer vor sich auf die Sättel legen. So konnten sie mit den Umschlagstulpen der Mäntel die Schlösser vor dem Einfrieren schützen. Damit blieben die Waffen schussbereit, sofern Papierpatronen oder Zündhütchen nicht versagten. Mark würde hingegen erst die Handschuhe ausziehen müssen, da die dicken Fingerlinge nicht in die Abzugsbügel passten. Erst viele Jahre später würde man Revolver mit übergroßen Bügeln beschaffen, die dann den passenden Namen „Alaska-Colt“ tragen würden.
Die beiden Hornisten würden ihre C-Hörner dann unter die Mäntel nehmen und es war fraglich, ob sie bei beißender Kälte noch einen korrekten Ton würden blasen können.
Aber noch war es nicht so weit. Noch genoss man die letzten angenehmen Tage des Septembers, auch wenn mancher sorgenvoller Gedanke bereits der kalten Jahreszeit galt.
„Verdammt, Sir, schon nächsten Monat wird es hier Schnee geben. Es wird verdammt kalt werden. Ich habe gehört, in Colorado wird es immer verdammt kalt, im Winter. Wir sollten dann in einem warmen Fort sitzen oder nachts wenigstens ein Zelt und einen Sibley-Ofen zur Verfügung haben“, murmelte Standartenträger Tanner. „Ist nicht gerecht, Sir, dass man uns ständig hin und her schickt und wir nachts nur Mantel und Decke haben. Ist nachts schon lausig kalt, Sir, bei allem Respekt.“
„Vielleicht finden wir ein paar Steine für die Nacht“, antwortete First-Sergeant Heller an Marks Stelle.
Heller kannte ein paar Tricks aus seinem früheren Leben als Trapper. Für die Nacht grub man eine flache Mulde, benutzte das Kochfeuer, um ein paar Steine zu erhitzen und legte diese dann in die Vertiefung. Dann kam etwas Erde darüber und schon hatte man es angenehm kuschelig und warm unter sich. Sofern man das richtige Maß an Erde nutzte. Zu viel davon und die Steine zeigten keine Wirkung, zu wenig und man wachte mit Brandblasen auf.
Der First-Sergeant wandte sich halb im Sattel um. „Uns allen wird es im Winter kalt, Tanner, also jammere nicht herum. Außerdem ist es ja noch nicht so weit.“
„Ein Soldat muss vorausdenken“, brummelte Tanner. „Das sagt uns der Lieutenant immer wieder und der Captain sagt das auch.“
Mark Dunhill schätzte den Stand der Sonne ein und sprach dann Heller an: „Sarge, wir sollten allmählich nach einem guten Lagerplatz suchen. Ich denke, es ist an der Zeit.“
Jim Heller nickte. „Noch eine gute Stunde Licht. Gerade genug, eine geschützte Stelle am Fluss zu finden, eine warme Mahlzeit zuzubereiten und für Tanner ein paar nette Steine zu suchen.“
Die Männer der „H“-Kompanie hatten bereits auf die harte Weise gelernt, dass man auf einem Ritt niemals in absoluter Sicherheit sein konnte. Gefährliche Raubtiere, wie Bären, Berglöwen und Wölfe, mieden die Kolonne, doch die Indianer sollten unruhig sein und Rebellentrupps wagten sich mittlerweile bis weit in den Norden hinauf. Daher waren stets acht Reiter abgestellt, die, als Vorhut, Rückendeckung und Flankenschutz, ihre Kameraden sicherten. Heller stieß einen scharfen Pfiff aus und ein Reiter der Vorhut, die rund dreihundert Schritt voraus war, hob zur Bestätigung die Hand. Er würde nun mit seinem Nebenmann auf einen geeigneten Platz für das Nachtlager achten.
Die Kompanie war nach Fort Lyon befohlen, aber dieser Befehl drängte sie nicht zur Eile.
„Unsere Fünfte hat es ganz schön auseinandergetrieben“, meinte Heller. „Bei ‚D‘ hat man sogar die Platoons voneinander getrennt, damit sie verschiedene Garnisonen verstärken.“
„Gefällt mir auch nicht, Jim“, gab Mark zu. „Aber überall scheint Kavallerie zu fehlen. Sie ist nun einmal die einzige Waffengattung, die für Patrouillen und schnelle Aufklärung geeignet ist. Jedes Camp und jedes Fort schreit nach mehr Kavallerie.“
„Yeah, und uns schickt man nach Lyon“, brummte Heller.
„Unde man hat genommen uns die schöne Smith-Karabiners“, meldete sich Luigi zu Wort. Ich nix verstehe, warum, Sergente. Iste gute Waffe.“
„Ist sie, Luigi, aber für die Smith-Karabiner braucht man Spezialmunition und die gibt es nicht überall“, erklärte Mark bereitwillig. „Munition für die Sharps hingegen schon, und deswegen hat man uns die Smith abgenommen und dafür die Sharps gegeben.“
„Ja, iste gute alte Waffe“, seufzte der Hornist. „Mit gute alte Papierpatronen. Iste nix gut, ich sage.“
„Im Winter haben die Papierpatronen auch ihre Vorteile gegenüber den neuen Metallpatronen, und separate Zündhütchen brauchen wir für beide Ausführungen.“ Heller warf Luigi einen mahnenden Blick zu. „Und jetzt hör auf zu nörgeln, du verdammter Italiener! Genieße die Landschaft und den netten und behaglichen Ritt. Ist immer noch besser, als sich mit den Rebs herumzuschlagen.“
„Geeker gibt Zeichen, Sarge“, würgte Mark jede weitere Diskussion ab. „Er hat wohl einen geeigneten Platz gefunden.“
Corporal Geeker und sein Kamerad hatten die Pferde gezügelt und Geeker wies mit dem Lauf seines Karabiners in Richtung des Flusses.
Mark gab das Signal und wenig später erreichte die Abteilung den Platz, den der Corporal ausgesucht hatte.
„Guter Mann“, lobte Heller nach kurzem Rundblick. „Dicht am Ufer, aber viele Sträucher und Büsche, die uns ein wenig Schutz vor dem Wind und vor Sicht bieten. Und Knüppelholz liegt ebenfalls genug herum.“
Mark lächelte. „Und am Ufer findet Tanner sicher genug Steine für sein vorgewärmtes Nachtlager.“ Der junge Lieutenant räusperte sich.
Jim Heller wusste, dass dies ein Zeichen der Unsicherheit des jungen Offiziers war und ahnte auch den Grund. Er senkte ein wenig die Stimme: „Ich denke, wir können ruhig Feuer machen, Sir. Eine warme Mahlzeit und heißer Kaffee wird uns allen gut tun und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand mit einer ganzen Kompanie Kavallerie anlegen will.“
Mark nickte dankbar und wandte sich im Sattel um. „Wir schlagen hier unser Nachtlager auf. Sucht ausreichend Feuerholz für die Nacht. Aber versorgt zuerst die Pferde, dann kümmert euch um euch selbst. Sergeant, die übliche Wache.“
„Sir.“ Heller befahl der Kompanie abzusitzen und forderte Freiwillige für die erste Wache. Bei der sogenannten Ronde würde es keine Probleme geben, aber für die Hundewache, in welche die Zeit vor dem Morgengrauen fiel, gab es sicher nur wenige Bewerber. Sie war die anstrengendste von allen und verlockend für jeden Feind, da einen Soldaten dann am wahrscheinlichsten die Müdigkeit übermannte und seine Aufmerksamkeit nachließ, während das Zwielicht alle Konturen verwischte und es schwer machte, einen Angreifer zu entdecken.
Jim Heller kannte seine Leute. Während die ersten acht Männer ihre Posten einnahmen, trat er zu dem Deutschen Hermann. „Du meldest dich für die Hundewache, Private.“ Hermann verdrehte die Augen und Heller grinste breit. „Du hast dich oft genug vor ihr gedrückt. Also, ziere dich nicht und lass heute mal einen Kameraden schlafen.“
Der Deutsche seufzte ergeben. Heller war ein harter Knochen, aber er war auch absolut gerecht.
Mark und die Sergeants achteten akribisch darauf, dass sich die Männer zuerst um ihre Pferde kümmerten. Es gab immer wieder uneinsichtige oder säumige Kavalleristen, die nicht begriffen, wie sehr ihr Leben vom Wohl der Tiere abhing. Die Männer der „H“-Kompanie gehörten nicht dazu, dennoch konnte es sein, dass mal einer eine Kleinigkeit übersah, die fatale Folgen haben konnte.
Die Pferde wurden getränkt, dann wurde ihnen der Futtersack über den Hals gehängt. Die Reiter überprüften die Hufe auf lose Eisen, damit man diese notfalls ersetzen konnte. Ebenso aufmerksam untersuchte man Zaumzeug und Sattel auf beschädigte Gurte oder Riemen und kontrollierte jede Schnalle. Die Pferde trugen die standardmäßige graue Satteldecke und darüber den bewährten McClellan-Sattel. Die Armee hatte diesen, wie der Name bereits verriet, nach dem Entwurf von General McClellan entstandenen Sattel, ab dem Jahr 1859 für alle berittenen Einheiten beschafft. Es war eine schlichte Konstruktion, die alle Erfordernisse der Armee erfüllte, auch wenn sie sich als nicht besonders gesäßfreundlich herausstellte, da der Sattelrücken, zur Schonung der Wirbelsäule des Pferdes, in der Mitte offen war. Es gab Riemen und D-förmige Ringe, mit deren Hilfe man Mantel- und Deckenrolle befestigen oder Taschen einhängen konnte. Eine spätere Ausführung würde 1874 auch das Einhängen des Säbels ermöglichen, der bis dahin am Koppel des Reiters hing. An Stelle der zivilen Steigbügel verfügte der McClellan über breite Bügelschuhe, in die der Stiefel mit dem vorderen Teil eingestellt wurde. Stürzte ein Reiter, so konnte sich sein Stiefel nicht im Steigbügel verfangen. Die Sättel der Artillerie wiesen zusätzliche Ringe und Ösen auf, um die Leinenführung von Zugpferden zu gewährleisten.
Kompanie „H“ bewegte sich im Kriegsmarsch, was unter anderem bedeutete, dass die Pferde über Nacht nicht abgesattelt wurden und man nur die Gurte lockerte, damit sie rasch wieder verfügbar waren.
Die ersten Kavalleristen, die ihre Pferde versorgt und an einer rasch aufgespannten Halteleine angebunden hatten, kümmerten sich um das Anlegen der Feuerstellen und das Sammeln von Holz. Man würde die Feuer auch während der Nacht unterhalten, damit sie am Morgen rasch für den Kaffee verfügbar waren.
Jim Heller beobachtete den jungen Offizier verstohlen. Er mochte den Jungen. Mark stammte aus einer Soldatenfamilie und war kein verzogener Bursche. Er hatte von seinem Vater, dem Major Matt Dunhill, viel über die verschiedenen Indianerstämme gelernt und sog jedes Wissen begierig in sich auf. Der ehemalige Fallensteller hatte nicht viel Erfahrung mit Offizieren, doch er hatte sich immer wieder mit Captain Larner unterhalten, der ihm berichtete, dass es gelegentlich frische Absolventen der Militärakademie in West-Point gab, die so überzeugt von ihrem theoretischen Wissen waren, dass sie den Rat eines erfahrenen Mannes in den Wind schlugen. Vor allem, wenn dieser auch noch im Rang unter ihnen stand. Mark gehörte nicht dazu. Er hatte das Zeug dazu, ein guter und, vor allem, alter Offizier zu werden. Die meisten der Männer folgten ihm bereitwillig, denn sie spürten, dass der Lieutenant sie nicht sinnlos verheizen würde, um Ruhm für sich zu ernten.
Überhaupt war Heller mit den Männern der Kompanie sehr zufrieden. Es gab die üblichen Nörgeleien, aber keine Querulanten, und inzwischen war die Truppe zu einer erfahrenen Gemeinschaft zusammengewachsen.
Jim Heller schätzte die Unabhängigkeit seines früheren Lebens und hatte sich eher schweren Herzens für den Dienst in der Armee entschieden. Auch wenn er nun sehr auf Disziplin achten musste, so schätzte er die unnachgiebige Strenge und manchmal Schikane nicht, die gelegentlich in den Truppen ausgeübt wurde. Mancher Soldat suchte, unabhängig vom Rang, in den einsamen Stützpunkten an der Indianergrenze, auch in Antwort darauf, Zuflucht beim Alkohol. Bislang war die „H“-Kompanie davon verschont geblieben. Obwohl Heller durchaus ein oder zwei Whisky schätzte, würde er dafür sorgen, dass es so blieb.
Mark Dunhill hatte einen Blick für die Männer. Jim Heller registrierte es erneut, als der Lieutenant zu ihm kam. „Sarge, wir sollten nach Privat Jones sehen. Er hinkt ein wenig und setzt sich auf sehr merkwürdige Weise.“
„Am McClellan kann es nicht liegen“, meinte Heller prompt. „Den Sattel ist längst jeder von uns gewöhnt.“
„Yeah. Trotzdem, Jim, holen Sie Sergeant Billings mit seiner Medizintasche.“
Der First-Sergeant salutierte knapp, rief Billings und folgte dann dem Lieutenant zu Private Jones, der gerade damit fertig war, sein Pferd zu versorgen.
„Private, ich glaube, Sie haben ein Problem“, sprach Mark den Kavalleristen an.
„Kein Problem, Sir.“ Jones errötete ein wenig.
„Mach keine Umstände, Jones“, brummte Heller. „Die Hose runter, ich will mir deinen prachtvollen behaarten Hintern ansehen.“
Patrick „Paddy“ Donelson kam gerade vorbei und hatte die Bemerkung gehört. Er lachte vernehmlich. Heller sah ihn scharf an. „Halt die Klappe, Paddy-Boy, sonst bist du der Nächste. Falls du nichts zu tun hast … Ich hätte da zwei oder drei nette Jobs für dich.“
„Schon gut, Sarge.“ Paddy machte eine beschwichtigende Geste und führte sein Pferd rasch weiter, um es anzubinden.
Jones leckte sich über die Lippen. „Sir, ich habe nur falsch im Sattel gesessen.“
„Mag sein, Jones, aber du hast Schmerzen.“ Mark gab Billings einen Wink. „Kann gut sein, dass sich da etwas entzündet hat. Es ist besser, wenn Billings nachsieht.“
Der Private errötete etwas stärker, doch dann drehte er sich ein wenig und entkleidete sich so weit, dass er sein Gesäß entblößen konnte.
Jim Heller stieß einen leisen Pfiff aus. „Verdammt, Jones, damit kannst du keinesfalls mehr reiten.“
Sergeant Billings verzog keine Miene. Ihm war es gleichgültig, ob er das Hinterteil eines Mannes oder eines Pferdes verarzten musste. „Ist ein fettes Furunkel, Jones. Das muss ich aufschneiden und desinfizieren, sonst wird es immer schlimmer. Wenn du wartest, bis es von alleine aufgeht, dann hast du dir möglicherweise schon eine Vergiftung eingefangen. Dann sind Schmerzen deine geringste Sorge.“
Mark nickte. „Eine Decke und zwei Mann!“, rief er den anderen zu. „Und haltet ein bisschen Abstand.“
„Yeah, ich bin nämlich ziemlich semibel!“, fügte Jones hinzu.
„Sensibel, Jones“, verbesserte Mark unbewusst. „Das heißt sensibel. Okay, knie dich dort über den umgestürzten Baum. Willst du ein Holz?“
Jones sah misstrauisch auf Billings, der gerade eine Flasche reinen Alkohols, ein skalpellähnliches Messer und Binden aus seiner Tasche nahm. „Wenn ich für den kleinen Schnitt auf ein Holz beißen muss, Sir, dann werden mich die Jungs lange Zeit damit aufziehen.“
Billings begutachtete die hühnereigroße Schwellung an einer der Pobacken, in der sich ein gelblicher Bereich abzeichnete. „Ist kein Furunkel mehr, Sir, sondern schon ein Karbunkel.“ Er sah den fragenden Blick seines Patienten. „Du hättest dich früher melden sollen, du Blödmann. Jetzt sind mehrere Furunkel zu einem größeren Karbunkel zusammengewachsen, weil sich die Entzündung ausgebreitet hat. Kann sein, dass die Stelle in ein paar Tagen von alleine aufgeht und der Eiter abfließt, aber wenn du Pech hast, dann drückst du beim Reiten den Dreck weiter in das umlegende Gewebe und dann gibt’s eine unschöne Vergiftung.“
„Okay, Billings, hast mich überzeugt. Leg schon los, ich halte das aus.“
Zwei Kameraden hielten eine Decke aufgespannt, um Jones ein Mindestmaß an Intimsphäre zu gewähren, dann setzte Billings die provisorisch gereinigte Klinge an. Jones stieß ein gedämpftes Heulen aus, das sie alle nachvollziehen konnten. Übler Gestank breitete sich aus, während Eiter floss und Billings sich daran machte, ihn mit massierenden Bewegungen aus dem entzündeten Gewebe zu befördern. Jones Schmerzenslaute wurde zu einem erleichterten Ächzen, das sich erneut wandelte, als Billings die offene Wunde mit einem sehr kräftigen Schuss Alkohol säuberte.
„Okay, Jones, hast dich gut gehalten“, lobte Heller. „Äh, Billings, ist das Pferdesalbe?“
Der Sergeant nickte lächelnd. „Unseren Regimentsarzt würde wahrscheinlich der Schlag treffen, ist aber das beste und einfachste Zeug, um die Sache in den Griff zu bekommen. Etwas Salbe über die Stelle und dann eine ordentliche Wundabdeckung. Jones, das werden wir in den nächsten Tagen wiederholen. In einer Woche hast du es schon wieder vergessen.“
Inzwischen flackerten die ersten Kochfeuer. Die Kompanie führte vier zusätzliche Pferde als Reserve und Tragtiere mit sich. Ihren Packlasten waren bereits Kessel und Kannen entnommen worden und Sergeant Willard suchte zusammen, was er für einen schmackhaften Eintopf benötigte.
Es würde jetzt rasch dunkel werden und die Männer hatten ihre schwarz gummierten Regenponchos hervorgeholt. Sie waren seitlich mit großen Messingösen versehen und wenn man sich ein paar Äste zurechtschnitt, dann konnte man aus zwei Ponchos ein provisorisches Zelt errichten, unter dem zwei Männer gerade so Platz fanden. Damit war man wenigstens von den Seiten vor Wind und Regen geschützt. Ansonsten waren die Schlafstellen sehr einfach. Brotbeutel oder Hut als Kopfkissen sowie Mantel und Decke, um sich warm zu halten. Glücklicherweise waren die meisten Männer schon recht abgehärtet.
Kompanie „H“ hatte auf ihrem Weg, von Fort Laramie bis Fort Lyon, rund sechshundertzwanzig Kilometer zurückzulegen. Bei dem gemächlichen Wechsel, zwischen Schritt und Trab sowie den Ruhepausen, würde sie eine knappe Woche unterwegs sein. Manche Patrouille konnte mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die „H“-Kompanie führte entsprechende Vorräte mit und so konnte Sergeant Willard aus relativ reichhaltigen Beständen schöpfen.
Eine gute warme Mahlzeit konnte erheblich zur Erhaltung von Moral, Kampfkraft und Gesundheit beitragen. Willard benutzte den großen Topf aus der Packlast und das aufstellbare Dreibein. Wasser bot der Fluss, die übrigen Zutaten kamen aus diversen Säckchen, Tuben und Dosen. Seit etlichen Jahren waren Fleisch, Bohnen und andere Nahrungsmittel in Dosen erhältlich, wobei die Kompanie vor allem die Dosenpfirsiche zu schätzen wusste. Andere Dinge, wie Tomatenmark und sogar Kaffeeweißer, gab es in Tuben. Lebensmittel wie Wachtelbohnen, Speck, Trockenfleisch, Mehl, Zucker, Kaffeebohnen und dergleichen waren hingegen in einfachen Säcken verschiedener Größe abgepackt.
Mark Dunhill hatte erheblichen Anteil daran, dass der Sergeant der Kompanie etwas Schmackhaftes servieren konnte, denn der junge Offizier hatte einen Teil seines Soldes an Willard weitergegeben, der davon die üblichen Armeevorräte ergänzt hatte. Auch dies war ein Punkt, der Mark zu Sympathien bei den Männern verhalf.
Sergeant Willard nahm sich die Zeit, um einen herzhaften Eintopf aus Wachtelbohnen, Speck, Räucherfleisch und Tomatenmark zuzubereiten. An Flüssigkeiten kamen nicht nur Wasser, sondern auch Ahornsirup und ein Schuss starken Kaffees hinzu. Gut verrührt und geköchelt, verhalf dies dem Eintopf zu einer dezenten Süße und zugleich leicht herben Geschmacksnote. Natürlich durften die obligatorischen Hardtacks nicht fehlen, jene zwiebackartigen Panzerplatten aus Mehl, Wasser und etwas Salz, die man an der Luft trocknen ließ und die selbst das beste Gebiss auf eine harte Bewährungsprobe stellten. Allerdings konnte man sie einweichen oder vor dem Genuss mit dem Revolverkolben in kleinere Portionen zerlegen. Als Entschädigung für die Hardtacks würde Willard einige kostbare Dosen Pfirsich opfern, wobei jeder der Kavalleristen allerdings nur zwei Stücke mit seinem Essbesteck entnehmen durfte.
Die ganze Nacht über stand für die Wachen heißer Kaffee bereit und sein Duft würde die erwachenden Kameraden am Morgen als Erstes begrüßen, von der dröhnenden Stimme des First-Sergeants natürlich abgesehen.
Als die Männer ihre Mahlzeiten empfingen, schaufelte Luigi begeistert Löffel um Löffel in sich hinein. „Ah, Sargente Willard, haste du gemacht gute Essen, wie bei mia Mamma.“
Private Smithers spießte sein zweites Pfirsichstück auf. „Yeah, man könnte glatt glauben, wir befänden uns im Urlaub.“
„Täuscht euch nicht, Jungs“, mahnte Willard, der sich über das Lob freute. „Mag schon sein, dass dieser Ritt eher einem Ausflug gleicht, aber das kann sich verdammt schnell ändern. Schön, wir sind eine kampfstarke Kompanie, an die sich so schnell kein Wilder oder Bandit herantraut, aber ich habe gehört, die Gegend hier sei ziemlich gefährlich. Zumindest für Postkutschen, einzelne Frachtwagen oder Reisende. Sie sollen immer wieder Indianern zum Opfer gefallen sein.“
„Einige der Indianer besaßen sicher eine weiße Haut“, wandte Jim Heller ein. „Hier in Colorado wimmelt es von enttäuschten Glücksrittern. Natürlich haben die wenigsten ihr Glück gemacht. Einige sind so verzweifelt, dass sie zu Banditen werden. Das Recht hat hier ohnehin einen schweren Stand, da es kaum Gesetzeshüter gibt. In Laramie erzählte man mir, dass man in Colorado eine Gruppe Rangers aufstellen will.“
„Wie die Texas-Rangers in Texas?“, kam die Zwischenfrage.
Heller zuckte mit den Schultern. „Denke schon. Jedenfalls meinten die Kameraden in Fort Laramie, die Indianer würden weit weniger Probleme bereiten als die Weißen. Vor allem, weil die Weißen immer wieder den Vertrag mit den Indianern verletzen.“
„He, Lieutenant“, wandte sich ein Private an Mark, der ein wenig abseits saß und einen Brief an seine Mutter schrieb, „hat man Ihnen schon gesagt, was wir in Lyon sollen? Ja, ich weiß, die Besatzung verstärken, aber haben Sie nicht ein paar zusätzliche Informationen, was uns da unten erwartet?“
Mark schätzte es, ebenso wie sein Vater, wenn eine Truppe wusste, was auf sie zukam und wofür sie kämpfte. Doch in diesem Fall hatte ihm der Kommandant in Laramie auch keine weiteren Instruktionen geben können. „Nun, Männer, wir melden uns beim Befehlshaber von Fort Lyon und führen seine Befehle aus.“
„Ach, kommen Sie, Lieutenant“, brummte Private Jones, dem das Sitzen nun wieder wesentlich leichter fiel, „ein bisschen was werden Sie doch wissen oder zumindest vermuten, oder?“
Sie waren Freiwillige, die aus den unterschiedlichsten Berufen kamen und mit den verschiedensten Motiven eingetreten waren. Oft wählten solche Truppen ihre Offiziere und Unteroffiziere in einem demokratischen Verfahren. Selbst bei den disziplinierten freiwilligen Regimentern gab es häufig ein wesentlich vertrauteres Verhältnis unter den Rängen als bei den regulären U.S.-Einheiten. Mark gefiel das, solange die Männer seinen Befehlen folgten und im Gefecht nicht über den Sinn einer Anweisung debattieren wollten. Ein Volunteer-Regiment der Unionsinfanterie hatte dies während der ersten Schlacht am Bull Run versucht und war nahezu vollständig vernichtet worden.
Abermals erinnerte sich Mark an die Worte seines Vaters, der stets der Auffassung war, dass ein Soldat das Recht hatte, zu wissen, weswegen er kämpfen sollte. „Tut mir leid, Jungs, aber ich bin auch nicht schlauer als ihr. Unser Captain Larner hat mir lediglich gesagt, dass man in Fort Lyon wohl in Sorge wegen der Cheyenne und Arapahoe ist. Nicht wegen eines Aufstandes, sondern weil der Winter naht und die Indianer vielleicht Probleme mit ihren Vorräten bekommen. In dem Fall soll das Fort die Stämme mit Lebensmitteln versorgen. Das wurde wohl vertraglich zugesichert, aber ihr wisst ja selbst, Jungs, dass da eine Menge schiefgehen kann.“
Einer der Privates nickte. „Die Versorgung unserer Unionstruppen geht vor und die Indianer bekommen nur, was übrig bleibt. Da gibt es dann wohl bei einigen Stämmen Unruhe, Sir, weil die sauer werden.“
„Es macht keinen Sinn, über diese Dinge zu spekulieren, wenn wir dabei die Fakten nicht kennen“, fuhr Mark fort. „Wir haben unsere Befehle und in Fort Lyon werden wir sicherlich erfahren, wie die dortige Lage ist.“
„Wohl wahr“, meldete sich Jim Heller zu Wort. „Wir sollten in jedem Fall die Augen offen halten, aber ich glaube nicht, dass im Augenblick die Gefahr für einen Indianeraufstand besteht.“ Er grinste breit. „Der Winter kommt und dann ist es dafür einfach zu kalt, Jungs.“
Allgemeines Gelächter ertönte. Einer der Kavalleristen zog eine Mundharmonika hervor und stimmte eine der beliebten Balladen an. Nach einigen Augenblicken begann einer der Soldaten zu singen und andere fielen mit ein.
Mark Dunhill erwiderte den Blick von Jim Heller. Es war ein friedvoller Augenblick, doch sie waren erfahren genug, um zu wissen, wie rasch sich das im Westen ändern konnte.