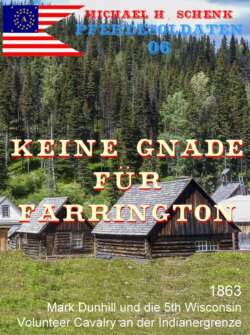Читать книгу Die Pferdesoldaten 06 - Keine Gnade für Farrington - Michael Schenk - Страница 3
Kapitel 1 Farrington
ОглавлениеPferdesoldaten 06
Keine Gnade für Farrington
Military Western
von
Michael H. Schenk
© M. Schenk 2018
Farrington lag in Wisconsin, in der Nähe des Lake Superior, der zu den großen Seen gehörte. Der Ort lag direkt am Ufer des Rual River. Hier mündete der kleinere Bone River, der eher einem Bachlauf glich, in den Rual und so lag Farrington zwischen beiden Wasserläufen. Es gab eine östliche und eine westliche Furt, wobei Letztere zum Bone gehörte, dessen Wasser ohnehin kaum über die Knöchel reichte. Die Flüsse bildeten eine natürliche Grenze für die aufstrebende Siedlung, auch wenn es wohl noch eine Weile dauern würde, bevor die Häuser an ihre Ufer stießen. Im Norden hingegen schob sich die kleine Stadt bereits bis auf wenige hundert Yards an die dichten Wälder heran.
Farrington war ursprünglich ein kleiner Handelsposten der American Fur Company. Der Deutsche Johann Jakob Astor hatte diese einst gegründet und zur einflussreichsten Pelzhandelsgesellschaft der Vereinigten Staaten von Nordamerika gemacht. Inzwischen war die AFC jedoch fast wieder in Bedeutungslosigkeit versunken. Farrington war eine der letzten Niederlassungen zwischen den großen Seen und dem Mississippi River.
Im Gegensatz zu etlichen anderen Handelsposten, die eher einem Fort glichen, war Farrington nie befestigt worden. Die kleine Ansammlung von Blockhäusern und Hütten hatte keinen Feind zu fürchten brauchen, denn Astor achtete streng darauf, dass die Gesellschaft einen fairen Handel mit den ansässigen Indianern trieb. Waffen und Alkohol gehörten nicht zu den Handelsgütern. Möglicherweise trug dies zu dem friedlichen Nebeneinander bei.
Vor fünf Jahren waren neue Weiße in das Gebiet gekommen.
Ein Treck aus dreißig Planwagen, die von Rindern gezogen wurden und denen eine ganze Schar Hunde und Hühner folgte. Dieser Treck brachte Menschen nach Farrington, die sich hier ansiedeln wollten. Es waren Deutsche unter der Führung des Grafen Wilhelm von Trauenstein.
Von Trauenstein hatte sich den Mainzer Adelsverein zum Vorbild genommen, der seit dem Jahr 1842 die Auswanderung nach Amerika förderte. In Deutschland herrschten Armut und Not, und mancher Adliger sah sich verpflichtet, dem Elend entgegen zu treten und den Notleidenden eine neue Perspektive zu eröffnen. Diese Bestrebungen wurden durchaus unterstützt. Neu gegründete Staaten wie Texas warben um Einwanderer aus Europa, um ihre Gebiete zu besiedeln. Der Adel in den verschiedenen deutschen Ländern gedachte bei seiner Unterstützung durchaus, manchen potenziellen Aufrührer auf bequeme Weise loszuwerden. Die deutschen Händler wiederum hofften, dass die neuen Siedler auf dem fernen amerikanischen Kontinent zu neuen Absatzmärkten beitragen würden.
Der Mainzer Adelsverein hatte Texas zum Ziel und versprach den Aussiedlern 130 Hektar Land je Familie, die Versorgung mit Lebensmitteln bis zur ersten eigenen Ernte, Kirchen, Schulen und ärztliche Betreuung. Manche dieser Versprechen konnten, aufgrund der knappen Finanzmittel, nicht eingehalten werden. Dennoch siedelten bis zum Jahr 1848 bereits fast 7.500 Deutsche in Texas und gründeten Städte wie „New Braunfels“ und „Fredericksburg“.
Der rüstige Graf von Trauenstein war ein eher bodenständiger Witwer, wurde jedoch von seiner hübschen Tochter Josefine zur Ausreise motiviert, die jeden Bericht über das ferne Land mit Begeisterung verschlang und ihren Vater förmlich mit dem Virus Amerika ansteckte.
Graf Wilhelm von Trauenstein gründete seinen eigenen „Adelsverein“, denn ihm erschienen die nördlicheren Regionen der U.S.A. weit verlockender. Der Norden und Westen lockten mit fruchtbarem Boden, saftigen Weideflächen und üppigen Wäldern. Eine gute Grundlage für Besiedlung und Handel. Gemeinsam mit seiner Tochter warb er für die Aussiedlung und konnte eine Reihe von Familien für die Idee begeistern. So investierte er sein Vermögen in die Reise und in die Ausrüstung der Auswanderungswilligen. Er scheute nicht davor zurück, Milchkühe und Hühner aus der alten Heimat mitzunehmen. Nicht alle überlebten die strapaziöse Reise, doch nach über einem Jahr erreichte man Amerika und entschied sich, im nördlichen Teil nach einem geeigneten Ort zu suchen.
Der beschwerliche Treck führte die Deutschen eher zufällig in die Nähe des Lake Spirit, im nordwestlichen Wisconsin, und zum alten Handelsposten Farrington. Man entschied spontan, dass hier die richtige Stelle für die neue Heimat sei. Das Land bot alles, was die Siedler zum Überleben und zu ihrer Entwicklung benötigten. Das einzige Problem schien in der Tatsache zu bestehen, dass Farrington direkt an der Grenze zum Indianerland lag.
Im Gegensatz zu den gebürtigen Amerikanern, hatten die Einwanderer aus Deutschland kaum Vorbehalte gegen die Ureinwohner des Kontinents. Von Trauenstein sah es nicht als von Gott gegebenes Recht an, sich das Land einfach zu nehmen. Er war klug genug, um zu erkennen, dass eine friedliche Koexistenz nur möglich war, wenn man sich mit den Ureinwohnern einigte.
Das Erscheinen der Deutschen war nicht unbemerkt geblieben und schon bald, nachdem der Treck in der Nähe des alten Handelspostens der American Fur Company lagerte, erschienen die ersten Sioux-Indianer. Mit dem fairen Handel der AFC hatten die Roten gute Erfahrungen gemacht, doch einer Schar Siedler standen sie misstrauisch gegenüber. Zu oft waren Weiße in die Indianergebiete eingedrungen und hatten sich das Land einfach genommen.
Die Deutschen empfingen die Indianer mit offenen Armen, führten sie durch das Lager und machten ihnen Geschenke. Von Trauenstein sprach ohne Falsch, erklärte die Situation und die Sehnsüchte seiner Leute und bat höflich um ein Gespräch mit den Stammesführern.
Schon kurz darauf erschien Häuptling Many Horses mit einer Delegation am Handelsposten. Der ergraute Chief bot einen imposanten Anblick, in reich besticktem Leder und einer weit ausladenden Federhaube. Die Haut hatte eine kupferrote Tönung und wirkte sehr dunkel, die Nase war scharf geschnitten und die Augen blickten ebenso klar, wie der Verstand des Häuptlings scharf war.
In gewisser Weise ähnelten sich Many Horses und von Trauenstein. Der Graf war von der Sonne gebräunt und die Haut bildete einen scharfen Kontrast zu dem schlohweißen Haar und Vollbart des Adligen. Gelegentlich nutzte er ein Monokel als Sehhilfe und stützte sich auf den silbernen Knauf eines Gehstocks. Seine Stimme war sanft und kultiviert.
Die Deutschen waren erleichtert, dass viele der Indianer, aufgrund der Handelsbeziehungen zur AFC, die Sprache der Weißen beherrschten. Oft weitaus besser, als dies für sie selber galt. Nur eine Handvoll der Siedler beherrschte, mehr schlecht als recht, das Englische.
Das Treffen fand vor dem Lager des Trecks statt. Die rund 240 Deutschen standen vor den Wagen und sahen neugierig zu. Männer, Frauen und Kinder, die verstanden, welche Bedeutung dieses Gespräch für ihre Zukunft haben musste. Josefine von Trauensteins Wunsch entsprechend, war keiner der Siedler bewaffnet, auch wenn Gewehre und Pistolen griffbereit in den Wagen lagen. Die Lakota, von den Weißen Sioux genannt, waren zu Zehnt und hatten sich, ebenfalls der Bedeutung des Augenblicks bewusst, in ihre Festtagsgewänder gekleidet. Sie verbargen ihre Waffen nicht, doch ihre Blicke verrieten Neugierde und keine Feindseligkeit.
Der Graf kannte sich in den Gebräuchen der Indianer nicht aus und wählte seine Tochter Josefine, Doktor Penzlau und Pfarrer Dörner als Begleiter. Die drei hatten Klapphocker bei sich, doch als sie bemerkten, dass die Gesprächspartner im Schneidersitz auf dem Boden saßen, folgten sie deren Beispiel, um auf Augenhöhe miteinander reden zu können.
„Wir kommen in Frieden, Häuptling“, versicherte von Trauenstein, „und wir sind auf der Suche nach einer neuen Heimat. Wir hoffen auf eure Erlaubnis, uns hier ansiedeln zu dürfen und wollen die Früchte unserer Arbeit mit euch teilen.“
Chief Many Horses kannte ähnliche Beteuerungen schon von anderen Weißen. Es gab eine ganze Reihe von indianischen Stämmen, welche solchen Versprechen geglaubt hatten und bitter enttäuscht worden waren. Dennoch hörte er aufmerksam zu, beobachtete die Körpersprache seiner Gegenüber und lauschte dem Klang der Stimmen, ob ein Unterton von Falschheit in ihnen mitschwang. Vor allem jedoch, sah er in die Augen des Grafen und dessen Begleiter.
„Die Not hat uns aus unserer alten Heimat vertrieben“, fuhr Graf von Trauenstein mit ernster Stimme fort. „Viele leiden dort Hunger und sterben. Wir sind hierher gekommen, weil wir eine neue Heimat suchen, in der wir in Frieden leben können. Dies ist ein wundervoller Ort und hier würden wir uns gerne niederlassen und unsere Kinder aufziehen. Im Gegenzug werden wir ehrlichen Handel mit euch treiben. Wir werden Fleisch, Leder, Häute und viele Dinge mehr benötigen und wir können euch dafür Eier, Milch, Käse und andere Dinge bieten. Wir haben gute Handwerker und einen sehr fähigen Arzt.“
„Werden auch andere kommen?“, fragte Many Horses mit ruhiger Stimme. „Wir kennen euch Weiße und die Flut, welche der ersten Welle folgt.“
„Wir suchen ein Heim für uns, unsere Kinder und deren Kindeskinder. Wir hoffen, dass unsere Gemeinschaft wachsen wird, doch ich kann nicht sagen, ob uns andere folgen. Wir sind die einzigen Deutschen, die sich hierher auf den Weg machten, aber es kann natürlich sein, dass es Menschen gibt, die sich uns anschließen wollen.“
Das war immerhin ehrlich, obwohl der Graf wohl spürte, dass die Indianer nicht von dieser Aussage begeistert waren. Er versuchte, sich in ihre Lage zu versetzen. Wie würden sich die Bewohner seines Dorfes in der alten Heimat verhalten, wenn sich immer mehr fremde Eindringlinge niedergelassen wollten? Selbst unter direkt benachbarten Dörfern gab es gelegentlich Rivalitäten. Er fühlte, dass das Schicksal der Deutschen die Indianer nicht unberührt ließ, doch ebenso, dass es eines Beweises des Vertrauens bedurfte.
Was der Graf nun vorschlug, war ein enormes Wagnis. „Wir sind bereit, unsere Waffen abzugeben und uns unter den Schutz eures Stammes zu stellen.“
Sitting Horse, einer der Unterhäuptlinge, zeigte seine Überraschung. „Ihr würdet eure Waffen abgeben?“
Von Trauenstein nickte. „Wir würden allerdings gerne eine Handvoll Flinten für die Jagd behalten.“
Many Horses blickte zu den Planwagen und Siedlern hinüber. „Und deine Deutschen sind damit einverstanden?“
„Wenn wir dafür hier bleiben können, dann werden sie das sein.“
Der Chief schwieg einen Moment. „Gehe, Weißhaar, und frage sie.“
Die Gruppe der Weißen erhob sich und ging zum Lager hinüber, während die Sioux erregt miteinander diskutierten. Sie verstummten, als bei den Weißen eine kurze Diskussion entbrannte. Doch dann kehrte der Graf zurück. Vier Männer trugen Decken, die sie vor den Sioux auf den Boden legten.
Die Indianer starrten nachdenklich auf das Sammelsurium an Waffen, welches ihnen präsentiert wurde. Überwiegend Büchsen und Flinten aus deutscher Fertigung, die sich durch die sorgfältige Verarbeitung und Ziselierung oder prachtvolle Schnitzereien von den meisten amerikanischen Waffen abhoben. Dazu kamen ein paar einschüssige Vorderladerpistolen und eine Handvoll moderner Revolver.
„Das sind alle Waffen?“, fragte Sitting Horse.
„Alle Schusswaffen“, bestätigte einer der Weißen, dessen Gesicht zeigte, dass er sich nicht gerne von ihnen trennte.
„Ein paar würden wir, wie ich bereits erwähnte, gerne für Jagdzwecke behalten“, fügte von Trauenstein hinzu. „Zudem soll es in den Wäldern gefährliche Raubtiere geben.“
Many Horses tauschte ein paar Sätze mit seinen Begleitern in der Stammessprache Lakota, bevor er sich wieder dem Graf zuwandte und auf die Ansammlung von Waffen wies. „Ihr beweist uns euer Vertrauen und so werden wir euch auch das unsere beweisen. Nehmt eure Waffen wieder an euch.“
Nun war es an den Deutschen, überrascht zu sein. „Ihr gebt sie uns zurück?“
Many Horses lächelte. „Dies ist ein wildes Land und ein Krieger muss in der Lage sein, seine Familie zu schützen.“
„Und wir dürfen bleiben und hier siedeln?“
„Solange ihr den Frieden wahrt und die zu treffende Vereinbarung einhaltet, seid ihr uns willkommen.“
Josefine von Trauenstein war überwältigt und vergaß ihre Erziehung, die sie zur Zurückhaltung mahnte. Sie wandte sich dem Lager zu und stieß einen triumphierenden Schrei aus. „Wir dürfen bleiben!“
Um die Lippen von Many Horses spielte ein verständnisvolles Lächeln, als der Jubel der Deutschen herüber brandete. „Lasst uns die Vereinbarung treffen und die Pfeife rauchen, Weißhaar.“
Es gab keinen schriftlichen Vertrag. Nur die mündliche Übereinkunft. Many Horses und von Trauenstein besiegelten diese mit Handschlag und dem kreisenden Kalumet, mit dessen Rauch alles besiegelt wurde.
Die deutschen Familien machten sich mit Eifer und der ihnen eigenen Gründlichkeit an die Arbeit. Der Graf hatte darauf geachtet, dass die Neusiedler eine Mischung aus Handwerkern, Bauern und Züchtern waren, die eine solide Basis für den Aufbau der neuen Heimat bildeten. Im Gegensatz zu anderen Deutschen verzichteten sie darauf, der Siedlung einen deutschen Namen zu geben, der an die alte Heimat erinnerte. Sie beließen es bei Farrington, denn so war der Ort auf den Karten eingetragen.
Bald hallten das Schlagen von Äxten und das Krachen stürzender Bäume durch den Wald. Die deutschen Holzfäller kannten die Gefahren, die Holz durch Insektenbefall drohten und so wurden die Stämme sorgfältig von ihrer Rinde befreit, bevor man sie verbaute oder zu Bohlen und Brettern verarbeitete.
Eine ganze Reihe eingeschossiger Häuser entstand. Das Erdgeschoss in typischer Blockbauweise, denn die Winter in Wisconsin waren hart und wenn man die Fugen zwischen den Stämmen sorgfältig mit Moos oder Lehm stopfte, dann bot die massive Konstruktion den besten Schutz vor der grimmigen Witterung. Das Dachgeschoss war hingegen eine Konstruktion aus dicken Balken und Bohlen, und wurde mit selbstgefertigten Holzschindeln gedeckt. Jede Familie bekam ihr eigenes Heim und der kleine Ort begann sich parallel zum Waldrand hin auszubreiten.
Der Graf hatte einen genauen Plan entwickelt, wie „seine“ Stadt aussehen sollte. Eher untypisch verlegte er die wichtigsten Gebäude nicht ins Zentrum der Siedlung, sondern an deren westlichen Rand. Damit wollte er demonstrativ bewirken, dass die indianischen Nachbarn eine direkte „Anlaufstelle“ erhielten, denn hier entstanden das Rathaus und ein großer Gemeinschaftsbau, über dessen Vordach ein großes Schild mit der Bezeichnung „Josefine´s Saloon“ befestigt war. Neben der Kirche waren dies die einzigen zweigeschossigen Häuser der Siedlung. Die Deutschen hofften darauf, dass die Sioux die Gelegenheit zu freundschaftlichen Besuchen nutzten.
Die Tochter des Grafen übernahm die Leitung des Saloons, der ihren Namen trug und der zugleich als Versammlungsraum der Bürgerschaft und Gemischtwarenladen diente. Gelegentlich sorgte hier die kleine Laienspielgruppe der Siedler für Tanzabende mit Musik oder führte Theaterstücke auf. Die von Trauensteins versuchten, einen Teil ihrer Kultur zu wahren und in der „Wildnis“ ein Stück Zivilisation zu führen, daher entsprach der „Saloon“ nicht dem amerikanischen Vorbild. Er war vielmehr in zwei Salons geteilt, von denen einer als Damen-Club und der andere als Herren-Club geführt wurde.
Dem Saloon schräg gegenüber lag das Rathaus, in dem zugleich die von Trauensteins wohnten. Im Untergeschoss befand sich die Verwaltung, in dem sich der Gemeinderat traf. Dieser setzte sich aus dem Grafen als Bürgermeister, Pfarrer Dörner, Doktor Penzlau und dem Schmied Hubertus Keil, als Vertreter der Bürgerschaft, zusammen. Im Obergeschoss lagen die Privaträume des Grafen und seiner Tochter.
Überragt wurden alle Bauten von der Kirche des Pfarrers Dörner, was allerdings nur an der Höhe des hölzernen Glockenturms lag. Dörner hatte bei der Reise auf manche persönliche Dinge verzichtet, um sein Harmonium und die kleine Glocke des alten Heimatdorfes mitnehmen zu können. Damals lächelte mancher darüber, doch der Klang beider Instrumente war etwas Vertrautes, was den Siedlern sofort ein Heimatgefühl vermittelte.
All dies war nun fünf Jahre her und aus Farrington war eine hübsche Siedlung geworden, die inzwischen über fünfhundert Menschen ein Heim bot. In kleinen Vorgärten wuchsen Blumen und wurden Kräuter gezogen. Kühe weideten und lieferten Häute, Fleisch und Milch. Eine Reihe von Äckern wurde sorgfältig bestellt und lieferte Getreide, Gemüse und Kartoffeln. Zum Rual River hin wuchsen sogar ein paar Apfelbäume. Fast jede Familie besaß ein paar Hühner, die für Nachschub mit frischen Eiern sorgten. Brot, Brötchen und Kuchen wurden gebacken und wurden im Gemischtwarenladen von Josefine´s Saloon gehandelt.
In dem alten Handelsposten, der von der American Fur Company aufgegeben worden war, hatte sich Pecos Bill mit seiner indianischen Frau Little Bird eingerichtet. Er war gebürtiger Texaner, hatte lange als Fallensteller gelebt und war dann, nach einem schlecht verheilten Beinbruch, Angestellter der AFC geworden. Nachdem die Gesellschaft den Posten aufgab, schlug Graf von Trauenstein dem Ehepaar vor, ihn weiter zu führen. Er sollte als „indianischer Laden und Handelsposten“ dienen. Zwei Gemischtwarenläden waren für einen so kleinen Ort eigentlich zu viel, doch die Siedler waren sich einig, dass Pecos Bill und seine Frau die Richtigen waren, um fairen Handel mit den Sioux zu treiben und darauf zu achten, dass in ihrem Laden nichts angeboten wurde, was zu den verbotenen Waren gehörte: Schusswaffen und Alkohol.
Von Trauenstein besprach dies mit Chief Many Horses und dieser stimmte dem Plan zu. Er kannte die verhängnisvolle Faszination, die Alkohol auf seine roten Brüder ausüben konnte und wollte verhindern, dass diese in Josefine´s Saloon mit der Versuchung konfrontiert wurden. Der Handel mit Waffen und Munition war nicht generell verboten, beschränkte sich jedoch auf jene, die für die Jagd Verwendung fanden. Die Sioux benutzten ohnehin lieber ihre nahezu lautlosen Bogen, an Stelle der lauten Schusswaffen der Weißen.
Das Verhältnis zwischen Indianern und Deutschen festigte sich in den Jahren. Nicht allein auf Grund des gegenseitigen Handels, sondern vor allem wegen Doktor Penzlau. Der Arzt der deutschen Siedlung und der Medizinmann des Stammes besuchten sich oft und gegenseitig, um voneinander zu lernen. Das Wissen um die heilende Wirkung von Pflanzen wandte Penzlau gerne an, da Medikamente selten und teuer waren. Der Doktor hingegen konnte dem Medizinmann beweisen, dass die Kunst der weißen Medizin bei schweren Verwundungen von Nutzen war. Aus dem gegenseitigen Respekt der Männer entwickelte sich zunehmend eine Freundschaft.
Dies galt auch für das Verhältnis von Many Horses und dem Grafen. Beide empfanden Verantwortung für ihre jeweiligen Gemeinschaften und bewiesen, dass gegenseitiger Respekt und Verständnis die Grundlage eines friedlichen Miteinanders waren.
Immer wieder wurden Siedler zu den Stammesfesten der Sioux eingeladen, umgekehrt besuchten diese die Vorführungen der kleinen Theatergruppe.
Farrington lag direkt an der Grenze zum Stammesgebiet und begann zu wachsen. Die kleine Siedlung wurde von der Zivilisation nicht ignoriert. Vor einem knappen Jahr war ein Trupp Vermessungsingenieure erschienen und man hatte eine weitere Route für die Postkutschen geplant, welche immer mehr Städte und Dörfer miteinander verbanden. Vielleicht würde Farrington sogar eines Tages über eine Bahnstation verfügen, doch für die Bewohner war es schon ein gewaltiger Fortschritt, dass nun einmal in der Woche die Überlandkutsche eintraf. Zwar beförderte sie nur selten Passagiere, aber sie brachte Neuigkeiten und Zeitschriften. Die Damen waren vor allem von den Katalogen der großen Warenhäuser begeistert. Auch wenn man sich die meisten Dinge nicht hätte leisten können, so gaben die abgebildeten Kleider und Accessoires doch Anregungen für die eigenen Näharbeiten. In Josefine´s Saloon entwickelte sich zunehmend ein bescheidener Bestellhandel.
Das Leben in Farrington verlief in friedlichen und geordneten Bahnen und schien von den Ereignissen außerhalb unberührt.
Bis zu jenem Tag, an dem die Kutsche eine Zeitschrift mitbrachte, in der von Krieg die Rede war.
Krieg zwischen den Unionsstaaten des Nordens und den konföderierten Staaten des Südens.
Diese Neuigkeit schien Farrington in seiner beschaulichen Ruhe kaum zu betreffen und doch elektrisierte sie seine Bewohner und auch den Stamm von Many Horses. Letzteren so sehr, dass er nach Farrington kam, um dort mit dem Grafen zu sprechen.
Krieg war nie ein Thema zwischen Sioux und deutschen Siedlern gewesen, doch die Nachricht aus dem Osten zwang es ihnen auf.
Es gab eine breite Veranda vor dem großen Bürgermeisteramt, auf der Tische und Stühle standen. Doch von Trauenstein hatte es sich angewöhnt, zu Ehren seines indianischen Gastes mit einer Decke Vorlieb zu nehmen. Many Horses schätzte diesen Respektbeweis und er schätzte ebenso die selbstgemachte Zitronenlimonade, die Josefine ihnen beiden brachte.
„Ich habe frischen Apfelpfannkuchen, Chief“, berichtete Josefine. „Es wäre mir eine Freude, wenn ich Ihnen einen ordentlichen Teller mitgeben dürfte.“
„Mein Weib und meine Enkel mögen eure deutschen Apfelpfannkuchen. Ich werde sie ihnen gerne mitbringen.“ Der Chief lächelte sanft. „Auch ich bin ihm nicht abgeneigt.“
Many Horses beherrschte die Sprache des weißen Mannes, das Englische, nahezu perfekt und hatten sich inzwischen, da es ihm Vergnügen bereitete, sogar ein paar Worte Deutsch angeeignet. Von Trauenstein fiel es hingegen schwer, die Stammessprache der Lakota zu erlernen und seine diesbezüglichen Versuche riefen immer wieder ein freundliches Lächeln bei Many Horses hervor. Die beiden Männer verstanden und vertrauten einander, was vor allem daran lag, dass sie ehrlich miteinander umgingen und Unstimmigkeiten, die zwischen Deutschen und Indianern auftreten konnten, stets gemeinsam regelten.
Von Trauenstein kannte inzwischen die Angewohnheit seines Gastes, erst ein wenig über die täglichen Dinge des Lebens zu plaudern, bevor man zum eigentlich Grund eines Zusammentreffens kam.
So redeten sie eine Weile über die anstehende Büffeljagd und welche Bedeutung der Büffel für das Leben des roten Volkes besaß, und der Graf bedankte sich für das Angebot, dass zwei Männer aus Farrington die Jagdgruppe der Sioux begleiten sollten. Von Trauenstein berichtete über die Arbeiten an den Bewässerungsgräben für eines der Felder und was man sich davon erhoffte.
Many Horses waren die Arbeiten an zwei Häusern im Osten der Stadt aufgefallen und er erkundigte sich nach deren Zweck.
„Wir hoffen, hier eine Pferdewechselstation für die Überlandkutsche einrichten zu können“, erklärte von Trauenstein. „Inzwischen führt ja die neue Straße durch unseren Ort und die Postkutsche kommt einmal in der Woche. Wir wollen Pferdewechsel und einen bequemen Aufenthalt für die Passagiere anbieten. Das bringt uns zusätzliche Einnahmen, die wir wiederum in Farrington investieren können. Das andere Gebäude wird unser Schulhaus.“
„Ihr wollt weiter wachsen, Weißhaar?“
„Wir brauchen dringend eine Schule. Inzwischen leben viele Kinder bei uns, die unterrichtet werden müssen. Momentan behelfen wir uns, in dem meine Tochter Josefina und zwei der anderen Frauen in ihrem Saloon unterrichtet, aber das ist keine wirkliche Lösung. Wir brauchen ein Schulhaus und Unterrichtsmaterial, wie zum Beispiel Tafel, Schreibhefte und Bücher, sowie einen Lehrer oder eine Lehrerin.“
„Wir brauchen so etwas nicht“, erwiderte Many Horses lächelnd. „Unsere Mädchen lernen von den Frauen und unsere Jungen von den Kriegern. Jeder lernt, was er wissen muss.“
„Das ist wohl wahr“, gab von Trauenstein zu. „Für euer Volk ist es wohl auch die richtige Lösung, denn euer Stamm bleibt stets beisammen. Doch einige unserer Kinder werden irgendwann Farrington verlassen und, wie man so schön sagt, hinaus in die Welt ziehen. Dann müssen sie lesen und schreiben und rechnen können, und eine Vorstellung davon haben, wie es in den großen Städten zugeht.“
„Die großen Städte der Weißen…“ Many Horses schüttelte den Kopf. „Häuser aus Stein und schlechte Luft. Krankheiten und Menschen, die einander nicht kennen. Kein Blick für die Schönheit der Natur. Nur das Streben nach Gold und Vergnügen.“
„Ein etwas einseitiges Bild, mein roter Freund, welches du da zeichnest, auch wenn Einiges davon wahr ist. Mich selbst würde es auch nie wieder in eine große Stadt ziehen.“ Von Trauenstein seufzte. „Aber ich kenne den Drang der Jugend und unsere Pflicht ist es, unsere Kinder auf das künftige Leben vorzubereiten.“
„Ihr lebt hier und ihr lebt gut. Ihr züchtet Vieh und bestellt eure Felder. Wenn euch die Abenteuerlust packt, so könnt ihr mit uns auf die Büffeljagd gehen.“ Der alte Häuptling lächelte. „Oder auf den Kriegspfad, wenn sich eure Knaben als Männer erweisen wollen.“
Die Deutschen wussten, dass es immer wieder zu Kämpfen zwischen verfeindeten indianischen Stämmen kam. Bislang war dies nie ein Thema gewesen und der Graf ahnte, dass der Chief damit zu dem Thema überleiten wollte, dass der Grund für seinen Besuch war.
„Krieg ist nicht gut“, sagte von Trauenstein mit fester Stimme. „In Europa, dem Kontinent, auf dem meine alte Heimat liegt, wird immer irgendwo Krieg geführt.“
„Um neue Jagdgründe oder weil die Krieger eines anderen Stammes in euer Gebiet kommen?“
„Manche Völker wachsen sehr schnell und wollen sich ausbreiten. Doch in den meisten Kriegen geht es wohl um verletzten Stolz oder um wertvolle Ressourcen.“
„Ressourcen?“
„Wertvolle Dinge, die im Boden verborgen sind.“
„So wie das glänzende Gold, welches die Weißen so schnell verrückt macht?“
„Auch, aber ich meine eher Eisenerz, Kohle und ähnliche Dinge. Rohstoffe, die man benötigt, um eine Industrienation aufzubauen.“
„Was ist… Industrie?“
„Maschinen.“ Der Graf seufzte erneut. „Dampfkraft, Elektrizität, Gas… Aber vor allem Maschinen, mit denen man Dinge herstellen kann.“
„Dinge stellt man mit den Händen her.“
„Nun, in vielen Ländern tun dies Maschinen, auch wenn sie natürlich von Händen bedient werden.“
„Wenn die… Maschinen… von Händen bedient werden… Warum benutzt man die Hände dann nicht, um die Dinge direkt mit ihnen zu fertigen?“
„Weil Maschinen schneller sind und größere Mengen produzieren. Dadurch kann man Waren herstellen, mit denen man Handel treibt.“
„Handel ist gut, wenn er fair ist und allen nutzt“, meinte Many Horses. „Wer miteinander handelt, der macht keinen Krieg.“
Von Trauenstein wusste es besser, wollte aber nicht widersprechen. Er kannte die einfache Lebenseinstellung seines Gegenübers und beneidete ihn darum.
„Unser Volk wird im Sommer ein großes Pow Wow abhalten“, sagte der Chief mit ernstem Gesicht. „Die Abgeordneten aller Stämme der Dakota und Lakota werden sich versammeln und wahrscheinlich auch einige unserer Vettern, der Cheyennes. Die Häuptlinge der Mdewakanton, der Wahpekute, der Sisseton, der Santee und Wahpeton werden kommen. Ebenso die der Yankton, der Yanktonai, der Hunkpapa, der Sihasapa, der Minneconjou, der Itazipco, der Brulé und Oglalla. Sicher auch die Brüder der Assiniboine und Stoney.“ Der Chief nickte zu seinen Worten. „Es wird ein wahrhaftig großes Pow Wow.“
„Ich wusste nicht, das euer Volk so viele Stämme hat“, gab von Trauenstein zu. „Ich habe auch noch nie von so einem großen Zusammentreffen gehört. Wenn sich so viele eurer Chiefs versammeln, dann geht es sicher um Dinge von großer Bedeutung.“
„Es geht um Krieg.“ Many Horses nippte an seiner Zitronenlimonade. „Nein, nicht darum, dass wir das Kriegsbeil ausgraben, mein weißer Freund. Doch die Weißen führen Krieg.“
„Ja, davon haben wir erfahren“, gestand von Trauenstein. „Der Norden kämpft gegen den Süden. Seit zwei Jahren und nun, im Jahre des Herrn 1863, sieht es nicht so aus, als fände dieser schreckliche Krieg ein baldiges Ende. Es ist eine Schande, dass sich dieses großartige Land im Bruderkrampf zerfleischen will. Doch gestatte mir die Frage, mein ehrenwerter roter Freund, was hat dies mit dem Volk der Sioux zu tun?“
„Der große weiße Vater in Washington ruft seine Soldaten zu sich. Die Späher der Stämme berichten, dass sie die Forts verlassen und nach Süden oder Osten gehen. Nur wenige bleiben an den Grenzen zu unseren Gebieten.“
„Ich weiß, dass es immer wieder Kämpfe zwischen dem roten und dem weißen Mann gegeben hat.“ Das Gesicht des Grafen wirkte betrübt. Er zuckte zusammen. „Unter euch gibt es viel Hass gegenüber dem weißen Mann.“
Many Horses nickte erneut. „Du brauchst dich nicht zu sorgen, Weißhaar. Du und die deinen, ihr steht unter dem Schutz von Many Horses. Kein roter Krieger wird die Hand gegen euch erheben.“
„Wir alle wissen, dass Chief Many Horses ein Mann von großer Ehre ist“, versicherte der Graf. „Doch du sagst, dass ich und die meinen uns nicht zu sorgen brauchen… Was ist jedoch mit den anderen Weißen?“
Many Horses zuckte mit den Schultern. „Es gibt Worte auf sprechendem Papier, die den Frieden vereinbaren. Die Stämme der Lakota und Dakota werden zu ihrem gegebenen Zeichen auf dem Papier stehen und den Frieden achten. Dennoch müssen wir beraten, was der Krieg der Weißen für uns bedeuten mag. Wir wollen wissen, ob sich die weißen Soldaten endgültig zurückziehen oder ob sie eines Tages wiederkehren.“
„Ja, das verstehe ich.“ Von Trauenstein hatte nur wenig Verständnis für das angespannte Verhältnis zwischen roten und weißen Amerikanern. Während die meisten Weißen die Indianer als gottlose Wilde betrachteten, hatten die Deutschen sie als faire Vertragspartner erlebt und fühlten sich im Land der Sioux sicher und heimisch. „Dies ist ein großes Land. Hier gibt es doch Raum genug für alle und ich verstehe nicht, warum man deswegen Kriege führt.“
„Ihr Weißen lebt anders, als wir Indianer. Ihr siedelt an einem festen Ort, betreibt Viehzucht und Ackerbau. Der rote Mann hingegen folgt dem Büffel.“ Many Horses hielt das geleerte Glas seinem Gastgeber hin und der Graf schenkte nach. „Der weiße Mann kommt in unser Land und nimmt sich, was ihm gefällt. Er gründet seine Städte und vertreibt den Büffel. Der Weiße breitet sich immer weiter aus, mein weißhaariger Freund, und was man ihm nicht bereitwillig überlässt, das nimmt er sich mit Gewalt. Dann gibt es Krieg mit seinen Soldaten, bis man Frieden macht und einen Vertrag schließt. Mit jedem Vertrag wird das Land des roten Mannes kleiner und das Land des weißen Mannes größer.“ Die Stimme des Chiefs klang bitter. „Doch der Hunger der Weißen ist nicht zu stillen. Viele von uns hoffen, dass sich die Weißen nun gegenseitig umbringen.“ Er sah sein Gegenüber forschend an. „Weißt du, mein weißhaariger Freund, warum die Weißen jetzt in den Krieg ziehen?“
„Nun, ich muss zugeben, dass ich es nicht wirklich weiß“, räumte von Trauenstein ein. „In der Zeitung steht, dass es schon seit vielen Jahren Differenzen zwischen den Staaten des Nordens und des Südens gibt. Es geht wohl um Leibeigene und Sklaven.“
„Leibeigene und Sklaven?“
„Das sind Menschen, die anderen Menschen gehören und ihnen dienen müssen.“
„Menschen, die Menschen gehören?“ Many Horses überlegte angestrengt. „Ah, ich verstehe. Gelegentlich haben wir gefangene Crows oder deren Weiber die für uns arbeiten müssen.“
„Es sind keine Gefangenen. Die meisten Sklaven sind wohl Neger, die von dem fernen Kontinent Afrika stammen oder hier geboren wurden. Es gibt wohl Märkte, auf denen man mit ihnen handelt. Äh, wie Pferde, denke ich.“ Von Trauenstein sah sich um und rief seine Tochter herbei. „Josefine kann es besser erklären, Chief. Sie interessiert sich mehr für solche Dinge, als ich.“
Die junge Frau kam zu ihnen und der Chief gab ihre mit einer Geste zu verstehen, dass sie sich setzen solle. Dies war eigentlich ein Gespräch unter Männern, doch der Häuptling war wissbegierig und bereit, den Ausführungen von Josefine zuzuhören.
Was sie zu sagen hatte, traf bei Many Horses auf Unverständnis. „Für diese Menschen wäre es besser, tot zu sein. Wir könnten nicht einmal in festen Häusern leben, da wir uns dann wie Gefangene fühlen würden, doch ihr Weißen legt die schwarzen Menschen auch noch in Ketten, zwingt sie zur Arbeit und handelt sie wie Pferde.“
„Mein Vater und ich halten nichts von Sklaverei oder Leibeigenschaft“, versicherte Josefine. „Und viele andere Menschen verurteilen sie ebenfalls. Deswegen führen der Norden und der Süden ja auch Krieg gegeneinander. Der Süden hält Sklaven und der Norden will sie befreien.“
Der Graf räusperte sich. „Kind, ich denke, so einfach ist es nicht. Auch im Norden gibt es Staaten, in denen Sklaven gehalten werden.“
Many Horses lachte leise. „Für euch sind schwarze Menschen wie Pferde. Wir führen keine Kriege wegen Pferden.“ Er lachte erneut. „Aber es bereitet uns Freude, in das Gebiet der Crows zu reiten, ihnen Pferde zu stehlen und bei der Gelegenheit auch ein paar Skalpe zu erbeuten.“
„So etwas ist barbarisch“, entfuhr es Josefine.
„Josefine!“, mahnte ihr Vater.
„Einen besiegten Feind zu verstümmeln ist barbarisch“, bekräftigte die junge Frau.
„Es ist ein Ritual, dass von unseren Vorfahren schon lange praktiziert wurde, bevor der erste von euch Weißen unser Land betrat.“ Many Horses erwiderte Josefines Blick. „Für uns ist es eine Trophäe und der Beweis für die Tapferkeit des Kriegers. Ihr Weißen hingegen bezahlt sogar für Skalpe. Wenigstens, wenn es die von Indianern sind.“
Graf von Trauenstein runzelte die Stirn, doch seine Tochter nickte. „Der Chief hat recht, Vater. In einer der älteren Zeitungen stand, dass man in Texas Prämien für Indianerskalpe bezahlt hat.“
„Nun, ich finde die rituellen Tänze unserer roten Freunde weitaus interessanter“, versuchte der Graf das Gespräch auf ein anderes Gebiet zu lenken. Die Deutschen fanden einige der Gebräuche der Sioux äußerst befremdlich und sogar barbarisch, doch sie lebten in Farrington, da die Indianer ihnen dies erlaubt hatten und fanden es daher unangemessen, die Indianer zu kritisieren.
„Bei dem großen Pow Wow wird es viele Tänze geben“, ging Many Horses auf den Gesprächswechsel ein. „Und viele Gespräche. Über die Weißen und ihren Krieg.“
„Auch bei uns spricht man über diesen Krieg, mein roter Freund. Glücklicherweise berührt er uns nicht. Farrington liegt weitab. Wir und unsere roten Freunde werden von den Wirren dieses Konfliktes verschont bleiben.“