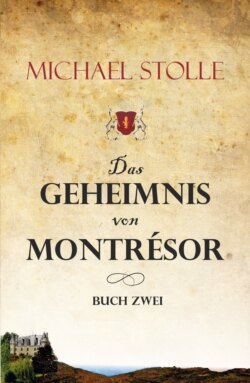Читать книгу Das Geheimnis von Montrésor - Michael Stolle - Страница 5
ОглавлениеBriefe für einen Kardinal
In der beeindruckenden Bibliothek war es heiß, sehr heiß.
Der elegante Besucher, der auf dem reich geschnitzten, aber eher unbequemen Stuhl saß, dachte darüber nach, dass es vielleicht kein Zufall war, dass das Vorzimmer eines hohen Fürsten der französischen Kirche so heiß war, wie ein Vorraum der Hölle. Sein Gastgeber, der mächtige Kardinal, Herzog von Richelieu, sah in seinem scharlachroten Gewand gebrechlich und kränklich aus. Sein goldenes Kreuz baumelte schwer von seinem Hals – eigentlich viel zu schwer, um von diesem zerbrechlichen Körper getragen zu werden. Aber die Fassade der Zerbrechlichkeit war nicht nur irreführend, sie konnte genauso gut nur einer seiner sorgfältig inszenierten Auftritte sein, denn die scharfsinnigen Augen des Kardinals waren wachsam wie immer als er den makellos gekleideten Marquis de Saint Paul betrachtete, der elegant vor ihm saß und sich von der intensiven Hitze, die von dem riesigen Kamin ausging, nicht irritieren ließ.
Richelieu fragte sich, warum sein Besucher darauf bestanden hatte, ihn zu einer Privataudienz zu ersuchen, wo doch normalerweise ein höflicher, aber nicht minder intensiver – und zuweilen gnadenloser – Krieg zwischen dem adligen Clan der Familie de Saint Paul und dem Premierminister von Frankreich tobte.
Richelieu hatte wichtige Dinge im Kopf; bald würde er einen Weg finden müssen, den jungen Favoriten des Königs, Cinq-Mars, vom königlichen Hof und – viel schwieriger – aus dem Herzen des Königs zu entfernen. Deshalb war er nicht allzu erpicht darauf, einen Kampf an einer zweiten Front zu eröffnen, aber warum sollte der Marquis sonst zu ihm kommen?
»Ich bin sehr erfreut, Eure Eminenz bei guter Gesundheit zu sehen«, log der Marquis schamlos.
Richelieus Augen blinzelten amüsiert; er hatte natürlich die Ironie der Aussage des Marquis erkannt.
»Das Gleiche gilt für mich, mein edelster Marquis«, antwortete Richelieu höflich und genauso verlogen. Er öffnete eine kostbare, mit emaillierten Ornamenten im orientalischen Stil verzierte Silberschatulle, die kandierte Kirschen enthielt und bot sie seinem Besucher an.
Der Marquis betrachtete misstrauisch die dunkelroten Kirschen, die im Licht der Kerzen verlockend glitzerten; höflich, aber bestimmt, lehnte er das Angebot ab.
Der Kardinal gluckste. »Sie waren schon immer ein sehr vorsichtiger Mann«, sagte er und tauchte seine krallenartigen Finger in die Schachtel. Mit großem Gusto wählte er das größte Exemplar. »Sie hätten wirklich eine probieren sollen! Ich bekomme sie direkt aus Italien. Selbst mein lieber Mazarin ist verrückt nach ihnen, aber er hat noch nicht herausfinden können, woher ich sie beziehe.«
Der Marquis lächelte nur und schüttelte höflich den Kopf, denn er erinnerte sich lebhaft an mehrere Fälle von tödlicher Lebensmittelvergiftung, die ahnungslose Feinde des Kardinals dahingerafft hatten, kurz nachdem sie von ihm bewirtet worden waren.
Kardinal Richelieu hatte die Augen geschlossen, als wolle er sich auf den intensiven Geschmack der delikaten Kirsche konzentrieren, doch nur Sekunden später richtete sich sein durchdringender Blick auf seinen Besucher und er setzte das Gespräch fort. »Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun könnte? Hat Ihr jüngster Sohn Armand beschlossen, Buße zu tun und in den Schoß unserer heiligen Mutter Kirche zurückzukehren? Möchten Sie, dass ich eine geeignete Stelle für ihn finde?«
Der Marquis schaute amüsiert. »Auch wenn Armand denselben christlichen Namen trägt wie Eure Eminenz, fürchte ich, dass seine Dienste der Kirche keinerlei Nutzen bringen würden – im Gegensatz zu den Ihren. Ich glaube, mein Sohn ist im Herzen ein Soldat.«
Der Marquis hielt inne, und als er Richelieu direkt in die Augen sah, beschloss er, dass es an der Zeit war, zum Grund seines Besuchs zu kommen. »Ich frage mich, ob Eure Eminenz mit Euren gegenwärtigen Sorgen nicht etwas Hilfe gebrauchen könnten?«, fuhr er vorsichtig fort.
Richelieu war überrascht; was führte sein Besucher im Schilde – war eines seiner normalerweise gut gehüteten Geheimnisse durchgesickert? Der Marquis war eine Macht, mit der man rechnen musste. Doch der Kardinal blieb äußerlich gelassen und antwortete: »Bereiten Sie sich auf den Eintritt in den Himmel vor, mein lieber Marquis – Sie scheinen wohltätig zu werden?«, fragte er höflich, wobei nur ein leichtes Hochziehen der Augenbrauen andeutete, für wie unwahrscheinlich er diese Möglichkeit einschätzte.
»Ich fürchte, ich würde mich dort oben ziemlich einsam fühlen, ich würde unter anderem die Gesellschaft Eurer Eminenz vermissen – und ich hoffe, es ist noch ein bisschen zu früh, um dorthin zu gehen«, erwiderte der Marquis, fuhr dann aber mit einem versöhnlichen Lächeln fort. »Nein, ich muss gestehen, dass meine Motive eigentlich mit profaneren Dingen verbunden sind. Ich möchte Ihrer Eminenz eine Spende anbieten – etwas viel Wertvolleres als Geld – im Namen von Pierre de Beauvoir.«
Der Marquis hielt inne, aber es war unmöglich, die Gedanken des Kardinals zu lesen. Richelieus Gesicht war zu einer höflichen, aber völlig unverbindlichen Maske erstarrt.
Der Marquis fuhr fort. »Ich denke, dass es in der Vergangenheit einige unglückliche … nennen wir sie … Missverständnisse gegeben hat, die endlich geklärt und beseitigt werden sollten. Ich weiß, dass Sie derzeit wichtige Themen auf dem Herzen haben und denke, dass wir uns zum Wohle Frankreichs auf diese konzentrieren sollten, anstatt alte Schlachten auszutragen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass Eure Eminenz den Anspruch des gegenwärtigen Marquis de Beauvoir endgültig anerkennt – wie es seine Majestät gnädigerweise bereits getan hat – werde ich Ihrer Sache mit einigen recht interessanten Dokumenten zu helfen können.«
Während er weiter sprach, holte der Marquis einige Briefe aus seiner Weste und überreichte sie dem Kardinal. »Diese Briefe sind nur Kopien, aber wenn Eure Eminenz einer Vereinbarung zustimmt, werde ich veranlassen, dass Ihnen die Originale übergeben werden«, erklärte er sachlich.
Richelieu überflog schnell den Inhalt des ersten Briefes und obwohl er ein Meister darin war, ein Pokergesicht zu machen, konnte er seine Zufriedenheit nicht verbergen. Die Briefe enthielten eine ausdrückliche Einladung von Monsieur de Cinq-Mars an seine Freunde, sich dem Kampf gegen Kardinal Richelieu anzuschließen – und die Rebellion im Namen von König Philipp IV. von Spanien zu unterstützen.
Richelieu war über den Inhalt nicht schockiert – was hätte man von einem solchen politischen Dilettanten auch anderes erwarten können – aber er war erstaunt, wie dumm manche Menschen sein konnten. Diese Briefe waren nichts anderes als ein direkter Weg zum Block des Scharfrichters. Schnell überflog er zwei weitere Briefe – einer schien noch hirnloser und kompromittierender zu sein als der andere. Ein kurzes Lächeln huschte über das Gesicht des Kardinals: Diese Dokumente würden es ihm ermöglichen aufzuräumen und das Unkraut auszureißen, das während seiner längeren Krankheit am Hof des Königs Wurzeln geschlagen hatte – es lag nun an ihm, den besten Zeitpunkt zu bestimmen, um sein Blatt auszuspielen.
Diese Briefe waren ein Vermögen wert, ein wahrhaft edles Geschenk.
»Mein edelster Marquis, Sie haben immer wieder die Fähigkeit, mich zu verblüffen«, sagte der Kardinal mit einem seiner seltenen Lächeln. »Ich denke, wir haben eine Vereinbarung. Ich werde gerne den Marquis de Beauvoir in einer offiziellen Audienz empfangen und ihn öffentlich anerkennen, sobald die Originale dieser Briefe ihren Weg – sagen wir mal, auf wundersame Weise – auf meinen Schreibtisch gefunden haben.«
Das Lächeln blitzte noch einmal über seine dünnen Lippen. »Übrigens werde ich sofort anordnen, dass das Verfahren vor den Kirchengerichten, das Sie und ihre Mittelsmänner so eifrig verzögert haben, eingestellt wird«, und dem Marquis ein Zeichen gebend, dass er schweigen solle, während er versuchte, Protest einzulegen, fügte er hinzu, »natürlich war das nichts weiter als ein unglückliches Unterfangen einiger äußerst eifriger, aber im Grunde inkompetenter Beamter.«
Der Marquis erwiderte das Lächeln. Richelieu fraß ihm aus der Hand – wie er es vorausgesagt hatte, als er die Idee dieses Treffens im Vorfeld mit seiner Frau besprochen hatte. Es gab allerdings noch einen letzten Punkt, der geklärt werden musste, und er räusperte sich. »Was ist mit den fehlenden Besitztümern von Pierre de Beauvoir, werden die ihm zurückgegeben?«
»Mein lieber Marquis, Sie und ich wissen aus trauriger Erfahrung, dass Ehrlichkeit und Diplomatie nicht immer gut zusammenpassen, aber ich muss gestehen, dass ich dieses Mal wirklich keine Ahnung habe, wovon Sie sprechen! Wenn irgendetwas fehlen sollte, fürchte ich, dass es sein Cousin Henri de Beauvoir ist, bei dem man suchen sollte – mein Ruf mag in manchen Kreisen nicht der Beste sein, aber ich kann Ihnen versichern, mein edelster Marquis, dass ich kein Dieb bin.«
Der Kardinal hob seine knochige Hand mit dem goldenen Ring und erstickte damit jegliche Beteuerungen des Marquis, er sei missverstanden worden. Doch der Marquis de Saint Paul erkannte, dass er entlassen worden war, und empfand die Überraschung des Kardinals über seine letzte Bemerkung als echt genug. Sie würden also anderswo nach Pierres Diamantring suchen müssen; Richelieu schien – ausnahmsweise – nicht involviert zu sein. Da der Ring einer der Schlüssel zum Auffinden des verborgenen Schatzes war, war das keine gute Nachricht für Pierre.
Der Marquis ging zurück zu seiner wartenden Kutsche, tief in Gedanken versunken. Er musste dringend mit den Bankiers der Familie sprechen, da er von Pierres Dienern wusste, dass Henri de Beauvoir nicht in der Lage gewesen war, den Ring zu entwenden. Sie konnten nicht länger warten, nun, nachdem der mächtige Kardinal Richelieu einen Waffenstillstand akzeptiert hatte.
Jetzt mussten Pierre de Beauvoir und sein Sohn Armand ihren Teil der Abmachung erfüllen und die drei antiken Ringe wieder zusammenführen, die der Schlüssel zu dem uralten Schatz waren, denn das hatten sie der Bruderschaft der Tempelritter versprochen. Dazu mussten sie allerdings zuerst den Diamantring finden und in ihren Besitz bringen. Wenn der Ring wirklich gestohlen worden war – und der Kardinal Richelieu ausnahmsweise mal nicht involviert war -, deuteten alle Spuren auf Kardinal Mazarin hin, einen ebenso mächtigen Feind wie Richelieu.
Wie sagte man so schön … vom Regen in die Traufe …
Der Marquis seufzte.
***
Der Marquis de Saint Paul atmete tief ein. Die rauchgeschwängerte Dunstglocke der Pariser Winterluft war seit ein paar Tagen einem sanften Südwind gewichen, der die Düfte und Verheißungen von Sonne, frischem Grün und Blumen in sich trug. Die Bäume der königlichen Louvre-Gärten standen in voller Blüte und bildeten einen passenden Rahmen für die fröhlich plätschernden Springbrunnen. Der Marquis bedauerte zutiefst, dass er in seiner stickigen Kutsche sitzen musste, umgeben von einer kleinen Armee livrierter Lakaien. Sein hoher Rang gebot es aber, das Protokoll zu respektieren, und außerdem wäre es töricht gewesen, in Paris ein Risiko einzugehen. Es gab daher keine Gelegenheit für ihn, auf dem Pferd zu reiten und die Sonne zu genießen.
Der Marquis beschloss, den Befehl zu geben, direkt zum Palais de Beauvoir zu fahren, wo ein äußerst neugieriger Pierre de Beauvoir auf ihn wartete, und er würde ein Vermögen darauf wetten, dort auch seinen Sohn anzutreffen – die beiden waren unzertrennlich. Der Marquis lächelte und das warme Lächeln verwandelte sein hochmütiges Gesicht. Er würde es Armand nie gestehen, aber er hatte ihn immer als seinen Lieblingssohn betrachtet.
Der Marquis hatte richtig geraten. Pierre und Armand warteten schon in einem der zahlreichen Salons, beide sichtbar gelangweilt. Sie sprangen von ihren Stühlen auf, um den Marquis de Saint Paul mit dem gebotenen Anstand zu begrüßen. Pierre schaute ihn an, seine blauen Augen einziges Fragezeichen.
»Willkommen, lieber Vater, Sie sehen aus wie eine Katze, die einen ganzen Teller Rahm geschleckt hat«, rief Armand respektlos aus. »Ich nehme also an, dass Ihre Mission erfolgreich war?«
Der Marquis warf seinem Sohn einen strengen Blick zu – er achtete stets peinlich genau auf Etikette und erwartete, dass seine Kinder dies auch taten. »Würde es dir etwas ausmachen, deinem Vater etwas mehr Respekt zu erweisen, mein lieber Sohn oder mir könnten ansonsten einige wichtige Aufgaben für dich einfallen. Da wäre unter anderem unser Schloss, weit entfernt in der Bretagne, das deine dringende und langwierige Aufmerksamkeit benötigen könnte.«
»Es tut mir leid, liebster Vater, ich verspreche, mich zu bessern und Buße zu tun«, antwortete Armand, aber seine lachenden Augen widersprachen seinen demütigen Worten.
»Ja, ich bringe gute Nachrichten. Der Kardinal ist jetzt unser bester Freund, er konnte seine Genugtuung kaum verbergen, als ich ihm die Briefe zu lesen gab. Meine persönliche Empfehlung ist daher: Solltet Ihr mit Monsieur Cinq-Mars Karten spielen, bittet ihn besser sofort zur Kasse. Ich ahne irgendwie, dass er früher oder später seinen hübschen, aber leider dummen Kopf verlieren wird – eher früher als später.«
Der Marquis bediente sich mit einem Glas Wein, dann fuhr er fort. »Unsere kleine Vereinbarung wird Pierres Zukunft als Marquis de Beauvoir ein für alle Mal regeln. Ich bin also sehr zufrieden mit dem Ergebnis meines Gesprächs mit Seiner Eminenz. Was mich jedoch sehr verwundert, ist, dass der Kardinal aufrichtig überrascht zu sein schien, als ich andeutete, dass eventuell Besitztümer verschwunden sind. Pierre, wir müssen uns dringend mit der Bank, sprich Monsieur Piccolin treffen, um Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Wisst ihr, ob er inzwischen zurückgekehrt ist?«
»Lassen Sie mich Ihnen zuerst von ganzem Herzen danken, Monsieur le Marquis«, rief Pierre aus und mit Tränen in den Augen eilte er nach vorn, um die Hand des Marquis zu ergreifen und sie kräftig zu schütteln. »Ich bin voller Bewunderung und verstehe wirklich nicht, warum Sie so viel von Ihrer wertvollen Zeit und Energie für mich aufwenden. Wie kann ich Sie jemals dafür entlohnen? Ich stehe tief und ewig in Ihrer Schuld!«
Der Marquis sah ihn überrascht an, in der Familie der Saint Paul war es nicht üblich, Gefühle zu zeigen.
Armand bemerkte das Unbehagen seines Vaters und breit grinsend antwortete er an seiner Stelle: »Mein Vater ist einfach nur dankbar, dass du es mit mir aushältst, das ist ihm die Mühe wert.«
Der Marquis warf seinem Sohn einen strengen Blick zu. Er fand diese flapsige Bemerkung nicht besonders lustig. »Du bist unmöglich, Armand«, sagte er schroff.
»Ja, Vater, und ich verspreche demütigst, dass ich jetzt den Mund halten werde. Schließlich will ich nicht in der Bretagne versauern«, versprach Armand, erschien aber nicht besonders eingeschüchtert von der Drohung seines Vaters.
So sehr Pierre auch erleichtert war, dass Kardinal Richelieu endlich Frieden schließen wollte, so wurde ihm doch unangenehm bewusst, dass er sich neuen Aufgaben stellen musste.
Armand und er hatten keinerlei Ausreden mehr, sie waren jetzt verpflichtet, ihren Teil der ursprünglichen Abmachung zu erfüllen und diese verfluchten Ringe zu finden. Tief in Gedanken versunken betrachtete er den Rubinring, den er trug, seit er in die Fußstapfen seines Großvaters getreten war. Der dunkelrote Stein schien zu schlafen, nur wenn Pierre den Stein in die Nähe einer Kerze oder in die Sonne bewegte, erwachte er und blitzte wütend in der Farbe dunklen Blutes. Was für ein Geheimnis bewahrte dieser Ring?
»Das stimmt, wir müssen mit Monsieur Piccolin sprechen, nur er kann uns helfen, den Diamantring zu finden«, sagte Pierre laut.
»Ich bin ganz Eurer Meinung«, kommentierte Armand. »Nur schade, dass der Schlüssel zum Diamantring von einem ehrenwerten alten Mann und nicht von einer schönen jungen Dame gehalten wird. Meine Talente werden eindeutig vergeudet!«
Zwei Tage später überbrachte ein junger Diener die Nachricht, dass der ehrenwerte Monsieur Piccolin um die Gunst eines dringenden Termins bat. So versammelten sich die beiden Freunde, begleitet von Armands Vater, neugierig in einem geräumigen und frisch renovierten Salon des Palais de Beauvoir. Über dem Marmorkamin prangten stolz die Porträts von Pierres Eltern.
Der alte Bankier war pünktlich erschienen, was im dichten Pariser Verkehr nicht leicht zu bewerkstelligen war. Er zögerte kurz, wen er zuerst begrüßen sollte, da Pierre – da er nicht nur ein Marquis, sondern auch ein Herzog war – von höherem Rang war, aber der Marquis de Saint Paul war zweifellos von höherem Rang in Frankreich und hatte viel mehr Einfluss. Er beschloss, sich zuerst vor dem Marquis de Saint Paul zu verbeugen, was sich als die richtige Entscheidung erwies, da der Marquis es nicht zu schätzen gewusst hätte, im Rang unter Pierre zu stehen.
Nachdem er seine ausführliche Begrüßung beendet hatte, nahm Piccolin mit einem zufriedenen Seufzer die Einladung an, Platz zu nehmen. Dann wandte er sich in seinem angenehmen italienischen Akzent förmlich an die drei Männer, die ihn erwartungsvoll ansahen.
»Mein höchst ehrenwerter Marquis, Euer Gnaden, Eure Lordschaft! Lassen Sie mich zunächst meine tiefste Freude und Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, dass der Sohn des verstorbenen Marquis de Beauvoir – endlich – seinen rechtmäßigen Platz einnehmen konnte und dass er über seine Feinde triumphiert hat. Meine Familie und unsere Bank haben alles getan, was möglich war, um das Familienvermögen und die Schätze zu sichern, die uns der verstorbene Marquis anvertraut hatte. Lassen Sie mich in aller Bescheidenheit erwähnen, dass sich diese Aufgabe als schwieriger erwies, als wir erwartet hatten, da wir unter starkem Druck seitens einiger Mitglieder der Familie de Beauvoir standen. Manchmal kam mir fast der Gedanke, dass einige von diesen Verwandten vielleicht sogar den Wunsch hegten, den natürlichen Lauf Ihres Erbes zu ihren Gunsten zu ändern.«
Er hielt kurz inne, um die Wirkung seiner kleinen Rede abzuschätzen, aber Pierre gelang es, eine undurchdringliche Miene zu bewahren, obwohl er verstand, dass die letzte Bemerkung auf seinen Cousin Henri gemünzt war.
Der alte Bankier fuhr fort: »Aber da wir die Ehre und das Privileg haben, der Familie Euer Gnaden schon seit mehreren Generationen zu dienen, waren natürlich alle unsere Bemühungen darauf gerichtet, die Interessen des wahren Erben zu verteidigen. Heute bin ich glücklich und stolz, bestätigen zu können, dass Euer Gnaden, sobald alle Dokumente unterzeichnet und besiegelt sind, vollen Zugriff auf das Familienvermögen haben werden, das sich in unserer Obhut befindet.«
Pierre anstrahlend fügte er hinzu: »Und natürlich wäre es uns eine große Freude, Euer Gnaden und der Familie de Beauvoir weiterhin zu Diensten sein zu dürfen, falls dies der Wunsch Eurer Gnaden sein sollte.«
Der Marquis de Saint Paul hielt es für an der Zeit, den blumigen Wortschwall zu stoppen. »Sind Sie sicher, dass Sie von allen Schätzen sprechen, die bei Ihrer Bank deponiert waren?«
»Darf ich Eure Lordschaft fragen, warum Ihr diese Frage stellt?« Der Bankier hob leicht seine Augenbrauen, als er die Frage stellte.
»Monsieur Piccolin, ohne weitere Umschweife, wir haben die Information erhalten, dass Seine Eminenz, der Kardinal Mazarin, vor einigen Wochen versucht hat, in dieses Haus einzudringen und alle Schätze zu beschlagnahmen.«
Die Stimme des Marquis de Saint Paul nahm nun eine entschiedene Schärfe an. »Und – was zugegebenermaßen am beunruhigendsten ist – als wir Ihren Sohn vor vierzehn Tagen trafen, weigerte er sich, uns eine klare Antwort über die Handlungen des Kardinals Mazarin zu geben. Bitte bestätigen Sie uns, dass kein einziger Gegenstand an ihn übergeben wurde – und damit meine ich insbesondere den berühmten Diamantring, der seit Jahrhunderten zum Erbe der Familie de Beauvoir gehört!«
Die Stimme des Marquis klang kalt, er war kein Liebhaber von Versteckspielen.
Er hatte eigentlich erwartet, Monsieur Piccolin, nach dieser Aussprache als Nervenbündel vorzufinden, aber der Bankier lächelte nur verschmitzt und antwortete: »Wenn Sie gestatten, mein edler Marquis, habe auch ich meine kleinen Geheimnisse. Geheimnisse, die ich nicht einmal meinem Sohn anzuvertrauen wagte. Bitte versprechen Sie mir, dass unser Gespräch streng vertraulich behandelt wird – ich muss leider sogar darum bitten, dass Ihr Sohn den Raum verlässt, denn was ich Ihnen zu sagen habe, ist nur den Ohren der Betroffenen vorbehalten.«
Pierre fand es an der Zeit, sich in dieses Gespräch einzumischen, das eine seltsame Wendung nahm. »Es kommt nicht infrage, dass Armand diesen Raum verlässt; seine Geheimnisse sind meine und umgekehrt. Sie dürfen aber darauf vertrauen, dass wir nichts verraten werden.«
Monsieur Piccolin sah die beiden jungen Männer skeptisch an. Das Konzept, volles Vertrauen zu haben, schien nicht zur Einstellung eines Bankiers zu gehören, aber schließlich gab er nach. »Seine Eminenz, der Kardinal Mazarin, hat tatsächlich unsere Büros besucht. Sein Ultimatum war klar: Entweder wir übergaben die de Beauvoir-Schätze in seine Obhut, oder er würde dafür sorgen, dass meiner Bank die Lizenz entzogen würde – was bedeutet, dass unsere Bank geschlossen würde.«
»Das ist schon ziemlich unverschämt«, kommentierte Armand aufgebracht. »Wie haben Sie auf diese Herausforderung geantwortet?«
»Er hatte mit meinem Sohn gesprochen, der sich natürlich große Sorgen machte. Es kam natürlich nicht infrage, das Vertrauen eines unserer Kunden zu missbrauchen – aber wir alle wissen, dass der Kardinal Mazarin höchstwahrscheinlich der nächste Premierminister wird …«
»Kurzum, Sie mussten zwischen Ihrer Ehre und der Zukunft Ihrer Bank wählen. Sagen Sie uns also, wie Sie sich entschieden haben?«, fragte der Marquis.
»Da wir italienischer Herkunft sind, sind wir mit einem besonderen Sinn für Ehre und Stolz aufgewachsen – aber auch mit einem ausgeprägten Sinn für Flexibilität. Es ist in ganz Frankreich bekannt, dass der Kardinal ein leidenschaftlicher Liebhaber von Diamanten ist – ich vermutete daher, dass diese Geschichte von der sicheren Verwahrung nur ein Vorwand und ein fast verzweifelter Versuch war, den berühmten de Beauvoir-Ring zu erwerben, einen Ring, den der verstorbene Marquis an unsere Bank verpfändet hatte, als er dringend eine große Geldsumme benötigte.«
»Sie meinen, der Ring gehörte in Wirklichkeit der Bank und nicht mir?«, warf Pierre, völlig verblüfft, ein.
Der Bankier fummelte an seiner Weste und holte vorsichtig ein Dokument hervor, das mit dem Siegel des Marquis de Beauvoir und einer majestätischen Unterschrift versehen war. Er reichte es dem Marquis, der es sorgfältig überprüfte und an Pierre weiterreichte. Darin wurde ein Darlehen über eine bedeutende Geldsumme gewährt und die darin enthaltende Beschreibung des Diamantrings, der für den Fall verpfändet wurde, dass das Darlehen nicht zurückgezahlt werden konnte, passte perfekt – sie erwähnte sogar die geheimnisvollen Gravuren.
Der Raum lag plötzlich in völliger Stille.
»Was, in Gottes Namen, haben sie dann entschieden?«, fragte Pierre mit heiserer Stimme.