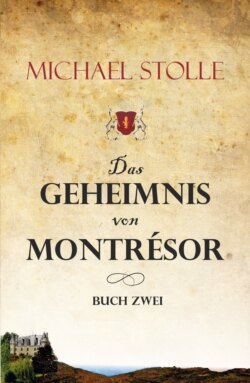Читать книгу Das Geheimnis von Montrésor - Michael Stolle - Страница 7
ОглавлениеDer Diamantring
»Also, wie haben Sie sich entschieden?«, donnerte die tiefe Stimme des Marquis de Saint Paul durch den stillen Raum.
Der alte Bankier lächelte unbeirrt und fuhr mit seiner wohlklingenden Stimme fort: »Was konnte ich anderes tun, als ihm zu geben, was er wollte?«, antwortete er schlicht.
Armand sprang wütend von seinem Stuhl auf, aber Monsieur Piccolin gab ihm ein Zeichen, sich zu beruhigen.
»Gemach, gemach, hören Sie zu, Monsieur«, antwortete er mit plötzlich kraftvoller und autoritärer Stimme. Jetzt verstanden alle, warum dieser nette, sanftmütige Herr das Oberhaupt einer Bank war, die den Reichen und Berühmten diente. »Schwört einen feierlichen Eid, dass das Geheimnis, das ich jetzt mit euch teilen werde, niemals verraten wird. Es darf nur eine Ausnahme von dieser Regel geben – der Großmeister der Templer!«
Drei Paare schockierter Augen richteten sich auf den alten Bankier – woher konnte er wissen, dass dieser Ring der Bruderschaft versprochen worden war? Armand und Pierre nickten zustimmend und auch der Marquis de Saint Paul, der immer noch versuchte, diese plötzliche Enthüllung zu verdauen, gab nach und akzeptierte.
»Ich hielt es für das Beste – für mich und für Sie, meine Herren – Seiner Eminenz den begehrten Diamantring zu schenken, aber – und ich bestehe darauf, dass dies unter uns bleiben muss – ich habe den Ring Eurer Gnaden kopieren lassen, bevor ich ihn ihm gegeben habe.«
Und mit einem breiten Lächeln und der Geschicklichkeit eines Magiers packte er ein kleines Samtpäckchen aus und entnahm zur großen Überraschung der drei Anwesenden den Ring, den Pierres Vorfahren seit Generationen gehütet hatten.
»Dies ist der echte Ring, der aus dem Königreich Jerusalem stammt und von Generationen der Vorfahren Eurer Gnaden getragen wurde – hüten Sie ihn gut!«
Pierre nahm den Ring mit zitternden Händen entgegen. Er fühlte sich plötzlich demütig. Der Diamant schien eine überirdische Kraft auszustrahlen – die Sonnenstrahlen hatten ihn zum Leben erweckt und er sandte kräftige, fast zornige Blitze aus, zufrieden, endlich der Dunkelheit seines samtenen Gefängnisses entkommen zu sein.
Mit größter Sorgfalt zog Pierre den Rubinring seines Großvaters mütterlicherseits von seinem Finger und legte die beiden Ringe nebeneinander. Es wurde nun offensichtlich, dass die seltsame Form der goldenen Fassungen eine Einheit bildete und es wurde auch klar, dass die Gravuren zusammengehörten – sie ergänzten sich perfekt. Aber es blieb unmöglich, die seltsame Gravur zu entziffern. Ohne den dritten Ring konnte das Rätsel nicht gelöst werden.
Pierre betrachtete den Ring mit Ehrfurcht. »Sie sind sicher, das ist wirklich das Original?«, hauchte er.
»Ja, ich schwöre es beim Leben meiner Kinder und bei meiner Ehre – und«, er strahlte vor Stolz, »ich kann Ihnen versichern, dass es mich mehrere Tage und beste Verbindungen gekostet hat, um in Frankreich einen Diamanten gleicher Qualität zu finden. Kardinal Mazarin mag zwar gierig sein, aber er ist kein Narr und er ist ein anerkannter Experte. Ich hätte ihn niemals überzeugen können, wenn der Diamant seiner Kopie etwas anderes als erstklassig gewesen wäre.«
Monsieur Piccolin versuchte vergeblich, bescheiden zu wirken, aber es war klar, dass er sehr stolz auf sich war.
Pierre verdaute noch diese Geschichte, als ihm ein anderer Aspekt dämmerte.
»Ich bin Ihnen wirklich dankbar, Monsieur Piccolin, dankbarer als ich es mit Worten ausdrücken kann. Sie haben uns heute gelehrt, an den Anstand zu glauben und nicht jede Geschichte für bare Münze zu nehmen. Aber Ihre edle Tat bedeutet, dass ich Ihnen nicht nur zu großem Dank verpflichtet bin, sondern ein Vermögen schulde! Ich meine, wenn ich es richtig verstehe, hatte mein Vater nie die Möglichkeit, sein Darlehen zurückzuzahlen und nun haben Sie für mich einen zweiten Diamanten von unglaublichem Wert gekauft und vorgelegt! Es ist mir eine Verpflichtung, meine Schulden zu begleichen, aber so viel Geld aufzutreiben, wird einige Zeit brauchen!«
Monsieur Piccolin war sichtlich gerührt und er musste sich räuspern, bevor er antworten konnte. »Euer Gnaden, es war mir ein wahres Vergnügen, dem neuen Marquis de Beauvoir als Oberhaupt einer Familie zu dienen, die uns seit Generationen mit ihrem Vertrauen beehrt – und ich muss gestehen, dass es für mich auch eine persönliche Genugtuung war, einen unverschämten Fuchs wie Kardinal Mazarin zu überlisten. Sein Ultimatum, das Vertrauen eines Kunden zu verraten oder meine Bank schließen zu lassen, gefiel mir ganz und gar nicht. Das ging eindeutig zu weit.«
Der Bankier nahm seine Brille ab und begann sie energisch zu polieren, bevor er mit leiser Stimme hinzufügte: »Aber lassen Sie uns diese Angelegenheit abschließen, der Kardinal ist glücklich und Euer Gnaden ist im Besitz des Ringes, der rechtmäßig der Familie de Beauvoir gehört.«
Dann räusperte er sich und fuhr fort. »Tatsächlich sollte ich gestehen, dass ich zufällig weiß, warum Euer Gnaden den Ring dringend benötigt – und warum Sie und ihr Freund Armand de Saint Paul gezwungen sein werdet, Frankreich in Kürze zu verlassen, um den dritten Ring zu finden.«
Er hielt noch einmal inne und nahm das Glas Wein, das Armand ihm angeboten hatte, gerne an. Pierre sah Armand an und sie tauschten verwirrte Blicke aus. Dieses Treffen steckte tatsächlich voller Überraschungen.
Als der Bankier das Glas Wein nahm, bewegte er seine Hand und zum ersten Mal erkannten sie die Bedeutung des Siegels des goldenen Rings, den Piccolin heute zu tragen gewählt hatte. Vom Alter gezeichnet zeigte er ein eigenartiges Wappen, das zwei Ritter zeigte, die gemeinsam auf einem Pferd saßen – das Wappen der Templer.
»Es gibt keinen Grund, mir das Geld sofort zurückzuzahlen. Ich weiß, dass Ihr Vater das Geld, das wir ihm geliehen haben, in ein Unternehmen in den neuen Kolonien investiert hat und ich weiß – nicht ganz zufällig, dass dieses Geld gut angelegt war.«
Er gluckste. »Aber in Wirklichkeit wird der Kardinal selbst für beide Ringe zahlen, ich habe ihm meinen Preis schon genannt. Daher werde ich Ihnen gerne diesen Ring als Geschenk überreichen; bitte nehmen Sie ihn auch als Zeichen der Verbundenheit meiner Familie mit der Sache der de Beauvoirs an.«
Pierre betrachtete den Ring: Dies war ein königliches Geschenk. Kurzentschlossen ignorierte Pierre die Regeln des Protokolls und seines hohen Ranges. Es war an der Zeit, das Herz sprechen zu lassen.
Und so kam es, dass Seine Gnaden, der Herzog von Hertford, der edle Marquis de Beauvoir, ein Peer von Frankreich und des Königreichs Großbritannien, aufsprang, zu dem Bankier eilte und den alten Mann umarmte, als wäre er ihm ebenbürtig und ein Mitglied seiner eigenen Familie.
Monsieur Piccolin war ebenso fassungslos wie der Marquis de Saint Paul. Noch Jahre später konnte der Bankier nur mit Tränen in den Augen seiner eigenen Familie von dieser Szene erzählen. Für ihn waren Pierres Wertschätzung und Dankbarkeit weit mehr wert gewesen als zwei Diamantringe.
Er versuchte, seine Fassung wiederzuerlangen, und sagte: »Ich freue mich, dass Sie meine bescheidenen Dienste zu schätzen wissen. Ich fühle mich wahrlich geehrt, Euer Gnaden. Ich weiß, dass Ihr bald nach Venedig aufbrechen müsst, um den dritten Ring zu finden. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen und Ihrem Freund in dieser Hinsicht zu helfen.«
Armand, der bis jetzt ungewöhnlich ruhig gewesen war, meldete sich:
»Das war sehr edel von Ihnen, Monsieur. Auch ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken. Wir müssen unsere Reise planen und es wäre uns eine Ehre, wenn Sie morgen zum Abendessen kommen könnten. Sie scheinen mit unserer Mission erstaunlich vertraut zu sein – und ich schätze, dass Sie uns wertvolle Hilfe leisten können.«
Er lächelte den Bankier an, der sichtlich erfreut zurücklächelte.
»Ich nehme gerne an«, strahlte der alte Bankier. »Ich bin überzeugt, ich kann Ihnen bei dem Vorhaben behilflich sein, Messieurs. Die meisten Leute denken immer, dass eine Bank nur Geld verleiht, aber glauben Sie mir, der größte Teil unserer Arbeit – unser wahres Vermögen – besteht darin, Informationen zu sammeln und sie zu nutzen – nicht unähnlich unserem derzeitigen Premierminister. Er würde übrigens einen exzellenten Banker abgeben – vielleicht nicht immer vertrauenswürdig genug. Aber diese Aussage trifft auf die meisten Politiker zu, denke ich.«
Er kicherte über seinen Scherz und verbeugte sich tief, wobei er sorgfältig darauf achtete, sich noch ein wenig tiefer vor dem Marquis de Saint Paul zu verbeugen, der diese Geste mit Genugtuung bemerkte, und verabschiedete sich.
Der Bankier hatte bereits den Raum verlassen, doch es herrschte noch absolute Stille im Raum. Die drei Männer waren fassungslos.
Armand war es, der die Stille unterbrach.
»Das ist doch unfassbar! Wir haben überall nach diesem verfluchten Diamantring gesucht. Alles war so geheim, dass wir alle ständig nur in Andeutungen geredet haben, aber während dieser gesamten Zeit hat dieser Mann mehr Wissen über die ganze Geschichte gehabt als wir drei zusammen. Ich fühle mich irgendwie blöde – aber gleichzeitig bin ich mehr als erleichtert. Ich hatte mir schon ausgemalt, wie ich in Mazarins Palast einbreche und versuchte, eine passende Ausrede für den Moment zu finden, in dem er mich in seinem Schlafzimmer beim Durchwühlen seiner riesigen Sammlung von Juwelen erwischt. Hätte ich ihm erklären sollen, dass Kleptomanie leider eine leichte Charakterschwäche unserer Familie ist?«
Armands anschauliches Bild brach das Eis und Pierre musste lachen; selbst der Marquis erlaubte sich ein dünnes Lächeln, obwohl ihm sicherlich der Gedanke nicht gefiel, den erhabenen Namen de Saint Paul mit kleptomanischen Neigungen in Verbindung zu bringen.
»Dann lasst uns weiter über eure Mission sprechen«, erinnerte der Marquis die beiden Freunde.
»Wir wissen jetzt, dass der dritte Ring das Rätsel der Gravuren entschlüsseln und euch logischerweise zum verborgenen Schatz führen kann. Da sogar unser Bankier zu wissen scheint, dass sich der dritte Ring in Venedig befindet, müssen wir eure Reise in den Süden planen. Die Templer haben ihren Teil der Abmachung eingehalten, ihr müsst nun euren einhalten.«
»Das ist offensichtlich, es ist nicht nötig, uns daran zu erinnern, Vater«, sagte Armand. »Pierre und ich sind bereit zum Aufbruch. Morgen kann es gerne losgehen.«
»Das kann ich mir gut vorstellen!«, erwiderte der Marquis säuerlich. »Immer bereit für ein Abenteuer, aber dabei vergessen, dass ein solches Unterfangen sorgfältige Planung erfordert. Ihr seid nicht mehr zwei Jungs aus der Klosterschule. Eure Reise muss organisiert werden, ihr müsst von Wachen begleitet werden – und ich bin auch der Meinung, dass Pierre zuerst seine Ländereien an der Loire besuchen sollte. Sie werden nach Jahren der Vernachlässigung in einem erbärmlichen Zustand sein. Ich bin überzeugt, dass Pierres Onkel und dein Cousin alles nur Erdenkliche versucht haben, um das Anwesen leerzusaugen. Pierre hat jetzt Pflichten, er kann nicht einfach zu seinem nächsten Abenteuer aufbrechen.«
Beide jungen Männer sahen den Marquis kleinlaut an. Er hatte natürlich recht – das wurde zu einer lästigen Angewohnheit.
»Ich kann Ihren Worten nur zustimmen, Monsieur«, antwortete Pierre. »Glücklicherweise befinden sich meine Ländereien südlich von Paris. Wir werden also zuerst zu meinem Schloss Montrésor an der Loire reiten und erst dann in den Süden weiterziehen. Aber danach möchte ich vorschlagen, dass Armand und ich Frankreich inkognito verlassen und auf eigene Faust reisen. Wenn wir im Stil eines Marquis oder Herzogs nach Venedig reisen, wird unsere Mission offiziell sein und der Preis des Rings – falls er zum Verkauf steht – wird in schwindelerregende Höhen schnellen. Sollte der Ring nicht zum Verkauf stehen, werden wir Wege finden müssen, ihn uns anders anzueignen. Dann könnte es einen Skandal, schlimmstenfalls sogar diplomatische Komplikationen geben. Ich bin der Meinung, dass wir sehr diskret vorgehen müssen, wenn unsere Mission erfolgreich sein soll.«
Der Marquis blickte Pierre an und dachte über die Argumente nach, die Pierre sehr überzeugend vorgetragen hatte. Sein Gesicht verriet, dass er den Gedanken hasste, dass sie noch einmal wie Abenteurer reisen würden, aber widerwillig musste er der Logik von Pierres Argumentation zustimmen.
»Wenn man Pierre so ansieht, würde man gar nicht vermuten, dass er von Zeit zu Zeit auch einmal ein paar wirklich gute Ideen in seinem hübschen blonden Kopf hervorbringen kann«, warf Armand ein und grinste frech.
Pierre sah seinen Freund an und schnitt eine Grimasse; er würde sich seine freimütigere Antwort für später aufheben.
Der Marquis sah seinen respektlosen Sohn streng an. »Wenigstens scheint Pierre de Beauvoir Respekt zu kennen und zeigt sowohl Intelligenz und Höflichkeit, etwas, das im Verhalten meines jüngsten Sohnes völlig zu fehlen scheint!«
Nun war es an Armand, eine Grimasse zu schneiden und Pierre grinste ihn an. Rache ist süß, dachte er mit Vergnügen.
***
Die nächsten Tage vergingen schnell. Wie versprochen, gesellte sich der alte Bankier zum Abendessen zu ihnen und bot ihnen sogar weitere Mittel für den Erwerb des Saphirrings an, ein Angebot, das Pierre höflich, aber bestimmt, ablehnte.
Sie hatten sich während des Abendessens angeregt über Venedig unterhalten. Es stellte sich heraus, dass Monsieur Piccolin Norditalien und die Stadt Venedig sehr gut kannte.
»Venedig ist einfach wunderbar«, seufzte er mit verklärten Augen. »Als ich jung war, hatte ich das Privileg, mehrere Jahre in dieser wunderschönen Stadt zu leben und zu arbeiten. Ich muss gestehen, ich beneide Euch!«
Venedig, erklärte er, war eine stolze Republik. Die regierenden Familien waren aus Erfahrung misstrauisch und sorgten dafür, dass die Position des gewählten Staatsoberhauptes – des Dogen – nach dem Ende jeder Amtszeit weitergegeben wurde. Im Laufe der Jahrhunderte war die Stadt immer reicher und mächtiger geworden, da sie seit Generationen sagenhafte Schätze aus dem Orient angehäuft hatte.
Armand und Pierre hörten gebannt zu, als Monsieur Piccolin fortfuhr. »Doch dann begann der langsame Niedergang meines stolzen, schönen Venedigs. In endlosen Schlachten mit dem Osmanischen Reich wurde Venedig immer weiter ausgeblutet und die neuen Handelsrouten nach Amerika und Indien brauchen die Stadt nicht mehr. Dann kam die große Pest und tötete ein Drittel der Bevölkerung – eine schreckliche Strafe, die der Herr verhängt hat.«
Monsieur Piccolin hatte Tränen in den Augen. »Ich habe viele Mitglieder meiner eigenen Familie verloren, von morgens bis abends konnte man das Läuten der Totenglocken hören. Viele Bürger waren überzeugt, dass der Tag des Jüngsten Gerichts gekommen war, aber in Wirklichkeit war die Hölle auf die Erde gekommen.«
Aber Venedig hatte überlebt und der alte Bankier malte seinen begeisterten Zuhörern nun ein lebhaftes Bild von der Stadt. Er verglich sie mit einer schönen Dame, die sich bewusst war, ihre besten Jahre hinter sich zu haben. Nun hatte sie geschickt begonnen, die Spuren der Zeit hinter Schleiern, raffinierten Verkleidungen und viel Schminke zu verbergen.
Venedig war nach wie vor ein Leuchtfeuer des Reichtums und der Eleganz, die Gebäude, erbaut in einer einzigartigen Mischung aus orientalischem und italienischem Stil, schimmerten in der Sonne des Südens in warmen Farben.
Der Bankier seufzte vor Entzücken. »Eine Stadt, in die man sich verlieben muss. Und die Frauen dort …« Der Bankier seufzte erneut und schien Erinnerungen nachzuhängen.
»Wenn ich die Wahl hätte, in Paris oder Venedig zu leben … nun, ich fürchte, dass mir Venedig immer noch näher am Herzen liegt. An einem Sommerabend auf dem Canal Grande in der Gondel zu fahren …« Er lachte auf. »Ich schweife ab, aber Sie werden selbst sehen. Ich beneide die beiden jungen Herren, wenn ich ehrlich bin.«
Später beim Abendessen erwähnte Armand, dass er den venezianischen Botschafter und seine Tochter in London getroffen hatte, konnte aber seinen Satz nicht beenden, als der Bankier ihn mit funkelnden Augen unterbrach. »Oh, Sie meinen, die reizende Julia Contarini«, rief er aus. »Ist sie nicht wunderschön? Ich hatte das Vergnügen, die ganze Familie in meinem Haus zu bewirten, bevor der Botschafter nach London ging, und mein jüngster Sohn schwärmte danach noch wochenlang von ihr. Aber da sie aus einer der besten Familien Venedigs stammt, habe ich ihm gesagt, er soll sie vergessen – die Familie wird wollen, dass sie in eine Familie des Hochadels einheiratet.«
Er zögerte und schaute auf Armand, der Mühe hatte, seine Verlegenheit zu verbergen. Pierre ignorierte taktvoll die sichtbare Verwirrung seines Freundes, aber der alte Mann kicherte und sagte beruhigend: »Ich sehe schon, mein Sohn war nicht ihr einziges Opfer. Dann wird es für Sie interessant sein zu erfahren, dass sie auf dem Weg zurück nach Venedig ist – ihr Vater hat beschlossen, zurückzugehen, um bei den kommenden Wahlen für den Geheimen Rat zu kandidieren. Ich bin mir sicher, dass er gute Chancen hat, früher oder später ein Mitglied der 'Zehn' zu werden.«
»Was sind die 'Zehn'?«, fragte Pierre neugierig.
»Das ist der Geheime Rat der Zehn, der tatsächlich die Stadt und ihre Kolonien regiert – auch wenn sie das natürlich abstreiten. Offiziell gibt es die Dogen und den Großen Rat und die Magistrate, die die Stadt regieren, aber seit fast zwei Jahrhunderten liegt die Macht beim geheimen Rat der Zehn. Sie haben die wahre Macht: Ein Wort von ihnen und die Opfer verschwinden für immer in den berüchtigten Gefängniszellen unter dem Dach des Dogenpalastes – das schrecklichste Gefängnis, das man sich vorstellen kann, heiß wie ein Ofen in der Sonne und eiskalt im Winter.«
»Venedig ist wirklich schön«, seufzte der alte Mann, »aber, meine lieben Freunde, wenn ich Euch so nennen darf: Hütet Euch davor, Euch mit dem Rat der Zehn, der Inquisition oder der Geheimpolizei einzulassen. Man kann in Venedig schnell den Kopf verlieren, wenn man nicht aufpasst – und ich rede nicht nur von den schönen Mädchen dort. Den Saphirring zu finden, wird eine schwierige und gefährliche Mission sein. Ihr müsst mit Vorsicht und Sorgfalt planen und handeln.«
Es herrschte eine unangenehme Stille, die nur durch einen tiefen Seufzer von Armand unterbrochen wurde. Pierre war sich nicht sicher, ob Armand den Warnungen des Bankiers überhaupt zugehört hatte, denn alles, was er aus Armands Seufzer heraushören konnte, war der Name Julia.
Monsieur Piccolin unterstützte Pierres Vorschlag, inkognito zu reisen. »Das ist eine ausgezeichnete Idee! Es wird eine Menge Ärger und Aufsehen vermeiden. Wenn es gewünscht wird, kann ich ein Empfehlungsschreiben aufsetzen. Ich werde unsere Bank in Venedig darüber informieren, dass ich beschlossen habe, zwei junge und vielversprechende Lehrlinge aus gutem Hause nach Venedig zu schicken, um unser Handwerk zu erlernen. Das ist üblich und wird keinerlei Verdacht erregen.«
»Das ist genau das, was wir benötigen!« Armand war Feuer und Flamme. »Das wird uns die perfekte Tarnung für unsere Mission geben. Wir können dann in aller Ruhe herausfinden, was vor sich geht, bevor wir uns an die derzeitigen Besitzer des Rings wenden.«
Der Abend ging für ihren Geschmack viel zu schnell zu Ende und sie trennten sich im besten Einvernehmen.
»Was für ein Glück, dass wir Monsieur Piccolin gefunden haben und er uns helfen kann«, sagte Pierre und streckte seinen schmerzenden Rücken, die Stühle des Esszimmers waren zwar elegant, aber furchtbar unbequem.
»Nenn es Vorsehung«, schlug Armand vor, der ebenfalls in seinem Stuhl zusammengesackt war. Da sein Vater auch gegangen war, konnte er endlich jegliche Etikette missachten.
Pierre sprach weiter:
»Jetzt, wo wir einen Plan haben, sollten wir schon bald aufbrechen. Diese langweiligen Jagd- und Trinkfeste beim König in Versailles, ich bin es einfach leid. Wie dieser Lackaffe Cinq-Mars das letzte Mal auf mich herabgesehen hat …«
Armand antwortete: »Der Kerl macht sich vor Angst in sein Samthöschen, dass du versuchen könntest, der neue Favorit des Königs zu werden. Er trägt mehr Diamanten, Spitze und Samt als je zuvor, nur um dich in den Schatten zu stellen. Er ist einfach zu dumm, um zu verstehen, dass du immer besser aussehen wirst – egal, was er macht.«
Pierre lachte und zuckte nur mit den Schultern. Das war einer von Pierres Charakterzügen, die Armand so sehr mochte; obwohl er sich seines guten Aussehens bewusst sein musste, schien er sich einfach nicht darum zu kümmern.
Pierre fuhr fort: »Zuerst schlage ich vor, mein Schloss Montrésor zu besuchen. Mein Kammerdiener Jean hat mir erzählt, dass es wunderschön ist und nahe der Loire liegt – es muss einfach fabelhaft sein und ich freue mich schon sehr darauf.« Pierres Augen verfinsterten sich ein wenig. »… wenn nur Marie hier sein könnte … sie hat nur ein paar kurze Nachrichten geschickt, dass es ihr gut geht – glaubst du, dass da etwas nicht stimmt, vielleicht sind ihre Eltern doch nicht einverstanden?«
Insgeheim hatte Armand die gleichen Bedenken geteilt, aber er protestierte sofort lautstark: »Das ist Unsinn, Pierre, du bist die beste Partie, die sich eine Mutter für ihre Tochter vorstellen kann, reich wie ein König, ohne die Nachteile, die normalerweise mit einer solchen Ehe verbunden sind. Ich vermute einfach, dass ihr Vater immer noch kränklich ist und sie uns einfach nicht die Wahrheit gesagt hat, um uns Sorgen zu ersparen.«
Pierre runzelte die Stirn und dachte lange darüber nach, doch plötzlich wurde sein Gesicht wieder unglücklich.
»Was ist los?«, fragte Armand.
»Wenn ihr Vater sterben sollte – Gott bewahre, natürlich – müssen wir ein Jahr lang warten, bevor wir heiraten können; Marie muss dann die offizielle Trauerzeit einhalten.«
Pierre sah wieder niedergeschlagen aus und Armand ärgerte sich über sich selbst; es wäre besser gewesen, den Mund zu halten.
»Es hat keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, Pierre«, erwiderte Armand. »Wir müssen zuerst nach Venedig reisen, du kannst deine Braut ohnehin nicht mitschleppen. Erst ist Abenteuer angesagt, dann kannst du in den Hafen der Ehe einlaufen.«
»Du hast gut reden«, erwiderte Pierre, »du wartest doch nur darauf, Julia zu treffen, sobald du deinen Fuß nach Venedig setzt. Aber wie wird mein schlauer Freund damit umgehen, dass sie dich dann sofort erkennen wird? Tolle Idee, Julia zu umwerben, wenn wir doch inkognito bleiben wollen.«
»Hat mich jemand in Calais erkannt – oder nicht?«, antwortete Armand süffisant. »Ein bisschen Sonnenbräune und ein Vollbart und ich bin nicht mehr zu erkennen. Jede Frau wird davon überzeugt sein, dass ich direkt von der Mittelmeerküste stamme und dazu eine kleine Andeutung, dass mein Vater ein berüchtigter Korsar war, das macht sie alle wild. Aber … wir werden uns überlegen müssen, was wir mit dir machen. Na ja, zumindest scheint dein Bart endlich zu wachsen.«
Pierre verzog das Gesicht; das Fehlen einer prächtigen männlichen Bartzierde in einer Zeit, in der die Mode es forderte, war eine ständige Quelle des Ärgers. Aber in letzter Zeit hatte er etwas entdeckt, was man optimistisch als den Beginn eines vielversprechenden männlichen Gesichtsschmucks interpretieren konnte.
»Ich bleibe Julia aus den Augen, keine Sorge«, antwortete Pierre sauer. »Ich meine, es ist auch besser für dich, sonst ändert sie noch ihre Meinung und zieht mich vor.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, antwortete Armand, nicht im Geringsten eingeschüchtert. »Ich bin davon überzeugt, dass sie Qualität erkennt. Du bist zwar ein ganz netter Kerl, aber ich denke, es gibt da einiges mehr, was ich ihr bieten kann …«
Er beendete seinen Satz nicht, denn ein Kissen landete direkt in seinem Gesicht und traf dabei auch noch das Glas in seiner Hand. Armand lachte nur; es brauchte mehr als ein bisschen verschütteten Wein und ein kaputtes Glas, um ihn zu verunsichern.
Also musste wieder einmal eine Reise geplant werden. Die Maschinerie des adligen Haushalts wurde in Gang gesetzt, denn vorbei waren die Zeiten, in denen die beiden jungen Männer ihre Pferde satteln und einfach losreiten konnten. Pierres Haushofmeister informierte seinen Kollegen in Montrésor über den bevorstehenden Besuch des neuen Herrn und Meisters und löste auch dort sofort eine hektische Betriebsamkeit aus.
In Paris wurden Kutschen geputzt, die Räder geschmiert und neue Lakaien rekrutiert. Der mächtige Kardinal Richelieu bot sogar eine Abordnung seiner eigenen Musketiere an, um Pierre zu begleiten und zu beschützen, eine Geste, die nur als herausragendes Zeichen der Höflichkeit und Wertschätzung für den Marquis de Beauvoir gedeutet werden musste. Pierre lehnte jedoch höflich ab, von Richelieus Spionen umgeben zu sein, erschien ihm ausreichend.
Mit größtem Vergnügen nahm er jedoch das gleiche Angebot des Marquis de Saint Paul an und bald war alles bereit, zumindest dachte Pierre das.
»Haben Euer Gnaden eine königliche Audienz beantragt, um die Erlaubnis des Königs zu erbitten, Paris zu verlassen?«, fragte sein Kammerdiener Jean beiläufig. Pierre sah ihn an, als ob er verrückt wäre. »Warum sollte ich den König fragen müssen? Er wollte anfangs doch gar nicht, dass ich nach Paris komme. Er wird schon froh genug sein, dass ich abreise! Und hör auf, mich ständig 'Euer Gnaden' zu nennen, 'Monsieur' ist mehr als genug.«
Sein Kammerdiener schüttelte den dunklen Kopf. »Monsieur, Sie vergessen immer wieder Ihre neue Stellung. Als Peer von Frankreich dürfen Sie den königlichen Hof nicht ohne vorherige Erlaubnis Eures Souveräns verlassen; vergessen Sie nicht, dass Euer Gnaden, Pardon, Monsieur, nun eine prominente Figur von politischer Bedeutung ist.« Jeans Gesicht blieb ungerührt, aber seine Augen lachten – er wusste, dass Pierre diese ganze Aufregung hasste.
Pierre seufzte, aber er wusste, dass Jean recht hatte. Er musste eine Audienz beantragen und den König von seiner Abreise informieren – eine reine Formalität, aber das Protokoll musste respektiert werden: Etikette war die Essenz des Lebens am Hof und des adligen Lebens.
Eine Audienz wurde sofort gewährt und böse Zungen flüsterten, dass Monsieur Cinq-Mars den Zeitpunkt für die Audienz überstürzt herbeigeführt hatte, sobald ihm klar war, dass ein Rivale um die Zuneigung des Königs beabsichtigte, sich auf eine lange Reise zu begeben.
***
So schlenderten Pierre und Armand nur einen Tag später durch die endlosen Galerien des Louvre-Palastes, weiter durch zahlreiche Säle mit hohen bemalten Decken, um einen der Räume zu erreichen, in denen die privateren Audienzen stattfanden.
Helles Sonnenlicht strömte durch die großen Fenster des neuen Flügels des Louvre und es spiegelte sich im polierten Marmor der Böden. Pierre und Armand hatten den Eindruck, durch goldene Lichtpfützen zu waten, und das klackende Geräusch ihrer Stiefel auf dem harten Boden hallte durch den hohen Raum. Heute kündigten keine Trompeten die Ankunft des Königs und der Königin an, denn das Königspaar hatte bereits im großen Salon Platz genommen.
Pierre warf einen kurzen Blick auf die Königin, denn es wäre ein unverzeihlicher Verstoß gegen das Protokoll gewesen, die Königin offen anzuschauen. Sie war keine Schönheit – aber Pierre war trotzdem beeindruckt. Sie hatte scharfe Augen und besaß eine königliche Aura. Ihr heller Teint verriet die Habsburgerin, nur ihre dunklen Augen zeigten ihre spanischen Wurzeln. Die Königin trug ein Diadem mit Diamanten, das mit Perltropfen verziert war, dazu passend eine schwere Perlenkette. Ihre blonde Perücke saß etwas seltsam auf ihrem molligen Gesicht, das unter der dicken Schminke erstarrt war.
***
Die Königin saß neben ihrem Mann und langweilte sich wie immer zu Tode, da ihr Mann selten ein Wort an sie richtete – das starre Hofprotokoll sorgte dafür, dass sie in einem goldenen Käfig gefangen war. Sie war jedoch neugierig darauf, den Marquis de Beauvoir und seinen Freund zu treffen, den jüngsten Sohn des Marquis de Saint Paul, der auf mysteriöse Weise einen unaussprechlichen englischen Titel erworben hatte und sich nun Earl nennen durfte.
Sie kannte den Hofklatsch und wusste daher, dass diese gut aussehenden jungen Männer bereits als die nächsten Favoriten ihres Mannes gehandelt wurden. Aber warum sollten sie gerade jetzt den Hof verlassen wollen, wenn eine glänzende Karriere am Hof auf sie wartete? Sie fand dieses Verhalten ebenso ungewöhnlich wie rätselhaft – was konnte so wichtig sein, dass sie jetzt den Hof verlassen wollten, wenn der Heilige Gral des Hoflebens, die Gunst des Königs, so leicht zu gewinnen war?
Die Königin verabscheute jede Minute, die sie mit ihrem stotternden, unbeholfenen und schwerfälligen Ehemann verbringen musste, genauso wie sie sich bewusst war, dass der König jede Minute verabscheuen musste, in der er ihre Anwesenheit ertragen musste – oder noch schlimmer – die seltenen Gelegenheiten, in denen von Ludwig XIII. erwartet wurde, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen. Es war eine Abneigung, die in die Zeit zurückreichte, als sie als junges Mädchen aus Spanien weggeschickt worden war, geopfert im Namen der Politik, um Königin dieses kalten und fremden Königreichs zu werden, das in Wirklichkeit von einem zynischen und machtgierigen Kardinal regiert wurde.
Doch nun hatte sie den Thronfolger und sogar noch einen weiteren gesunden Sohn zur Welt gebracht. Ihre Kinder waren ein Geschenk, das Gott ihr nach Jahren des Wartens so unerwartet gegeben hatte, nachdem sie die Hoffnung auf Kinder schon längst aufgegeben hatte. Während der Schwangerschaft hatte sie Gefühle wie noch nie zuvor erlebt: eine Freude, von der sie nie gewusst hatte, dass es sie geben könnte, und dann die furchtbare Angst, dass das Kind, das in ihrem Schoß heranwuchs, den Wahnsinn ihrer spanischen Vorfahren erben würde.
Ihr Herz hatte vor Angst gerast und mit zitternden Fingern hatte sie die juwelenbesetzte Bibel mit dem Stammbaum der Habsburger geöffnet. Sie war der feinen Zeichnung mit den in eleganter Schrift geschriebenen Namen gefolgt und hatte diesen beeindruckenden Stammbaum von Königen und Kaisern, die ihre lebenden oder verstorbenen Verwandten waren, Revue passieren lassen. Ihre Familie hatte jahrhundertelang regiert und die Geschicke der Welt geprägt – doch seit mehreren Generationen schon war der spanische Zweig des Baumes verdorrt und morsch geworden.
Gequält von ihrer Angst hatte sie sich in der königlichen Kapelle zurückgezogen, auf den Knien auf kalten Marmorfliesen, betend und weinend, bis sie völlig erschöpft war und ihre Zofen sie drängten, in ihr Zimmer zurückzugehen und sich in ihr Bett zu legen, da sie riskierte, ihr kostbares Kind zu verlieren – und das würde der König niemals verzeihen.
Doch in dieser Stunde der Verzweiflung hatte sich in ihrem gequälten Geist plötzlich eine Idee gebildet, wie ein Lichtstrahl. Vor ihrem privaten Altar kniend, flehte sie die Heilige Jungfrau an: Lass mein Kind zu einem gesunden Sohn werden, lass ihn zu einem großen König von Frankreich heranwachsen und ich werde mich ganz Frankreich und der Zukunft meines Sohnes weihen.
Die selbstsüchtige, verwöhnte spanische Prinzessin war für immer verschwunden. Königin Anne von Frankreich war geboren worden.
Ihr ältester Sohn, der Dauphin, zeigte inzwischen alle Anlagen, ein prächtiger Prinz und zukünftiger König zu werden; sein Verstand war schnell und wach. Wie ein Schwamm versuchte Königin Anne von nun an jede Information über Frankreich aufzusaugen, begierig darauf, Allianzen zu schmieden – denn ihr Sohn sollte leben und regieren und seine Mutter war bereit, alles zu opfern, was notwendig war, um dieses Ziel zu erreichen.
***
Königin Anne kehrte in die Gegenwart zurück. Sie drehte ihren Kopf und warf einen kurzen, kritischen Blick auf ihren Mann. Er war dick geworden; aß und trank zu viel und sah ungesund aus. Der König sprach jetzt und sabberte dabei, die Königin musste ihren Abscheu unterdrücken. Ihr Blick wanderte weiter zum Kardinal Richelieu.
Sobald sie begonnen hatte, sich für Frankreich und seine Politik zu interessieren, hatte sie – widerstrebend – begonnen, Richelieus brillante Strategie zu bewundern. Ihr Sohn konnte nur hoffen, König eines mächtigen Landes zu werden, wenn die Grenzen seines Reiches sicher waren, und mit Spanien und Österreich, die große Gebiete im Norden, Osten, Süden und Westen Frankreichs besetzt hielten, konnte es keinen Frieden geben. Es war spanisches Gold, das seinen Weg in die Taschen der aufsässigen französischen Adligen fand, spanisches Gold, das regelmäßig Unruhe in Frankreich stiftete. Königin Anne hatte sich schmerzlich bewusst werden müssen, dass ihr Heimatland Spanien der ewige Feind ihres Sohnes war.
Die Königin hob ihren Blick und musterte die beiden jungen Herren, die nun ganz nah vor dem König standen. Die beiden jungen Männer waren auffallend gut aussehend, fast schon schön – aber seit sie die Königsmutter geworden war, lächelte sie den Marquis und seinen Freund, den jungen Grafen, an, nicht weil sie jung und gut aussehend waren, sondern weil sie die Zukunft des Königreichs ihres Sohnes repräsentierten: Jugend, Geld und Macht – alles, was sie benötigen würde, wenn jemals Richelieu oder der König sterben sollten, bevor ihr Sohn dreizehn Jahre alt geworden war und Frankreich aus eigenem Recht regieren konnte.
***
Pierre sah das Lächeln auf den Lippen der Königin und er verbeugte sich tief, schaute zurück und sandte ihr ein Signal, dass er bereit war, sie zu unterstützen, eine Botschaft, die sie verstand, denn plötzlich erreichte ihr Lächeln auch ihre Augen und sie nickte majestätisch mit ihrem Kopf.
Pierres Augen wanderten weiter zum Rest der Gruppe; zu seiner Überraschung entdeckte er Richelieu, der wie eine verschrumpelte scharlachrote Spinne neben dem Thron saß, seine brennenden Augen so wachsam wie immer. Die Augen des Kardinals huschten durch den Raum, nicht das kleinste Detail entging ihm. Allein seine Anwesenheit bei der Verabschiedung von Pierre war ein großer Gefallen; die Zeiten, in denen er ihn gemieden und sogar versucht hatte, ihn zu vernichten, schienen vorbei und vergessen zu sein.
Pierres Augen wanderten zu dem König und Monsieur Cinq-Mars. Letzterer hatte sich die Freiheit genommen, viel zu nahe beim König zu stehen und ignorierte das strenge Hofprotokoll. Cinq-Mars redete ununterbrochen – der König hörte zu, nickte nur und lächelte ab und zu nachsichtig.
Pierre konnte nicht wissen, dass der König nicht in der Lage war, viel zu sagen. In der Tat war Seine Majestät zutiefst verärgert. Wann immer der König verärgert war, schien seine Zunge verknotet zu sein. Erst gestern hatte der König erfahren, dass der Marquis de Beauvoir und Armand de Saint Paul Paris verlassen wollten, während der König insgeheim gehofft hatte, die beiden vielversprechenden Adligen während der kommenden Jagdsaison um sich zu haben. Sie schienen eine vielversprechende Ergänzung für seinen intimen Freundeskreis zu bilden.
Um die Sache noch schlimmer zu machen, hatte Richelieu ihm zugeflüstert, dass er zukünftig aufpassen müsse, Cinq-Mars nicht zu viele Gunstbezeugungen zukommen zu lassen. Dem König hatte diese Bemerkung sehr missfallen. Unglücklicherweise wusste er aus Erfahrung, dass Kardinal Richelieu niemals eine solche Bemerkung ohne einen genauen Grund machen würde – Cinq-Mars musste etwas Dummes getan haben, und der Kardinal musste mehr wissen, als er jetzt sagen wollte.
Die Gedanken des Königs gingen zurück zu dem gut aussehenden, jungenhaften Marquis, der vor ihm stand, so nah und doch so unmöglich, sich ihm zu nähern oder ihn zu berühren – selbst für einen König. Natürlich musste er Pierres Bitte, seine Ländereien zu besuchen und sein Erbe anzutreten, annehmen. Doch der König war zutiefst unglücklich, was bedeutete, dass sein Stottern heute noch deutlicher als sonst zu hören war. Er war daher erleichtert, dass Cinq-Mars angeregt plauderte und er nur nicken musste; zumindest schien Cinq-Mars zu verstehen, dass ihm heute nicht nach Reden zumute war.
Die Audienz war kurz, Pierre und Armand trugen ihr Anliegen vor und ihr Abschied wurde wohlwollend akzeptiert. Die beiden Freunde verbeugten sich tief, erfüllten alle vorgeschriebenen Schritte und Regeln des Protokolls und verließen den Audienzsaal. Als der König die beiden schlanken Männer rückwärts und sich verbeugend aus dem Salon gehen sah, musste er einen sehnsüchtigen Seufzer unterdrücken.
An diesem Abend aß und trank der König noch exzessiver als sonst und als die Zeit für das Nachtritual gekommen war, mussten seine Diener und Adligen einen völlig betrunkenen Monarchen entkleiden, der schluchzend unverständliche Namen von sich gab und in unpassender Eile seine Gebete brabbelte. Für die nächsten zwei Tage wurde der König als unpässlich gemeldet.
Heftige Gallenkoliken quälten Seine Majestät mit bisher unbekannter Intensität am nächsten Tag und seine Ärzte sahen sich mit größter Sorge an. Es war ihnen klar, dass der König nicht allzu viele solcher Anfälle überleben würde – was ein erschreckender Gedanke war, da der Thronfolger gerade erst sprechen lernte.