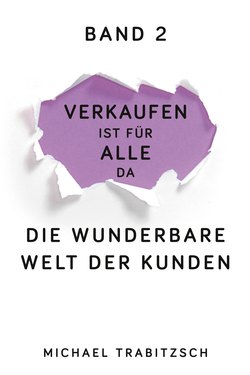Читать книгу Die wunderbare Welt der Kunden - Michael Trabitzsch - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5 Der Kunde ist kein König
Ich habe vorhin von Anstand und Respekt gesprochen. Hiermit meine ich nicht unbedingt, dass Du Deinen Kunden wie einen König behandeln musst. Aus meiner Sicht läufst Du hiermit nur Gefahr, Dich unnötig in eine schwächere Position zu begeben, und tust hiermit Deinem Kunden auch keinen Gefallen. Einem Kunden darf man auch mal widersprechen. Man sollte es als guter Berater auch tun. Bei einem König ginge das natürlich nicht.
Selbstverständlich sollte das Widersprechen im richtigen Ton und in sympathischer Weise erfolgen (siehe hierzu auch Band 3 – Der Flirt mit dem Kunden).
Was assoziierst Du mit den Worten „Der Kunde ist König“? Kommt Dir da nicht sofort ein Bild wie dieses hier in den Sinn?
Ein Herrscher mit Krone, dessen Untertan man ist und deshalb allen seinen Befehlen gehorchen muss?
Nach der Transaktionsanalyse von Eric Berne (amerikanischer Psychiater 1910–1970) gibt es in der psychologischen Theorie der menschlichen Persönlichkeitsstruktur drei als „Ich-Zustände“ bezeichnete Verhaltensweisen, zwischen denen Menschen hin- und herwechseln:
Das Eltern-Ich (E)
korrigieren
zurechtweisen
bevormunden
Das Erwachsenen-Ich (EW)
sachlich
respektvoll
konstruktiv
rational
Das Kind-Ich (K)
trotzig
albern
emotional verspielt
Jeder Mensch, egal welchen Alters, trägt also sowohl seine Eltern als auch sein inneres Kind in sich: mit den oben aufgeführten Verhaltensweisen.
Ein Kunde ist ein starker Verhandlungspartner auf Augenhöhe.
Das zweite Ich, das Erwachsenen-Ich, ist die Basis für eine optimal geführte Kommunikation, wie man sie von einem erfahrenen Erwachsenen erwartet.
Daraus können sich folgende drei Kommunikationsformen ergeben:
komplementäre Transaktion
gekreuzte Transaktion
verdeckte Transaktion
| E : | Eltern-Ich | EW : | Erwachsenen-Ich | K : | Kind-Ich |
Die komplementäre (parallele) Transaktion ist hierbei die reibungslose Kommunikation: Eine Person spricht eine andere aus einem Ich-Zustand (z. B. Erwachsenen-Ich) heraus an und erwartet, dass die angesprochene Person aus demselben Ich-Zustand heraus antwortet.
Nimmt sie die Einladung an und reagiert wie erwartet, resultiert daraus eine parallele Transaktion. Ein solches Gespräch kann im Prinzip endlos weiterverlaufen, da die Erwartungen und Reaktionen der Gesprächspartner einander entsprechen; auf eine klare Frage bekommt man auch die passende Antwort.
Ganz anders verläuft die gekreuzte Transaktion: Stellt der eine Gesprächsteilnehmer eine „harmlose“ Frage aus dem Erwachsenen-Ich „Was ist das Ergebnis Deiner Arbeit?“, dann erwartet er als Antwort eine passende Aussage zum Arbeitsergebnis. Interpretiert die angesprochene Person in diese Frage jedoch einen Vorwurf und gibt aus dem Kind-Ich heraus eine an das Eltern-Ich gerichtete trotzige Antwort, wird der Fragesteller vermutlich irritiert sein. Mit einer Antwort wie „Wann hätte ich das denn machen sollen?“ oder „Das war alles viel zu schwer. Wie hätte ich das schaffen sollen?“ wird das Gespräch dann vermutlich eine andere Wendung nehmen. Die gekreuzte Unterhaltung birgt also ein hohes Reibungspotenzial in sich.
Und genau hier liegt die Gefahr. Wenn wir den Kunden in der Rolle eines Königs (bevormundend, zurechtweisend) sehen, ihn hiermit mit dem Eltern-Ich assoziieren und keinen Stress mit ihm möchten, agieren wir automatisch aus dem Kind-Ich heraus und gehorchen als braves Kind artig, um eine Konfrontation zu vermeiden.
In so einer Situation ist es fast unmöglich, keine „Verlierer“ zu erzeugen. Ein nachhaltiges Geschäft kann sich somit nicht ergeben.