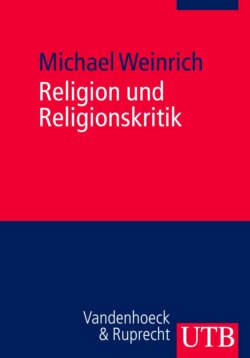Читать книгу Religion und Religionskritik - Michael Weinrich - Страница 7
ОглавлениеVorwort
Seit einiger Zeit – verstärkt nach dem 11. September 2001 – ist zu beobachten, dass die Religion wieder ein besonderes Interesse auf sich zieht und zwar weit über die mit ihr von Amts wegen befassten Zirkel hinaus. Damit wird eine Debatte (wieder-) belebt, welche die Neuzeit von ihren Anfängen an begleitet.
Der heute verwendete allgemeine Religionsbegriff hat seine Wurzeln in den unversöhnlichen Konflikten des nachreformatorischen Konfessionalismus. Die aus den Verwerfungen des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen Konfessionen erwiesen sich als unfähig, für ihre gegeneinander stehenden Wahrheitsansprüche eine gemeinsame Ebene für eine produktive Auseinandersetzung zu finden. Es waren vor allem Philosophen und sich gegenüber den Kirchen emanzipierende Politiker, die im Zuge des um sich greifenden Elends, das die Konfessionskriege anrichteten, disziplinierend auf die Streitparteien einwirkten. Ohne sich in den Wahrheitskonflikt einzumischen plädierten sie für eine den Konfessionen übergeordnete allgemeine Ebene, der sich diese unterzuordnen hatten. Das war die Religion. Im Horizont des allgemeinen Religionsverständnisses ging es um Spielregeln, die auf ein gedeihliches Zusammenleben ausgerichtet waren. Alle Glaubensrichtungen sollten sich ihnen fügen, wenn sie ihre öffentliche Akzeptanz nicht gefährden wollten. Die Streitparteien sollten dazu gebracht werden, jenseits ihrer vorläufig unabgleichbaren Wahrheitsansprüche anzuerkennen, eine Religion zu sein, von der grundlegende Standards eines friedlichen Zusammenlebens im entstehenden modernen Nationalstaat nicht in Frage gestellt werden. – Diese Frage nach den Standards der Religion hat übrigens durchaus ihre Aktualität behalten bzw. rückt heute wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit, beispielsweise in der Diskussion um die Gewaltbereitschaft fundamentalistischer Orientierungen (nicht nur im Islam) oder über die Verfassungsgemäßheit von Scientology. Ein Schlüsselproblem bleibt das Verhältnis zwischen Religion und Rechtsstaatlichkeit.
Das vorliegende Arbeitsbuch führt in den neuzeitlichen Religionsdiskurs in seiner ganzen Breite ein. Sowohl die kritische Kraft des allgemeinen Regionsbegriffs gegenüber allen Selbstverabsolutierungen als auch die im 18. Jahrhundert vehement einsetzende Religionskritik werden in verschiedenen Facetten präsentiert, ebenso wie auch die verschiedenen Wege der sich gegen die Religionskritik behauptenden Religionsbegründung insbesondere seit dem 19. Jahrhundert. Dabei wird einerseits eine dem Gegenstand angemessene Differenzierung angestrebt, um nicht in konventionalisierten Typologisierungen stecken zu bleiben, wie sie sich etwa in der Religionskritik in der Kanonisierung von Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud finden lässt. Anderseits bleibt das Arbeitsbuch weit davon entfernt, Vollständigkeit auch nur anzustreben. Es bemüht sich um eine differenzierte Exemplarität, die gelegentlich auch Positionen mit geringerer theoretischer Explorationskraft, aber einem einflussreichen Wirkungspotenzial berücksichtigt. Nicht selten sind es die popularisierenden Vereinfachungen, die neuen Differenzierungs- und Vertiefungsbedarf aufdecken bzw. geradezu aufdrängen. Deshalb können schwache Positionen bisweilen auch von einem hohen didaktischen Rang sein.
Die an Einzelpositionen orientierte Systematik des Buches stößt zum Ende hin mehr und mehr an ihre Grenzen, weil in der Gegenwart immer weniger einzelne Entwürfe und individuelle Religionsprofile die Diskussionen bestimmen als eben unterschiedliche Diskurse, die jeweils von verschiedenen Zuträgern leben. Eine systematisierende Präsentation kann in diesem Rahmen nicht geleistet werden. Auch wäre diese angesichts des fehlenden Abstandes zu den gegenwärtig diskutierten Herausforderungen wohl zu sehr von eigenen Interpretationsoptionen geprägt. Gewiss greift der Anspruch auf eine vollständig neutrale Präsentation grundsätzlich zu hoch, aber im Blick auf die weiter zurückliegenden Debatten ermöglicht der größere Abstand aufgrund der bereits greifbaren Wirkungsgeschichte doch eine abgeklärtere Darstellung.
Die Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln geben über die Benennung der jeweils eingenommenen Perspektive hinaus einige Interpretationshinweise, die auch indirekt eine Auskunft über die getroffene Auswahl der vorgestellten Positionen erteilen. Es empfiehlt sich nach dem Durchgang durch ein Kapitel die jeweilige Einleitung erneut zu lesen, weil davon ausgegangen werden kann, dass die dort gegebenen Hinweise nach dem Gang durch die einzelnen Unterkapitel im Blick auf ihre ganze Reichweite noch differenzierter verstanden werden können. Die jeweiligen kurzen Zusammenfassungen am Ende der Kapitel stellen vor allem einen Diskussionsvorschlag dar und sollen zu eigenen, auch abweichenden Wahrnehmungen anregen. Es handelt sich bewusst um ein Arbeitsbuch und nicht im strengen Sinne um ein Lehrbuch mit abgepackten und einfach zu reproduzierenden Wissenspositionen.
Wichtiger Hinweis: Die in Klammern gesetzten Seitenangaben im Text beziehen sich auf die Literaturangabe in der jeweils letzten unmittelbar vorausgehenden Anmerkung. Im Fall von unvollständigen Literaturangaben in den Anmerkungen finden sich die vollständigen bibliographischen Hinweise im Verzeichnis der ausgewählten Literatur am Schluss des Arbeitsbuches.
Mein Dank für stets verlässliche Unterstützung dieses Projektes gilt Karen Lutz, Ulrike Scholz und Holger Domas als meinen MitarbeiterInnen am Lehrstuhl und dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, vornehmlich Ulrike Gießmann-Bindewald und Jörg Persch für die kompetente und professionelle Begleitung.
Bochum, im Juli 2010
Michael Weinrich