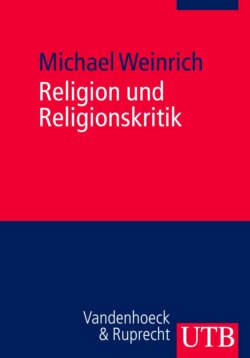Читать книгу Religion und Religionskritik - Michael Weinrich - Страница 9
Оглавление§ 2 Die Kritik der Religion
Man könnte sagen, dass eine Überschrift, die zunächst erst einmal erläutert werden muss, eine schlechte Überschrift ist. In diesem Fall ist die Formulierung bewusst auf ihre Erläuterungsbedürftigkeit hin angelegt.
Die Überschrift zu diesem Kapitel enthält einen Genitiv und somit eine durchaus missverständliche Formulierung – wer kritisiert da was? Sie soll unterstreichen, dass da, wo der neuzeitliche Religionsbegriff zur Zeit seiner Einführung in Anwendung kam, also in einem verallgemeinernden Sinne von Religion gesprochen wurde, immer auch eine Dimension der Kritik ins Spiel gebracht wird. Es handelt sich also bei dem Genitiv der Überschrift zunächst um einen genitivus subjectivus, d. h. die Religion ist das Subjekt und somit der Ausgangspunkt der zur Debatte stehenden Kritik. Ihrem Ursprung nach tritt mit der Religion ein gegen den sich selbst verabsolutierenden Dogmatismus der sich gegenseitig ihr Existenzrecht absprechenden Konfessionen kritischer Anspruch auf den Plan. Wir befinden uns im 17. Jahrhundert, dem Zeitalter der Konfessionskriege. Die Einführung des allgemeinen Religionsbegriffs als eine den im Konflikt stehenden Konfessionen übergeordnete Ebene ist verbunden mit der Erwartung, von dieser übergeordneten Ebene aus auf die Konfessionen einen zähmenden Einfluss nehmen zu können, indem sie Minimalbedingungen benennt für das, was in einem Gemeinwesen als Religion anerkannt werden kann. Mit der von den Philosophen und Staatsphilosophen protegierten Religion ist ein eigenes kritisches Potenzial verbunden, das sie in die Lage versetzt, die Konfessionen mit eigenen Kriterien zu konfrontieren, ohne deren Erfüllung sie nicht mit öffentlicher Akzeptanz rechnen können. Etwa ein Jahrhundert später wird dann dieser Genitiv im Zusammenhang mit der Religionskritik (→ § 4) zu einem genitivus objectivus, d.h. die Religion wird dann zum Gegenstand der artikulierten Kritik, sie wird zum Objekt einer sie angreifenden Argumentation.
Nun hätte sich leicht eine auf den ersten Blick so missverständliche Formulierung als Überschrift vermeiden lassen. Allerdings wäre sie dann in jedem Falle kraftloser geworden. Mit ihr wird gleich zu Beginn annonciert, dass es da, wo im neuzeitlichen Sinne die Religion auftritt, in jedem Fall in besonderer Weise kritisch zugeht, eben bereits da, wo die Religion als neu geprägter Begriff überhaupt erst eingeführt wird. Die Kritik, die sich dann später auch gegen sie selbst erhebt, hat durchaus einen vergleichbaren Charakter mit derjenigen, die zunächst von ihr ausgeht. Eben dieser aufs Ganze gesehen enge Zusammenhang wird von dem ambivalenten Genitiv der Überschrift gleich zu Anfang angedeutet, auch wenn es in diesem Kapitel zunächst nur um das kritische Potenzial geht, das vom Religionsverständnis selbst ausgeht.
|25◄ ►26|
1. Die Aufklärung
Epochenabgrenzungen sind deshalb so schwierig, weil die Bestimmung der jeweils ins Auge zu fassenden Charakteristika umstritten ist. Wenn hier die Aufklärung als der entscheidende Entdeckungshorizont für den neuzeitlichen Religionsbegriff annonciert wird, wird diese im weitesten Sinne als die Transformationsphase zur Neuzeit angesehen. Als solche ist die Aufklärung einerseits davon geprägt, den Menschen konsequent aus den Bindungen apodiktisch gesetzter und somit unbefragbarer Autoritäten zu befreien, und andererseits von einem entschlossenen Gestaltungswillen sowohl des individuellen als auch des sozialen Lebens. Die entstehenden Nationalstaaten beanspruchen uneingeschränkte innen- und außenpolitische Selbstbestimmung und verstehen sich als souveräne Akteure der vom Menschen hervorzubringenden Geschichte. Für die Gestaltung des Gemeinwesens rückten die vor allem im Bürgertum aufblühenden wirtschaftlichen Interessen des Frühkapitalismus vor die Dringlichkeit, die konfessionellen Wirrnisse und Feindseligkeiten zu klären. Es waren nicht zuletzt die wirtschaftlichen Erfolge, deren Gefährdung durch Religionsstreitigkeiten, wie sie in besonders drastischer Weise in den Verheerungen der Konfessionskriege vor Augen standen, nicht mehr hingenommen wurde. Insgesamt verschwand die Bereitschaft, den Kirchen irgendeine Entscheidungsmacht in Fragen, die mit der inneren und der äußeren Sicherheit zu tun haben, zuzugestehen. Entschlossen trat die Politik und mit ihr die bürgerliche Gesellschaft – unterstützt durch die zu eigenem Selbstbewusstsein gegenüber der Theologie erstarkte Philosophie – mit einem deutlich artikulierten Souveränitätsanspruch aus dem Schatten der kirchlichen Bevormundung.
Im Zusammenhang mit der Aufklärung kommt der Bestimmung des neuzeitlichen Religionsbegriffs eine besondere Rolle zu. Indem im Blick auf seinen Wahrheitsanspruch dem Bekenntnis des Glaubens konsequent jede verallgemeinerungsfähige Öffentlichkeitsrelevanz bestritten wurde, verliert es seine integrative Bedeutung für das Zusammenleben der Gesellschaft. Die verschiedenen Glaubensbekenntnisse, die nun unter dem Begriff der Religion in gewisser Weise neutralisiert wurden, werden dem aufgewerteten privaten Bereich zugewiesen, wo nach eigenem Gutdünken über die Wahrheitsfrage entschieden werden mag. Religion wird nicht weiterhin unter dem Blickpunkt ihrer angemessenen inhaltlichen und kultischen Gestaltung thematisiert, sondern sie wird zu einem formalen Begriff, unter dem sich sehr unterschiedliche inhaltliche Konkretionen vorstellen lassen. Vom Begriff der Religion als solchem geht keine Klärungsambition hinsichtlich ihrer Wahrheitsfähigkeit mehr aus. Ihre Angemessenheit wird allein am Maßstab ihrer Sozialverträglichkeit bemessen.
Diese Wahrheitsabstinenz des allgemeinen Religionsverständnisses bedeutet aber keineswegs, dass es sich bei der Religion um einen harmlosen und gleichsam reibungslosen Begriff handelt. Vielmehr ist der neuzeitliche Religionsbegriff – wie bereits angedeutet – gerade im Blick auf die Motivation seiner Einführung ein zutiefst kritischer Begriff, indem er sich gegen alle Absolutheitsansprüche stellt, wie sie in |26◄ ►27| den konfessionellen Antagonismen aufeinander prallten. In der Neutralität der Wahrheitsfrage gegenüber verbirgt sich eine grundsätzliche Relativierung aller dogmatischen Exklusivismen, die den jeweiligen Bekenntnissen ihr besonderes Profil geben. Man geht nicht zu weit, wenn in der Neutralität eine Art neues Dogma gesehen wird, das mit dem Anspruch auftritt, an die Stelle der Letztinstanzlichkeit der kirchlich verantworteten Dogmatik zu treten. Die Intentionalität des allgemeinen Religionsbegriffs kann nur recht erfasst werden, wenn auch die von ihm ausgehende dezidierte Kritik in den Blick genommen wird.
Es mag überraschen, wenn dieses Kapitel den deutschen Idealismus im Rahmen der Aufklärung thematisiert. Gewiss kann gesagt werden, dass der kritische Anspruch der Aufklärung bei Kant zu seinem Höhepunkt und Abschluss gekommen sei und dass der Idealismus weniger von einer aufklärerischen Kritik als vielmehr von einer über sie hinausgehenden systematisierten Positionalität geprägt sei. Ging es bei Kant um die kritische Frage nach den Kriterien, so präsentiert der Idealismus nun einen eigenen Standpunkt. Das ist die entscheidende Veränderung. Auf der anderen Seite wusste sich der Idealismus insofern an dem Projekt der Aufklärung beteiligt, als er sich gedrängt sah, der durch die Aufklärung etablierten Kritik einen die menschliche Vernunft übergreifenden und diese einschließenden geistphilosophischen Rahmen zu geben. Zwar geht der Idealismus auch entschlossen über Wesenszüge der Aufklärung hinaus, die auf eine Dynamisierung und Historisierung verfestigter Gesamtbilder ausgerichtet waren, aber er ist gerade in seinem Systematisierungsinteresse doch ganz und gar davon bestimmt, die Errungenschaften der Aufklärung so zu sichern, dass es auf solidem Weg grundsätzlich nicht mehr möglich sein sollte, diese infrage zu stellen. Es wäre nicht das erste Beispiel, wo aus dem verständlichen Sicherungsinteresse dann plötzlich ein architektonisch durchgestyltes Gebäude entsteht, in dem nur noch mit Mühe erkennbar bleibt, was es durch seine Errichtung zu sichern galt (als Beispiel kann etwa die ausdifferenzierte Dogmatik der altprotestantischen Orthodoxie gelten, die davon bewegt war, das Erbe der Reformation zu ‚sichern‘). Bei Kant zeigen sich ja längst auch dezidierte Systematisierungslinien der Aufklärung, denen dann im Idealismus noch eine grundsätzlich erweiterte Fundierung gegeben wurde. Philosophiegeschichtlich gesehen gibt es zudem mehr Gründe, im Idealismus den Abschluss einer Entwicklung zu sehen als den Anfang einer neuen Epoche, die dann wohl auf ihn selbst beschränkt werden müsste. Das entspricht auch seinem Selbstbewusstsein. Die Alternative zur Thematisierung in diesem Kapitel könnte daher nur ein eigenes Kapitel sein, was dann aber unweigerlich zu einer Überbewertung des Idealismus führen würde, wie sie allerdings immer wieder gern – insbesondere in apologetisch ausgerichteten Kreisen der Theologie – vorgenommen wird.
|27◄ ►28|
2. Thomas Hobbes
Thomas Hobbes (1588 – 1679) gilt als einer der Begründer des Rationalismus, der sich auf die Natur und die menschliche Vernunft beruft. Der Öffentlichkeitsanspruch der Religion wird von Hobbes konsequent der Staatsraison unterstellt.
Der erste große Vertreter der neuzeitlichen Staatsphilosophie war Thomas Hobbes. Er stellte die ordnungspolitische Bedeutung des Staates heraus, um die erodierende Situation zu befrieden und verlässliche Verhältnisse für ein gedeihliches Zusammenleben zu sichern. Die erbittertsten Konflikte registrierte Hobbes unter den rivalisierenden christlichen Konfessionen, aber er hatte keineswegs nur diese im Blick. Vielmehr verweist Hobbes auf das zänkische Verhalten des auf Selbstdurchsetzung bedachten Menschen, das er mit der bekannten Wendung des Plinius charakterisiert: „Der Mensch ist des Menschen Wolf “. Individuelle Selbsterhaltung und das Streben nach Lustgewinn verstricken die Menschen in andauernde Rivalisierungen. Dieser als Naturzustand des Menschen verstandene Umstand beschreibt in aller Klarheit den vom Leistungsprinzip geprägten Konkurrenzindividualismus des neuzeitlichen Bürgertums. Der Hintergrund dafür, dass diese Situation als natürlich ausgegeben wird, ist in der sich durchsetzenden kapitalistischen Wirtschaftsform zu suchen. Hobbes bringt das Lebensprinzip der vom Kapitalismus geprägten Wirklichkeit pointiert auf den Punkt: „Die Glückseligkeit daher, die wir als ein dauerndes Lustgefühl verstehen, besteht nicht darin, daß man Erfolg gehabt hat, sondern daß man Erfolg hat.“38
Dem Staat fällt die Aufgabe zu, die Individualinteressen mit dem Gemeinwohl so auszubalancieren, dass die Konkurrenzwirklichkeit in friedlichen Bahnen verläuft und das Eigentum des Einzelnen geschützt wird. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, wird der Staat mit besonderer Macht ausgestattet. Der staatliche Souveränitätsanspruch schließt auch die Bestimmungshoheit hinsichtlich der Religion ein, zumindest was ihre öffentliche Gestaltung anbelangt. Die als besonders friedensgefährdend angesehenen Religionen (gemeint sind hier zunächst vor allem die verschiedenen christlichen Konfessionen) werden hinsichtlich ihres Wahrheitsanspruchs ganz und gar in die Privatheit verwiesen, während die Religion als gesellschaftsintegrative Kraft konsequent unter die Regie des Staates gestellt wird. Da es weniger auf den Charakter der Religion als vielmehr ihren Vollzug ankommt, konzentriert Hobbes seine Aufmerksamkeit auf den Kult:
Der Kult ist nun entweder privat oder öffentlich. Privat ist der Kult, den die einzelnen Menschen nach eigenem Gutdünken ausüben; öffentlich der, den sie auf Geheiß des Staates ausüben. Der private wiederum wird entweder von einem einzelnen im geheimen ausgeübt oder von mehreren gemeinsam. Jener ist ein Zeichen aufrichtiger Frömmigkeit; denn wozu dient Heuchelei dem, den niemand sieht als nur der Eine, der auch die Heuchelei durchschaut? Der |28◄ ►29| gemeinschaftliche Kult dagegen kann erheuchelt sein und auf eigennützigen Nebenabsichten beruhen. Beim geheimen Kulte gibt es keine Zeremonien. Zeremonien nenne ich diejenigen Zeichen der Frömmigkeit von Handlungen, die nicht aus der Natur der Handlungen entspringen, sondern vom Staat willkürlich vorgeschrieben sind....
Öffentlicher Kult kann nicht ohne Zeremonien sein; denn öffentlicher Kult ist der, welcher auf Befehl des Staates als Zeichen der Verehrung, die man Gott entgegenbringt, von allen Bürgern, und zwar an bestimmten Stellen und zu bestimmten Zeiten, ausgeübt wird. Das Recht zu entscheiden, was geziemend ist, was nicht, steht beim öffentlichen Gottesdienst nur dem Staate zu. Zeremonien als Zeichen der Frömmigkeit von Handlungen fließen nicht nur, wie beim rein vernünftigen Kult, aus der Natur der Handlung selber, sondern können auch vom Staate willkürlich festgesetzt werden. Daher vieles sich im Gottesdienst bei einem Volke finden muß, was bei einem anderen nicht ist, so daß bisweilen der Kult der einen von den anderen verlacht wird. Einen von Gott unmittelbar angeordneten Kult hat es niemals gegeben außer bei den Juden, da er selbst ihr König war. Bei den anderen Völkern waren die Zeremonien zwar bei einigen vernünftiger als bei anderen, bei allen indessen gebot die Vernunft, die durch das staatliche Gesetz angeordneten Zeremonien auszuüben.39
In der Unterscheidung von öffentlicher und privater Religion kommen die Kirchen auf der Seite der privaten Religion zu stehen. Die dogmatischen Fragen und mit ihnen eben auch alle konfessionellen Konflikte werden zu einer Privatangelegenheit erklärt. Diese Unterscheidung von privater und öffentlicher Religion hat sich bis hinein ins 19. Jahrhundert ausgewirkt und ihre Nebenwirkungen lassen sich bis heute ausmachen.
Die Religion, soweit sie von allgemeiner Relevanz ist, wird konsequent der Staatsraison unterworfen. Sie ist allein im Blick auf ihre praktischen Auswirkungen zugunsten des öffentlichen Lebens von Interesse. Der allein für den Frieden zuständige Souverän bestimmt die Art und Weise der öffentlichen Gottesverehrung. Die Kirchen haben sich uneingeschränkt den staatlichen Gesetzen zu unterwerfen, da sich in ihren Grundlagen keine besondere Belehrung über die öffentlichen Angelegenheiten finden:
Ferner hat unser Erlöser den Bürgern keine andern Gesetze in betreff der Staatsregierung gegeben, als die natürlichen Gesetze, d. h. das Gebot zum bürgerlichen Gehorsam. Deshalb darf kein Bürger für sich bestimmen, wer dem Staate als Freund oder Feind gelten soll, wann ein Krieg begonnen, wann ein Bündnis, wann Friede oder Waffenstillstand geschlossen werden soll; auch hat kein Bürger darüber zu entscheiden, welche Bürger, welche und welcher Menschen Machtbefugnisse, welche Lehren, welche Sitten, welche Reden, welche und welcher Menschen Verbindungen das Wohl des Staates fördern oder gefährden. Also gebührt die Entscheidung über alles dies und ähnliches, soweit es nötig ist, dem Staate, d. h. dem höchsten Herrscher.40
Der Text macht die Konsequenz deutlich, mit der Hobbes die Kirchen auf die Pflege der privaten Frömmigkeit beschränkt und ihnen jeden Öffentlichkeitsanspruch entzieht .|29◄ ►30| Das, was für die Kirchen gilt, ist auch Gesetz für die anderen im Staate existierenden Religionen, die im christlichen Staat auch am christlichen Gottesdienst teilnehmen müssen. Die Radikalität, in der Hobbes die Souveränität des Staates sichert, zeigt sich darin, dass er mit der Machtzuschreibung an den Staat bis an die Grenze zur Euthanasie vorstößt, indem er ihm das Recht zumisst, darüber zu entscheiden, was ein Mensch oder eben keiner ist und daher auch getötet werden dürfe:
Hat z. B. eine Frau ein Kind von ungewöhnlicher Gestalt geboren und verbietet das Gesetz die Tötung eines Menschen, so entsteht die Frage, ob dieses Kind ein Mensch sei, und es erhebt sich also die weitere Frage, was ein Mensch sei. Hier wird niemand zweifeln, daß die Entscheidung dem Staate zusteht, ohne daß man auf die Definition des Aristoteles, wonach der Mensch ein vernünftiges Geschöpf ist, Rücksicht nehmen kann. Von allen diesen Gegenständen, nämlich Recht, Politik und Naturwissenschaften, hat Christus erklärt, daß es nicht zu seinem Amt gehöre, darüber Vorschriften und Lehrsätze aufzustellen, bis auf den einen, daß die einzelnen Bürger bei allen Streitigkeiten hierüber den Gesetzen und Urteilssprüchen ihres Staates zu gehorchen hätten. (287)
Der despektierliche Umgang mit den Kirchen hat seine Ursachen nicht nur in ihrer flagranten Zerstrittenheit, sondern im Hintergrund steht auch eine rationalistische Ableitung der Religion aus der charakteristischen Eigenschaft des Menschen, über sich selbst hinaus zu fragen. Dort, wo keine Antworten mehr erreichbar sind, gibt schließlich die Phantasie die benötigten Antworten. Wo diese Antworten dann gemeinschaftsbildend werden, ist der Mutterboden für die Religionen zu suchen. Es sind drei Dimensionen des menschlichen Fragens, die in den Religionen auf unterschiedliche Weise entsprechende Antworten bereitstellen:
Erstens ist es eine Eigenart der Natur des Menschen, den Ursachen der Ereignisse, die er sieht, nachzugehen, der eine mehr, der andere weniger. Aber alle Menschen besitzen sie so sehr, daß sie die Ursachen ihres eigenen Glücks oder Unglücks gerne wissen möchten.
Zweitens. Sehen die Menschen ein Ding, das einen Anfang hat, so nehmen sie auch an, daß es eine Ursache hatte, die es dazu bestimmte, gerade zu diesem Zeitpunkt seinen Anfang zu nehmen und nicht früher oder später.
Drittens. Während die Tiere kein anderes Glücksgefühl als den Genuß des täglichen Futters, von Ruhe und von Lust kennen, ... beobachten die Menschen, wie ein Ereignis von einem anderen hervorgebracht wurde und erinnern sich dabei an das, was vorausgegangen war und was darauf folgte. Und kann er sich über die wahren Ursachen der Dinge keine Klarheit verschaffen (denn die Ursachen von Glück und Unglück sind meistens unsichtbar), so nimmt er Ursachen an, die entweder seiner eigenen Phantasie entstammen, oder er vertraut der Autorität anderer Menschen, die er für seine Freunde und für klüger als sich selbst hält.41
Während Hobbes ‚Gott‘ als die Bezeichnung einer ersten und ewigen Ursache alle Dinge ansieht, erkennt er in den Göttern eine menschliche Umgangsweise mit der ihn beschleichenden Furcht vor der Ungewissheit der Zukunft, sodass konsequent betrachtet „ebensoviel Götter erdichtet werden als es Menschen gibt, die sie erdichten. “ (83)
|30◄ ►31|
Gleich zu Beginn der Aufklärung schlägt Hobbes einen kräftigen Grundakkord an. Die Religion wird einerseits hinsichtlich ihres Wahrheitsgehalts dem privaten Glauben zugewiesen, der seinem Wesen nach die Grenzen der Rationalität zur eigenen Selbstvergewisserung überschreitet. Zugleich wird der moralische Nutzen der Religion in die souveräne Obhut des Staates gestellt, in der er im Rahmen der ihm zur Friedenssicherung zugewiesenen Machtbefugnisse frei über sie verfügen kann.
W. Kersting, Thomas Hobbes zur Einführung, Hamburg 1992 H. Münkler, Thomas Hobbes, Frankfurt/M. 2001
3. Baruch de Spinoza
Der niederländische Philosoph Baruch (Benedictus) de Spinoza (1632 – 1677) wurde bereits vor seiner öffentlichen Wirksamkeit mit dem Vorwurf freigeistiger Irrlehre aus der Synagoge in Amsterdam ausgeschlossen. Später wurde ihm Pantheismus oder gar Atheismus vorgeworfen. Erst Ende des 18.Jh.s kommt es zu einer gelasseneren Rezeption.
Die Linie der zunächst vernünftigen (→ Herbert von Cherbury; § 1,13) und dann politischen (→ Hobbes; § 2,2) Zähmung der Religion wird von Baruch de Spinoza aufgenommen und fortgeführt. Auch für Spinoza ist der Staat eine vernünftige Einrichtung zum Schutze der Bürger, die um dieses Schutzes willen ihre eigenen Interessen zumindest in bestimmten Bereichen dem Staat unterordnen. Über die Verantwortung für den äußeren und inneren Frieden hinaus hat der Staat die Gedankenfreiheit seiner Bürger zu schützen. Diese Forderung macht Spinoza in einer religiös immer noch unduldsamen Zeit zu einem Vorkämpfer der Toleranz, die sich allerdings mehr auf den freien Gebrauch der Vernunft als die Verteidigung der miteinander konkurrierenden Traditionen bezieht.
Um dem modernen Staatsbürger ein aufgeklärtes Verhältnis zur Religion zu ermöglichen, will Spinoza die traditionelle Theologie durch eine Religionsphilosophie bzw. eine Gottesphilosophie beerben. Der Weg des Glaubens führt zwangsläufig in Aberglauben und Götzendienst und somit in Unfrieden und Unfreiheit, solange er sich vor der Kritik der Vernunft immunisiert. Gott und Wahrheit sind identisch, sodass sich im wahren Denken Gott selbst artikuliert. Vermittels des Denkens kann der Mensch geradezu die grenzenlose Vollkommenheit Gottes repräsentieren. Dabei wird Gott mit dem Akt identifiziert, der im wahren Denken von Vollkommenheit und Unendlichkeit vollzogen wird. Jede Verknüpfung mit einer bestimmten Gestalt soll auf diese Weise ausgeschlossen werden, weil diese immer nur mit endlichen und somit ungöttlichen Vorstellungen vorgenommen werden könnte. Zugleich bedeutet diese Bestimmung auch eine Loslösung von den biblischen Zeugnissen und allen überkommenen Lehrtraditionen. Die Bibel muss zum Gegenstand historischer Kritik werden, um den in ihr enthaltenen Geist Gottes, wie er sich besonders bei den Propheten findet, herauszustellen. Die Schrift wendet sich in ihrer moralisch-praktischen|31◄ ►32| Bedeutung gleichsam an die ungebildeten Massen, indem sie „sich nach der Fassungskraft und den Anschauungen derer richtet, denen die Propheten und Apostel zu predigen pflegten, und zwar aus dem Grunde, damit es die Menschen ohne Widerstreben und mit ganzem Herzen annehmen möchten“.42
Spinoza verfolgt in seiner Philosophie die Vorstellung, dass es essenziell nur eine Substanz geben kann, die als Grund und Ursache für die ganze Wirklichkeit anzusehen ist. Ein streng verstandener Monotheismus wird mit dem cartesianischen Rationalismus verbunden, sodass schließlich Gott identisch wird mit dem in sich geschlossenen Kausalsystem der sich selbst erschaffenden und durch sich selbst geschaffenen Natur. Sowohl der Vorwurf des Pantheismus als auch der des Materialismus berufen sich auf diese Zuspitzung, treffen aber nicht das eigentliche Zentrum seines Anliegens. Alle Begriffe, die sich der Mensch von der Wirklichkeit in Ansehung ihrer Endlichkeit macht, kommen nicht über vage Vorstellungen hinaus, die als solche auch ständig zu revidieren sind.
Das gilt in besonderer Weise im Blick auf die menschlichen Gottesvorstellungen. Jeder Mensch passt Gott seinem jeweiligen Vorstellungsvermögen an. Die Bibel ist ebenfalls nur der Ausdruck des Vorstellungsvermögens einer weit zurückliegenden Zeit, der als solcher nur historische Bedeutung haben und für den gegenwärtigen Menschen keineswegs als verbindlich angesehen werden kann. Aktuell bleibt allein das zugrunde liegende Anliegen, für eine humane Gestaltung des Zusammenlebens zu sorgen. Der rechte Lebenswandel und die Tugend werden in der Bibel in anschaulich ausgeschmückter Verpackung vorgetragen; allerdings ist die sich um die moralische Belehrung rankende Vorstellungswelt einschließlich aller Vorstellungen vom Handeln Gottes für den Glauben nicht essenziell.
Was übrigens Gott oder jenes Vorbild des wahren Lebens ist, ob er Feuer, Geist, Licht, Gedanke usw. ist, gehört nicht zum Glauben, so wenig wie der Grund, aus dem er das Vorbild des wahren Lebens ist, ob deshalb, weil sein Sinn gerecht und barmherzig ist, oder weil alle Dinge durch ihn sind und handeln und infolgedessen auch wir durch ihn erkennen und durch ihn einsehen, was wahrhaft recht und gut ist. Es ist einerlei, was jeder davon hält. Es gehört ferner nicht zum Glauben, ob einer annimmt, daß Gott nach seinem Wesen oder nach seiner Macht allenthalben ist, daß er die Dinge aus Freiheit leitet oder nach Naturnotwendigkeit, daß er die Gesetze als Herrscher vorschreibt oder sie als ewige Wahrheiten lehrt, daß der Mensch aus freiem Willen oder aus der Notwendigkeit göttlichen Ratschlusses Gott gehorcht, und daß endlich die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Bösen auf natürlichem oder übernatürlichem Wege erfolgt. Bei diesen und ähnlichen Fragen ist es in Ansehung des Glaubens gleichgültig, wie ein jeder darüber denkt, solange er nicht zu dem Schlusse kommt, sich eine größere Freiheit zu sündigen herauszunehmen oder Gott weniger gehorsam zu sein. Ja, vielmehr ist ein jeder, wie schon gesagt, verpflichtet, diese Glaubenssätze seiner Fassungskraft anzupassen und sie sich so auszulegen, wie er glaubt, daß er sie leichter, ohne jedes Bedenken und mit ganzem Herzen annehmen kann, um dann Gott aus ganzem Herzen zu gehorchen. (218 f.)
|32◄ ►33|
So sehr es ‚einerlei ist, was jeder davon hält‘, so wenig ist es offenkundig in das Ermessen des Einzelnen gestellt, sich möglicherweise auch gar nicht zum Glauben zu verhalten. Spinoza spricht von einer Pflicht, sich den Glauben so plausibel wie irgend möglich zurechtzulegen, wobei auch in Rechnung zu stellen bleibt, dass sich über die Zeiten hinweg die Vorstellungsweisen gründlich geändert haben, sodass der eingeräumten Freiheit durchaus eine eigene Gestaltungsmöglichkeit entspricht – wobei die Zielrichtung klar bleiben muss: Es geht um den Frieden der Gesellschaft im modernen Nationalstaat. In diesem Sinne spitzt Spinoza seinen Gedankengang zu:
Denn, wie ich schon bemerkt, geradeso wie einst der Glaube entsprechend der Fassungskraft und den Anschauungen der Propheten und des Volkes jener Zeit offenbart und niedergeschrieben worden ist, so ist auch jetzt noch jedermann verpflichtet, ihn seinen Anschauungen anzupassen, um ihn auf diese Weise ohne inneres Widerstreben und ohne Zaudern annehmen zu können. Denn ich habe gezeigt, daß der Glaube nicht so sehr Wahrheit als Frömmigkeit fordert und nur in Ansehung des Gehorsams fromm und seligmachend ist und daß infolgedessen jeder nur in Ansehung des Gehorsams gläubig ist. Nicht wer die besten Gründe für sich hat, hat deshalb notwendig auch den besten Glauben, sondern derjenige, der die besten Werke der Gerechtigkeit und der Liebe aufzuweisen hat. Wie heilsam und notwendig diese Lehre im Staate ist, damit die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben, und namentlich wie viele Ursachen von Wirren und Verbrechen dadurch beseitigt werden, das überlasse ich jedem selbst zu beurteilen. (219)
Im Grunde werden der Staat bzw. die Inhaber der Regierungsgewalt zu den maßgeblichen Auslegern von Religion und Frömmigkeit, sodass auch umgekehrt gilt, dass sich die rechte Frömmigkeit in der Liebe zum Staat bzw. Vaterland zeigt. Und selbst dann, wenn sich die Inhaber der Regierungsgewalt als gottlos erweisen, hat niemand das Recht, gegen sie das göttliche Recht in Schutz zu nehmen. Spinoza kann pointiert sagen:
Sicherlich ist die Liebe zum Vaterland die höchste Frömmigkeit, die man zeigen kann. Denn fällt die Regierung weg, so kann nichts Gutes mehr bestehen, alles kommt in Gefahr, und bloß die Wut und die Gottlosigkeit herrschen zum größten Schrecken aller. Daraus folgt, daß jedes fromme Werk am Nächsten sogleich gottlos wird, wenn dem ganzen Staat daraus ein Schaden erwächst, und daß umgekehrt eine gottlose Tat gegen den Nächsten als frommes Werk anzusehen ist, wenn sie um die Erhaltung des Staates willen geschieht. So ist es z. B. eine fromme Tat, wenn ich dem, der mit mir streitet und mir den Rock nehmen will, auch noch den Mantel gebe. Sobald man sich aber sagen muß, daß diese Handlungsweise verderblich ist für die Erhaltung des Staates, so ist es im Gegenteil eine fromme Tat, jenen vor Gericht zu ziehen, selbst wenn er ein Todesurteil zu gewärtigen hätte. (289f.)
Hier wird man mich nun vielleicht fragen: wer wird denn, wenn die Inhaber der Regierungsgewalt gottlos sein wollen, von Rechts wegen die Frömmigkeit in Schutz nehmen? Sind diese auch dann als die Ausleger der Frömmigkeit anzusehen? ... Soviel ist sicher: wenn die Inhaber der Regierungsgewalt tun wollen, was ihnen beliebt, so ist es einerlei, ob sie das Recht in geistlichen Angelegenheiten haben oder nicht: alles, Weltliches wie Geistliches, wird ins Verderben stürzen; aber noch weit schneller wird das geschehen, wenn Privatleute in aufrührerischer|33◄ ►34| Weise das göttliche Recht beschützen wollen.... Ob wir nun die Wahrheit der Sache selbst oder die Sicherheit des Staates oder ob wir das Gedeihen der Frömmigkeit ins Auge fassen, jedenfalls müssen wir festhalten, daß auch das göttliche Recht oder das Recht in geistlichen Dingen von dem Beschluß der höchsten Gewalten ohne Einschränkung abhängig sein muß und daß nur diese seine Ausleger und Beschützer sind. Daraus ergibt sich, daß nur diejenigen Diener des göttlichen Wortes sind, die das Volk vermöge der Autorität der höchsten Gewalten die Frömmigkeit lehren, wie sie nach deren Entscheide dem öffentlichen Wohle angemessen ist. (294f.)
W. Bartuschat, Baruch de Spinoza, München 2006
W. Röd, Benedictus de Spinoza. Eine Einführung, Stuttgart 2002
4. John Locke
Der englische Philosoph John Locke (1632 – 1704) gilt sowohl als Begründer des Empirismus als auch der modernen liberalen Staatsauffassung unter der Maxime der Volkssouveränität.
Neben dem von Hobbes (→ § 2,2) und Spinoza (→ § 2,3) in den Vordergrund gestellten Motiv des Friedens und der Sicherheit hebt Locke nun auch mit entschlossener Emphase das Motiv der Freiheit hervor, deren Schutz der Regierung Grenzen auferlegt und die Forderung einer Gewaltenteilung aufscheinen lässt (voll ausgebildet erst bei Montesquieu). Zwar kann der Staat ausdrücklich nicht die Oberherrschaft über die Religion beanspruchen, aber zugleich sind die zu tolerierenden Religionsgemeinschaften zu Loyalität und sittlichem Wohlverhalten dem Gemeinwesen gegenüber angehalten. Zwei Aspekte gilt es besonders hervorzuheben: a) die staatsphilosophisch begründete Toleranzforderung und b) den besonderen Zugang zum Gottesglauben und somit zur Religion.
a) Locke fordert, dass eine Gesellschaft so verfasst sein müsse, dass sie in Frieden und Sicherheit zusammenleben kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Forderung der Toleranz, ohne die es keinen haltbaren Frieden geben kann, verbunden mit einer konsequenten Trennung von Kirche und Staat.
Es ist nicht die Verschiedenheit der Meinungen (die nicht vermieden werden kann), sondern die Verweigerung der Toleranz (die hätte gewährt werden können) für die, die verschiedener Meinung sind, die alle die Tumulte und Kriege erzeugt hat, die es in der christlichen Welt wegen der Religion gegeben hat. Die Häupter und Leiter der Kirche, von Habsucht und unersättlichem Verlangen zu herrschen getrieben, haben die oft von maßlosen Ehrgeiz besessene Obrigkeit und das auf seinen Aberglauben jederzeit eitle Volk gegen die, die anders denken als sie, entflammt und aufgeregt, indem sie in ihrem Widerspruch mit den Gesetzen des Evangeliums und den Vorschriften predigen, daß Schismatiker und Häretiker um ihren Besitz gebracht und vernichtet werden müßten. Und so haben sie zwei Dinge, die an sich höchst verschieden sind, vermischt und verwirrt: die Kirche und das Gemeinwesen.43
|34◄ ►35|
Es ist eine gesellschaftliche und somit staatliche Aufgabe, die bürgerlichen Interessen zu schützen, worunter Locke versteht: „Leben, Freiheit, Gesundheit, Schmerzlosigkeit des Körpers und den Besitz äußerer Dinge wie Geld, Ländereien, Häuser, Einrichtungsgegenstände und dergleichen.“(13) Das Gewaltmonopol des Staates dient dem Schutz der bürgerlichen Rechte. Dabei fällt die Religion in die Freiheit des Bürgers, wobei sie sich selbst auch von jedem Zwang freizuhalten und auf die öffentliche Verehrung Gottes und den Erwerb des ewigen Lebens zu konzentrieren hat (vgl. 25 f.). In spekulativen Meinungen – so nennt Locke die Glaubensartikel – darf es weder von Seiten des Staates noch vonseiten der Religionsgemeinschaften irgendeinen Zwang geben, weil sie nicht in das Gebiet der menschlichen Macht fallen. Die Toleranz hat allein da ihre Grenze, wo die Existenz Gottes geleugnet wird, weil damit jede Verbindlichkeit infrage gestellt werde, durch welche die menschliche Gesellschaft zusammengehalten werde.
Von den Religionsartikeln sind einige praktisch, einige spekulativ. Obwohl nun beide in der Erkenntnis der Wahrheit bestehen, so beziehen sich doch diese bloß auf den Verstand, jene beeinflussen den Willen und das Verhalten. Daher können spekulative Meinungen und sogenannte Glaubensartikel, an die bloßer Glaube gefordert ist, keiner Kirche durch das Gesetz des Landes auferlegt werden. Denn es ist absurd, daß Dinge durch Gesetze eingeschärft werden sollten, die zu Stande zu bringen nicht in menschlicher Macht liegt. Zu glauben, daß dies oder das wahr ist, hängt nicht von unserem Willen ab... .
Ferner darf die Obrigkeit nicht das Predigen oder Bekennen von spekulativen Meinungen in einer Kirche verbieten, weil diese keinerlei Beziehungen auf die bürgerlichen Rechte der Untertanen haben. Wenn ein römischer Katholik glaubt, daß das, was ein andrer Brot nennt, wirklich der Leib Christi ist, so tut er dadurch seinem Nächsten kein Unrecht. Wenn ein Jude nicht glaubt, daß das Neue Testament Gottes Wort ist, so ändert er dadurch nichts an den bürgerlichen Rechten der Menschen. Wenn ein Heide beide Testamente bezweifelt, so darf er deswegen nicht als ein gefährlicher Bürger bestraft werden. Die Macht der Obrigkeit und die Besitztümer des Volkes können gleich sicher sein, ob nun einer diese Dinge glaubt oder nicht. Ich gestehe bereitwillig, daß diese Meinungen falsch und absurd sind. Aber es ist nicht die Aufgabe der Gesetze, für die Wahrheit von Meinungen, sondern für das Wohl und die Sicherheit des Gemeinwesens und der Güter und der Person jedes einzelnen Sorge zu tragen. So gehört es sich. (79f.)
Letztlich sind diejenigen ganz und gar nicht zu dulden, die die Existenz Gottes leugnen. Versprechen, Verträge und Eide, die das Band der menschlichen Gesellschaft sind, können keine Geltung für einen Atheisten haben. Gott auch nur in Gedanken wegnehmen, heißt alles dieses auflösen. Auch abgesehen davon können die, die durch ihren Atheismus alle Religion untergraben und zerstören, sich nicht auf eine Religion berufen, auf die hin sie das Vorrecht der Toleranz fordern könnten. Was andere praktische Meinungen, auch wenn sie nicht gänzlich von allem Irrtum frei sind, angeht, so kann es keinen Grund geben, sie nicht zu dulden, wenn sie nicht dahin zielen, eine Herrschaft über andere oder bürgerliche Straflosigkeit für die Kirche, in der sie gelehrt werden, einzuführen. (95)
In dem Text wird deutlich, dass Locke zwischen Heiden und Atheisten unterscheidet. Während die Atheisten das in Gott festgemachte Band des Zusammenhalts der Gesellschaft bestreiten und damit der Gesellschaft gleichsam ihren festen Rückhalt |35◄ ►36| entziehen, sind mit den Heiden diejenigen gemeint, die an andere als eben den christlichen oder den jüdischen Gott glauben.
b) Der besondere Zugang Lockes zur Religion hängt mit seinen philosophischen Grundentscheidungen zusammen, die ihn sowohl zum Begründer des englischen Empirismus als auch des aufklärerischen Rationalismus werden ließen. Alle Bewusstseinsinhalte werden durch äußere sinnliche oder innere Wahrnehmungen (Erfahrungen) hervorgerufen. Das Wissen um Gott ist dem Menschen nicht angeboren (wie bei Descartes oder Leibniz), aber unsere Vernunft führt uns „von der Betrachtung unserer selbst und dessen, was wir unfehlbar in unserer eigenen Beschaffenheit finden, zu der Erkenntnis dieser sicheren und offenkundigen Wahrheit, daß es ein ewiges, allmächtiges und allwissendes Wesen gibt.“44 Es handelt sich um ein Wissen, das „uns dann nicht entgehen kann, wenn wir uns nur mit unserm Denken ebenso darum bemühen wie um manche anderen Forschungen.“ (298) Auch wenn die biblische Überlieferung auf Offenbarung verweist, bleibt ihr Inhalt einer Prüfung nach bestimmten Kriterien der Vernunft ausgesetzt, die sich nicht einfach auf eine behauptete Autorität verlässt, sondern auf Klärung drängt. Nur so ist es möglich, ein klares Wissen von Gott zu erlangen. Ohne kritische Prüfung wird unsere Kenntnis über Gott „ebenso unvollkommen sein, wie die eines Menschen, dem man gesagt hat, die drei Winkel eines Dreiecks seien gleich zwei rechten, und der das auf Treu und Glauben hinnimmt, ohne den Beweis dafür zu prüfen. Er mag diesem Satz als einer glaubhaften Meinung zustimmen, hat aber keine Kenntnis von seiner Wahrheit, obwohl ihn seine Fähigkeit, sorgfältig angewandt, diese klar und einleuchtend machen könnte.“ (Bd. I, 101 f.) Die folgende Gedankensequenz legt dar, mit welchen Schritten Locke zu dem Gedanken vorstößt, dass die Vernunft als„natürliche Offenbarung“ anzusehen sei:
Erstens behaupte ich, daß kein von Gott inspirierter Mensch durch irgendwelche Offenbarung andern Menschen neue einfache Ideen mitteilen könnte, die sie nicht schon vorher auf Grund von Sensation und Reflexion besaßen... . Denn Wörter verursachen durch ihre unmittelbare Einwirkung auf uns keine anderen Ideen in uns als die ihrer natürlichen Laute; erst dadurch, daß sie gewohnheitsmäßig als Zeichen gebraucht werden, kommen sie dazu, in unserem Geist latente Ideen wachzurufen und wiederzubeleben, aber auch dann immer nur solche, die sich schon vorher da befanden. (Bd. II, 393 f.)
Zweitens behaupte ich, daß durch Offenbarung uns dieselben Wahrheiten enthüllt und überliefert werden können, die wir auch mit Hilfe der Vernunft und der auf natürlichem Wege erlangten Ideen entdecken können. So könnte Gott die Wahrheit irgendeines Satzes im Euklid ebensogut durch Offenbarung enthüllen, wie die Menschen durch den naturgemäßen Gebrauch ihrer geistigen Fähigkeiten von selbst dazu gelangen, ihn zu entdecken. Bei allen Dingen dieser Art ist die Offenbarung wenig vonnöten oder nützlich, weil Gott uns natürliche und sichere Mittel in die Hand gegeben hat, um zu ihrer Erkenntnis zu gelangen. Denn jede Wahrheit, die wir mit Hilfe der Kenntnis und Betrachtung unserer eigenen Ideen klar entdecken, wird für uns immer größere Gewißheit besitzen als die Wahrheiten, die uns durch überlieferte Offenbarung vermittelt werden. (395)
|36◄ ►37|
Alles, was Gott geoffenbart hat, ist sicherlich wahr; daran ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das bildet den eigentlichen Gegenstand des Glaubens. Ob aber etwas als göttliche Offenbarung anzusehen ist oder nicht, darüber muß die Vernunft entscheiden. Und sie kann dem Geist niemals erlauben, eine größere Augenscheinlichkeit zu verwerfen, um etwas weniger Einleuchtendes zu akzeptieren; auch kann sie ihm nicht gestatten, im Gegensatz zur Erkenntnis und Gewißheit an der Wahrscheinlichkeit festzuhalten. Dafür, daß eine überlieferte Offenbarung in dem Wortlaut, in dem sie uns übermittelt ist, oder in dem Sinne, in dem wir sie verstehen, göttlichen Ursprungs sei, kann es kein Zeugnis geben, daß so klar und gewiß wäre wie das der Prinzipien der Vernunft. Deshalb kann nichts, was den klaren, von selbst einleuchtenden Aussagen der Vernunft widerspricht und mit ihnen unvereinbar ist, beanspruchen, als Glaubenssache, mit der die Vernunft nichts zu tun habe, geltend gemacht oder anerkannt zu werden. (402f.)
Vernunft ist natürliche Offenbarung, durch die der ewige Vater des Lichts und der Quell aller Erkenntnis den Menschen denjenigen Teil der Wahrheit vermittelt, den er ihren natürlichen Fähigkeiten zugänglich gemacht hat. Offenbarung ist natürliche Vernunft, erweitert durch eine Reihe neuer Entdeckungen, die Gott unmittelbar kundgegeben hat und für deren Wahrheit die Vernunft die Bürgschaft übernimmt, indem sie ihren göttlichen Ursprung bezeugt und beweist. Wer deshalb die Vernunft beseitigt, um der Offenbarung den Weg zu ebnen, der löscht das Licht beider aus. Er handelt ebenso wie jemand, der einen Menschen überreden will, sich die Augen auszustechen, um durch ein Teleskop das ferne Licht eines unsichtbaren Sternes besser beobachten zu können. (406)
Wer sich darum nicht allen Maßlosigkeiten der Täuschung und des Irrtums ausliefern will, muß diesen Führer seines inneren Lichtes einer Prüfung unterziehen. Wenn Gott jemand zum Propheten macht, so vernichtet er deshalb noch nicht den Menschen in ihm. Er läßt dessen sämtliche Fähigkeiten in ihrem natürlichen Zustande, damit er fähig ist, zu beurteilen, ob die Inspirationen, die er erfährt, göttlichen Ursprungs sind oder nicht. Wenn Gott den Geist mit übernatürlichem Licht erhellt, so löscht er deshalb das natürliche Licht nicht aus. Wenn er will, daß wir der Wahrheit eines Satzes zustimmen sollen, so richtet er es entweder so ein, daß uns diese Wahrheit durch die gewöhnlichen Methoden der natürlichen Vernunft einleuchtet, oder aber er gibt uns zu verstehen, daß es sich um eine Wahrheit handele, der wir auf Grund seiner Autorität zustimmen sollen. Dann überzeugt er uns durch bestimmte Kennzeichen, bei denen sich der Verstand unmöglich irren kann, davon, daß diese Wahrheit von ihm stamme. Die Vernunft muß unser oberster Richter und Führer in allen Dingen sein. (414f.)
W. Euchner, John Locke zur Einführung, Hamburg 2004
5. John Toland
Der irische Philosoph John Toland (1670 – 1722) gilt als Begründer des Deismus, womit ein allein vernunftbegründetes Gottesverständnis im Horizont einer moralisch verstandenen natürlichen Religion bezeichnet wird.
Von den Religionsphilosophen und Gesellschaftstheoretikern der frühen Aufklärung wird der christliche Glaube vor allem unter dem Gesichtspunkt seiner Funktion für die menschliche Gemeinschaft betrachtet. Die praktische Notwendigkeit und die gesellschaftliche Nützlichkeit |37◄ ►38| werden zum kritischen Maßstab für die Bestimmungen des Glaubens und der den Konfessionen übergeordneten Religion. Konsequent versucht John Toland den von John Locke (→ § 2,4) eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen. Der von Toland geprägte Deismus betont die Schöpferrolle Gottes, wobei die Vernunft des Menschen als ein besonderes Werk dieser Schöpfung hervorgehoben wird, mit dem Gott den Menschen ausgezeichnet habe, um ihm dann auch die Schöpfung zur eigenen Gestaltung überlassen zu können. Gott selbst hat sich aus der Schöpfung weithin zurückgezogen, um den Menschen den Platz zu ihrer Selbstentfaltung zu überlassen.
Das Christentum wird auf der Linie seiner Übereinstimmung mit der Vernunft als praktische Lebensorientierung gegen den von den Kirchen und ihren Amtsträgern gestützten Aberglauben verteidigt. Die sittlich-religiöse Kraft des Christentums, wie sie in den biblischen Quellen noch offenkundig ist, sei im Laufe der Kirchengeschichte verunstaltet und durch heidnische Elemente überlagert und geschwächt worden. In all seinen wesentlichen Aspekten stimme das Christentum vollkommen mit der natürlichen Religion des Menschen überein, was sich in einer konsequent vernünftigen Betrachtung unabweislich aufzeigen lasse. Wo Locke lediglich eine vernünftige Bewertung erwartet, fordert Toland eine Begründung durch die Vernunft. Die Tradition hat vor der Vernunft den Wahrheitsbeweis zu erbringen, wenn sie Gültigkeit beanspruchen und als Wort Gottes gewürdigt werden will. Christianity Not Mysterious ist der Titel seiner wirkungsvollsten Publikation (1696), mit der er zeigen will, dass es im christlichen Glauben nirgends darum gehe, irgendwelche Geheimnisse anerkennen zu müssen. Diese Schrift wurde in Dublin öffentlich verbrannt und brachte Toland auch in London in Bedrängnis.
Im Gegensatz dazu sind wir der Ansicht, daß die Vernunft die eigentliche Grundlage aller Gewißheit ist, und daß nichts Offenbartes, mag es nun seine besondere Form oder seinen Inhalt angehen, von ihrer Prüfung mehr ausgenommen ist als die regelmäßigen Naturerscheinungen. So folgern wir denn in Übereinstimmung mit dem Titel dieser Abhandlung, daß im Evangelium nichts Widervernünftiges und nichts Übervernünftiges enthalten sei, und daß keine christliche Lehre eigentlich ein Mysterium genannt werden kann.
Und noch pointierter:
Was in der Religion geoffenbart ist, das muß und kann, da es überaus nützlich und notwendig ist, ebenso leicht verstanden und mit unseren allgemeinen Begriffen in Übereinstimmung gefunden werden, wie das, was wir von Holz, Stein, Luft, Wasser oder dergleichen wissen.45
Soll etwas für den Menschen verbindliche Bedeutung haben und aufrichtigen Glauben konstituieren, muss es seinem Begriffsvermögen uneingeschränkt zugänglich sein. So kann es etwa nicht angehen, dass Gott mit seinen Wundern die von ihm selbst geschaffenen Naturgesetze überspringe; vielmehr lassen sich – wenn auch nicht in jedem Falle – Erklärungen beibringen, die ohne einen Widerspruch von Natur |38◄ ►39| und göttlichem Wirken auskommen. Am deutlichsten tritt die annoncierte kritische Spannung im Umgang mit den biblischen Texten hervor:
Zunächst will ich bemerken, daß diejenigen, die sich kein Gewissen daraus machen, zu sagen, sie könnten auf das Zeugnis der Schrift hin einen handgreiflichen Widerspruch gegen die Vernunft glauben, eine jede Widersinnigkeit rechtfertigen; indem sie ein Licht dem anderen gegenüberstellen, machen sie unleugbar Gott zum Urheber aller Ungewißheit. Die bloße Annahme, daß die Vernunft das eine rechtfertigen könne und der Geist Gottes ein anderes, treibt uns in unvermeidlichen Skeptizismus; denn wir würden in beständiger Ungewißheit sein, wem wir folgen sollten, ja, wir könnten nichts sicher feststellen. Denn da der Beweis für die Göttlichkeit der Schrift von der Vernunft abhängig ist, wie sollten wir da, wenn auf irgendeine Weise das klare Licht der einen in Widerspruch treten sollte mit der anderen, von der Unfehlbarkeit der anderen überzeugt werden? Die Vernunft kann in diesem Punkte so gut irren wie in jedem anderen, und wir haben keine besondere Verheißung, daß es nicht so wäre, ebenso wie die Papisten sich nicht sicher sein können, daß ihre Sinne sie in jeder anderen Sache nicht ebensogut täuschen können, wie bei der Transsubstanziation. Zu behaupten, es trage sein Zeugnis in sich selbst, das hieße, auch den Koran oder die Puranas als Kanon anerkennen. Und auch dies wäre ein merkwürdiger Beweis, wollte man einem Heiden sagen: die Kirche hat’s entschieden; denn alle Gesellschaften werden ebensosehr für sich sprechen, wenn wir nur ihr Wort als sicheres Zeugnis annehmen. Außerdem würde er vielleicht fragen, woher die Kirche das Recht hat, in dieser Sache zu entscheiden? Und wenn ihm geantwortet werden würde: ‚von der Schrift‘, tausend gegen eins, er würde sich abwenden über diesen circulus: man soll glauben, daß die Schrift göttlich ist, weil die Kirche es so bestimmt, und die Kirche hat die entscheidende Autorität von der Schrift. Es wird bezweifelt, ob diese Fähigkeit der Kirche mit den zu diesem Zwecke angeführten Stellen bewiesen werden kann; aber die Kirche selbst (der betroffene Teil) behauptet es! Ei, sind denn nicht diese ewigen Rundläufe ganz ausgezeichnete Erfindungen, gedankenlose und schwachköpfige Leute schwindelig und verwirrt zu machen?
Aber wenn wir glauben, die Schrift ist göttlich, nicht auf ihre bloße Zusicherung hin, sondern auf ein wirkliches Zeugnis, das in der offenkundigen Gewissheit der darin enthaltenen Dinge besteht, – in unbezweifelten Tatsachen und nicht in Worten und Buchstaben, – was ist das anderes, als es vermöge der Vernunft beweisen? Sie trägt in sich selbst durchaus den Charakter der Göttlichkeit, das gestehe ich zu. Aber die Vernunft ist es, die ihn ausfindig macht, ihn prüft und mit ihren Prinzipien beweist und für hinreichend erklärt; und dieses erzeugt in uns regelrecht die Zustimmung des Glaubens oder die Überzeugung. Wenn nun alle einzelnen Punkte scharf gesondert werden, wenn nicht nur die Lehren Christi und seiner Apostel betrachtet werden, sondern auch ihr Leben, ihre Weissagungen, ihre Wunder und ihr Tod, so würde sicher alle diese Mühe vergeblich sein, wenn wir bei einem einzigen Berichte Vernunftwidriges zuließen. (80 f.)
Gegen alles das, was wir in diesem Abschnitt festgestellt haben, wird man sich mit großem Pomp auf die Autorität der Offenbarung berufen – ohne das Recht, die Vernunft zum Schweigen zu bringen und nichtig zu machen, – als ob alles insgesamt nutzlos und unstatthaft wäre. ... Ich sage, die Offenbarung wäre nicht ein zwingendes Motiv der Zustimmung, sondern ein Mittel zur Kenntnis. Wir dürfen nicht den Weg, auf dem wir zur Kenntnis eines Dinges kommen, mit den Gründen verwechseln, die wir haben, daran zu glauben. Es kann mich jemand in tausend Dingen unterrichten, die ich nie zuvor gehört habe, und über die ich nicht soviel denken würde, wenn mir nicht davon berichtet wäre; dennoch glaube ich nichts auf sein bloßes Wort hin ohne offenbare Gewißheit in den Dingen selbst. Nicht die bloße Autorität|39◄ ►40| dessen, der spricht, sondern die klare Vorstellung, die ich mir über das bilde, was er sagt, ist der Grund meiner Überzeugung. (83)
Mit seiner konsequent kritischen Haltung berief sich Toland auf das Neue Testament als die für den christlichen Glauben maßgebliche Quelle. Dieses stellt er gegen die Kirchengeschichte, welche aus sehr unterschiedlichen Interessen heraus die Mysterien insbesondere in der Gestalt von Zeremonien in die Kirche eingeführt und in ihr verbindlich gemacht habe. Schon beginnend im zweiten Jahrhundert wurde die Taufe angereichert durch Salbung und Kreuzeszeichen, Fragen und Antworten, Fasten und Waschungen, wobei man keine Scheu hatte, sich beim heidnischen Aberglauben zu bedienen:
In späteren Zeiten aber fand man kein Ende mit all den Kerzen, Geisterbeschwörungen, Anblasungen und vielen anderen Absonderlichkeiten jüdischen und heidnischen Musters. Aus dieser Quelle entsprang nicht nur der Glaube an Ahnungen, Vorzeichen, Erscheinungen, die Sitte des Beerdigens mit drei Schaufeln voll Erde und andere vulgäre christliche Riten, sondern auch Kerzen, Feste oder heilige Tage, Einsegnungen, Bilder, die Sitte in der Richtung nach Osten hin zu beten, Altäre, Musik, Kirchweihen, Sonderung der Plätze für sogenannte Laien und Kleriker. Denn in den Schriften der Apostel gibt es nichts dergleichen, wohl aber ist all das deutlich enthalten in den Büchern der Heiden und gehörte zu ihrem Gottesdienst.
. . . Aber es steht nichts von Natur so im Gegensatz wie Zeremonie und Christentum. Das letztere enthüllt die Religion klar und offen vor aller Welt, und die erstere liefert sie mystischen Darstellungen von rein willkürlicher Bedeutung aus. (135 – 137)
Es ist deutlich, dass für Toland die Berufung auf die Religion – verstanden als natürliche Religion – das kritische Potential zur Abweisung von Dogmatismus und Konfessionalismus der Kirchen darstellt. Religion überschreitet in diesem Gebrauch zwar nicht grundsätzlich die Grenzen des Christentums, sondern wird emphatisch mit ihm identifiziert, bezeichnet aber einen Zugang, der im Grundsatz auf Allgemeingültigkeit zielt und somit die Bindung an das Christentum immer auch transzendiert.
D. Lucci, Scripture in John Toland’s Criticism of Revealed Religion, in: ders., Scripture and Deism. The Biblical Criticism of the Eighteenth-Century British Deists, Bern 2008, 65 – 133
6. Voltaire
Mit Voltaire (1694 – 1778) erreicht die europäische Aufklärung ihren Höhepunkt. Trotz seiner rückhaltlosen Kritik an den abergläubischen Lehren der verfassten Religionen hält er doch unbedingt an der praktischen Bedeutung des Gottesglaubens fest.
Auch wenn Voltaire im Grunde keine neuen Argumente vorträgt, erreichen seine Kompilationen eine Schärfe und Aggressivität, die sich vor allem aus der vorrevolutionären Situation in Frankreich erklären lassen. Gleichwohl hat er durch seine Popularisierungen nicht unwesentlich zur weltweiten Ausbreitung der Ressentiments|40◄ ►41| gegenüber dem traditionellen Kirchenglauben beigetragen. Seine Kritik ist zugespitzt als Herrschaftskritik gegen die Kirchen, die er unverblümt für den Atheismus verantwortlich macht:
Wenn es Atheisten gibt, ist niemand anders daran schuld als die gedungenen Zwingherrn der Seelen, die uns gegen ihre Schurkereien aufbringen und manche schwachen Geister dazu zwingen, den Gott zu leugnen, den diese Ungeheuer schänden.46
Schon das kurze Zitat verdeutlich, dass sich Voltaire auch angesichts seiner radikalen Kritik nicht zu den Atheisten rechnet, sondern diese eher als ‚schwache Geister‘ betrachtet. Vielmehr bleibt er in der Linie des Deismus und bezeichnet sich selbst als einen Vertreter der ‚natürlichen Religion‘:
Zum Schluß stelle ich fest, daß jeder vernünftige, jeder anständige Mensch die christliche Sekte verabscheuen muß. Der große Name Theist, der nicht genügend verehrt wird, ist der einzige, den man annehmen sollte. Das einzige Evangelium, das man lesen sollte, ist das große Buch der Natur, das Gott mit seiner eigenen Hand schrieb und dem er sein Siegel aufdrückte. Die einzige Religion, zu der man sich bekennen sollte, ist die, Gott zu verehren und ein anständiger Mensch zu sein. Es ist dieser reinen und ewigen Religion ebenso unmöglich, Böses zu vollbringen, wie es dem christlichen Fanatismus unmöglich war, das Böse nicht zu tun. In dieser natürlichen Religion wird man nicht sagen können: Ich bin nicht gekommen, euch den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das aber ist das erste Glaubensbekenntnis, das man dem Juden in den Mund legt, den man Christus genannt hat.47
Zugleich kann Voltaire Jesus als einen Theisten bezeichnen, der allerdings zu einem Opfer seiner Umstände und seiner späteren Dogmatisierungen geworden ist:
Weder Jesus noch irgendeiner seiner Apostel hat je gesagt, er habe zwei Naturen und eine Person mit zwei Willen, seine Mutter sei die Mutter Gottes, sein Geist sei die dritte Person Gottes, und dieser Geist sei vom Vater und vom Sohne erzeugt. Wenn sich auch nur einer dieser Glaubenssätze in den vier Evangelien findet, so möge man ihn uns zeigen: Man streife alles von Jesu ab, was ihm fremd ist, was ihm zu verschiedenen Zeiten während der schändlichsten Glaubensstreitigkeiten und auf den sich voller Ingrimm wechselseitig mit Bannfluch belegenden Konzilien zugeschrieben worden ist; was bleibt dann von ihm übrig? Ein Vertreter von Gott, der die Tugend gepredigt hat, ein Feind der Pharisäer, ein Gerechter, ein Theist. Wir wagen zu behaupten, wir seien die einzigen, die seines Glaubens sind, der das Universum aller Zeit umfaßt und folglich der einzige wahrhafte Glaube ist. (485)
Es geht Voltaire darum, die Religion, die sich zu Recht so nennen darf und deshalb auch zu schützen ist, konsequent von dem Aberglauben zu trennen:
Die Religion, sagt ihr, sei für eine Unmenge Missetaten verantwortlich; sagt lieber, es sei der Aberglaube, der auf unserer trüben Erde herrscht: Er ist der schlimmste Feind der reinen Verehrung, die wir dem höchsten Wesen schuldig sind. Verabscheut dieses Monstrum, das immer |41◄ ►42| wieder den Schoß seiner Mutter zerrissen hat. Wer es bekämpft, ist ein Wohltäter des Menschengeschlechts. Wie eine Schlange erstickt es die Religion mit seinen Windungen. Man muß ihr den Kopf zertreten, ohne die Religion, die von ihr vergiftet und zerfleischt wird, zu verletzen.48
Es ist deutlich, dass das aufklärerische Pathos selbst einen eigenen Exklusivismus mit sich bringt, der in einer unauflöslichen Spannung zu der zugleich betonten Forderung der Toleranz zu stehen kommt. Am deutlichsten treten die Grenzen dieser Toleranz in Erscheinung, wenn sich Voltaire – durchaus in weitreichender Übereinstimmung insbesondere mit den Vertretern der französischen Enzyklopädie49 – über die Juden äußert und dabei ohne Zögern auf das zeitgenössische Arsenal des Antisemitismus zugreift:
Sie werden in ihnen nur ein unwissendes und barbarisches Volk treffen, das schon seit langer Zeit die schmutzigste Habsucht mit dem verabscheuungswürdigsten Aberglauben und dem unüberwindlichsten Haß gegenüber allen Völkern verbindet, die sie dulden und an denen sie sich bereichern.50
Wenn Voltaire ausdrücklich an Gott und der Religion in der Prägung des Deismus festhalten will, sieht er in ihnen ein Instrument zur Wahrung der Moral und der Ordnung, das vor allem durch die Annoncierung von Lohn und Strafe funktioniert. Das ist der Hintergrund für seine berühmte Äußerung: Wenn es Gott nicht gäbe, dann müsse er erfunden werden. Allerdings wäre es eine Verkürzung, wenn Gott nur als der wachende Richter zur Disziplinierung der Menschen angesehen wird. Es findet sich vielmehr bei Voltaire auch noch eine andere Seite, die gegen jede Unterstellung eines Zynismus bei der Verordnung von Religion gefeit ist. Gott spricht nämlich nach Voltaire auch heilsam das Trostbedürfnis des Menschen an, denn ohne Gott hätte die Welt keinen Halt und keine Hoffnung. Eine Welt ohne Gott ist wie ein unendliches Meer ohne Hafen – ein ähnliches Bild taucht dann später bei Nietzsche (→ § 4,2.6) wieder auf. Neben den gesellschaftspolitischen Gründen kennt Voltaire auch existenzielle Motive, an Gott festzuhalten. Diese sind ausreichend für eine entschlossene Verteidigung des Theismus. Alle anderen Gründe für den Glauben und die Religion weist er entschieden ab.
Bei dem Zweifel, in dem wir uns befinden, rate ich euch nicht mit Pascal, euch an das Sicherste zu halten. Es gibt nichts Sicheres im Ungewissen. ... Ich mache euch nicht den Vorschlag, ungereimtes Zeug zu glauben, um euch aus der Verlegenheit zu helfen. Ich sage nicht zu euch: Geht nach Mekka und küßt den schwarzen Stein, um euch zu erleuchten, nehmt einen Kuhschwanz in die Hand, legt ein Skapulier an, seid einfältig und fanatisch, um die Gunst des höchsten Wesens zu erlangen. Ich sage euch: Seid weiterhin tugendhaft und wohltätig, betrachtet weiterhin jeden Aberglauben mit Abscheu und Mitleid, aber verehrt mit mir den |42◄ ►43| Plan, der sich in der ganzen Natur offenbart, und dementsprechend den Urheber dieses Planes, die erste Ursache und den Endzweck des Ganzen; hofft mit mir, daß unser Wesen, welches auf das große ewige Wesen schließt, eben durch dieses große Wesen glücklich sein kann. Darin liegt kein Widerspruch. Ihr werdet mir nicht beweisen, daß dies unmöglich ist, und ich kann euch nicht mathematisch beweisen, daß es sich so verhält. In der Metaphysik schließen wir fast nur auf Wahrscheinlichkeiten; wir schwimmen alle in einem Meer, dessen Gestade wir nie gesehen haben. Wehe denen, die beim Schwimmen miteinander in Streit geraten! Jeder sehe zu, wie er an Land kommt; aber wer mir zuruft, Du schwimmst vergeblich, es gibt keinen Hafen!, der nimmt mir den Mut und raubt mir alle meine Kräfte.51
H. Baader (Hg.), Voltaire (WdF 276), Darmstadt 1980 G. Holmsten, Voltaire, Reinbek 2002
7. Jean-Jacques Rousseau
Der Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) weitet die aufklärerische Kritik an der überkommenen Religion auf die Kultur aus und setzt auf das Glück eines naturnahen Lebens.
Wenn Jean-Jacques Rousseau in die Reihe der Aufklärer gestellt wird, so ist er zugleich insofern deren Kritiker, als er die Aufklärung mit ihrer Grenze konfrontiert. Dem von der Aufklärung in die Vernunft und den Verstand gelegten Pathos entzieht Rousseau seine Letztgültigkeit, indem er auf die besondere untrügliche Kraft der Intuition setzt, die in einem engen Zusammenhang mit seinem Verständnis von der natürlichen Religion steht. Die Intuition liefert unverfälschte und somit höchst zuverlässige Belehrung und Orientierung. Sie ist nicht mit dem traditionellen Verständnis von Offenbarung zu verwechseln, wie es in den Kirchen den Menschen entgegengehalten wird, sondern steht diesem vielmehr diametral entgegen. Während die Offenbarung in den aus ihr abgeleiteten umstrittenen Dogmen Parteiungen und Unfrieden schafft, beruft sich die Zuverlässigkeit der Intuition auf einen den Menschen auszeichnenden Instinkt, der ihm – wenn er nicht unterdrückt oder durch die Fixierung an die traditionellen Bindungen der Offenbarung dominiert wird – alle nötige verlässliche Orientierung für das Leben bereitstellt. Nach Rousseau ist die Rede von Offenbarung schlicht überflüssig und steht in ihrer Streitsucht dem wahren Geist des Evangeliums entgegen, denn dieser setzt auf Überzeugung und nicht auf die Akzeptanz von Wundern oder Dogmen.
Rousseau bewegt sich vorbehaltlos auf der Linie der vernunftorientierten Aufklärung. Alles muss sich vor der Vernunft ausweisen, und was vor ihr nicht bestehen kann, darf auch keine Geltung beanspruchen. Doch diese durchaus anspruchsvolle Rolle der Vernunft macht sie nicht zugleich auch noch zur Quelle aller Orientierung und Einsicht. Vielmehr wird die Vernunft durch das Gefühl und die Intuition über-boten|43◄ ►44| – hier zeichnet sich eine Öffnung der Aufklärung hin zur Romantik ab. Das Verständnis der natürlichen Religion bekommt eine eigene Rolle zugewiesen, die sie für die Vernunft unentbehrlich macht. Rousseau legt in dem Erziehungsroman Emile sein eigenes Glaubensbekenntnis in den Mund eines ‚savoyischen Vikars‘, der leidenschaftlich eine intuitive moralische Religion des freien Menschen lehrt.
Ort dieser Intuition ist das Gewissen. Jeder Mensch soll seinem Gewissen als dem Erregungsort frommer Subjektivität folgen. Es wird gleichsam als Sprachrohr der unverstellten Natur verstanden. Nicht allein schon in der Vernunft, sondern im Grunde erst im Gewissen erweist sich die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Im Gewissen zeigt sich wirkliche Lebenskraft, Tugend und Freiheit. Es gilt für Rousseau als der entscheidende Beleg dafür, dass der Mensch von Natur aus gut ist.
Gewissen! Gewissen! Göttlicher Instinkt! Unsterbliche und himmlische Stimme! Sicherer Führer eines unwissenden und beschränkten, aber verständigen und freien Wesens! Untrüglicher Richter über Gut und Böse, der den Menschen gottähnlich macht! Du gibst seiner Natur die Vollkommenheit und seinen Handlungen die Sittlichkeit! Ohne dich fühle ich nichts in mir, das mich über die Tiere erhebt, als das traurige Vorrecht, mich mit Hilfe eines ungeregelten Verstandes und einer grundsatzlosen Vernunft von Irrtum zu Irrtum zu verlieren.52
Die Angewiesenheit von Verstand und Vernunft wird unmissverständlich hervorgehoben. Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass die Intuition nicht einfach eine Inspektion der eigenen Subjektivität darstellt, sondern als Begegnung mit dem Wesen der Natur und somit der Wirklichkeit verstanden wird. Wichtig bleibt zu beachten, dass das Gewissen zwar in jedem Einzelnen spricht, aber es wird deshalb nicht zum Ausdruck individueller Subjektivität, sondern Rousseau misst dem Gewissen eine unhintergehbare Objektivität zu, der man sich im Grunde nicht entziehen könne. Das Gewissen wird nicht als eine hinzugewonnene Dimension der Individualität gefeiert, sondern als ein bildungsunabhängig gegebener Zugang zum Wahren und Guten. Dieser Zugang wird nicht durch die Erziehung erschlossen, sondern ist von Natur aus in jedem Menschen gegeben. Der Mensch ist von Natur aus gut und solange er sich der Führung seines Gefühls überlässt, vermag er auch gut zu bleiben.
Von hier aus ergibt sich Rousseaus Konzept einer ‚natürlichen Religion‘, die an die Stelle der tradierten Offenbarungsreligion treten soll und all ihre Anstößigkeiten überwindet.
Du findest in meinen Darlegungen nur die natürliche Religion, und es ist seltsam, daß auch noch eine andere notwendig sein soll. Woran soll ich diese Notwendigkeit erkennen? Wessen kann ich schuldig sein, wenn ich Gott nach der Vernunft, die er meinem Geist gibt, und nach den Gefühlen, die er meinem Herzen einflößte, diene? Welche Reinheit der Moral, welches Dogma, das dem Menschen nützt und seinen Schöpfer ehrt, kann ich aus einer positiven Glaubenslehre ziehen, die ich nicht auch ohne sie aus dem richtigen Gebrauch meiner Fähigkeiten ziehen könnte? Zeig mir, was man zur Ehre Gottes, zum Wohl der Gesellschaft und zu meinem eigenen Vorteil den Pflichten des natürlichen Gesetzes hinzufügen kann und welche Tugend du aus einem neuen Kult ziehen kannst, der nicht eine Konsequenz meines Kultes wä-re.|44◄ ►45| Die höchsten Vorstellungen von der Gottheit gibt uns die Vernunft ein. Betrachte das Schauspiel der Natur, hör auf die innere Stimme. Hat Gott nicht alles vor unseren Augen, vor unserem Gewissen und unserem Urteil ausgebreitet? Was können uns die Menschen mehr sagen? Ihre Offenbarungen erniedrigen Gott nur, da sie ihm menschliche Leidenschaften beilegen, statt unsere Begriffe über das große Wesen aufzuklären. Ich sehe, wie die einzelnen Dogmen sie verwirren; statt sie zu erhöhen, ziehen sie sie herab; den unbegreiflichen Geheimnissen, die die Gottheit umgeben, fügen sie sinnlose Widersprüche hinzu und machen den Menschen stolz, unduldsam und grausam; statt den Frieden auf der Erde zu stiften, überziehen sie sie mit Feuer und mit Schwert. Ich frage mich, wozu das dienen soll, und weiß keine Antwort. Ich sehe nur die Verbrechen der Menschen und das Elend des menschlichen Geschlechts.
Man sagt mir, daß eine Offenbarung notwendig sei, um die Menschen zu lehren, wie wir Gott dienen sollen. Als Beweis dafür führt man die Verschiedenartigkeiten der seltsamen Kulte an, die sie eingeführt haben, und übersieht, daß alle Verschiedenartigkeit aus der Phantasie der Offenbarungen kommt. Seit die Völker auf den Gedanken kamen, Gott sprechen zu lassen, hat jeder ihn auf seine Weise reden lassen, was er hören wollte. Wenn man nur darauf gehört hätte, was Gott dem Menschen ins Herz sagt, so hätte es immer nur eine einzige Religion gegeben. (312)
Suchen wir also aufrichtig die Wahrheit! Geben wir nichts auf das Vorrecht der Geburt, auf die Autorität der Kirchenväter und der Pfarrer, sondern unterziehen wir alles, was sie uns seit der Kindheit gelehrt haben, der Prüfung des Gewissens und der Vernunft. Und wenn sie schreien: Unterwirf deine Vernunft! Dasselbe könnte mir jeder Betrüger sagen. Wenn ich meine Vernunft unterwerfen soll, brauche ich vernünftige Gründe dazu. (314)
Alles, was von der Religion zu erwarten ist, bietet die natürliche Religion. Sie bedarf keiner Ergänzung. Die reine Moral, um die es in der natürlichen Religion geht, ehrt sowohl Gott als auch den Menschen. Zwar gesteht Rousseau zu, dass die überkommene Theologie in ihrem Umgang mit der Offenbarung auch manchen tiefsinnigen und sogar nützlichen Gedanken verbunden haben mag, aber jede Verpflichtung auf eine dieser Lehren ist grundsätzlich abzulehnen. Der alleinige Maßstab zur Beurteilung, der von allen Menschen bereits mitgebracht wird, ist die natürliche Religion.
Neben dieser persönlichen Intuitionsreligion kennt Rousseau in Übereinstimmung mit den bisher besprochenen Vertretern der Aufklärung auch noch eine ‚bürgerliche Religion‘ bzw. ‚zivile Religion‘, die für das gesellschaftliche Zusammenleben von fundamentaler Bedeutung ist. Die Unterscheidung von öffentlicher und privater Religion wird von ihm ausdrücklich geteilt.
Für den Staat ist es allerdings wichtig, daß jeder Bürger eine Religion habe, die ihm vorschreibe, seine Pflichten zu lieben. Aber die Dogmen dieser Religion sind dagegen für den Staat wie für seine Mitglieder nur insofern von Bedeutung, als sie die Moral und die Pflichten betreffen, die der Gläubige anderen gegenüber zu erfüllen hat. Darüber hinaus kann jeder glauben, was er will, ohne daß der Souverän es zu wissen braucht. Da er für die andere Welt nicht zuständig ist, geht ihn das, was das Schicksal seiner Untertanen im Jenseits sein wird, nichts an, wenn sie nur in dieser Welt gute Bürger sind.
Es gibt also ein rein bürgerliches Glaubensbekenntnis. Seine Artikel müssen vom Souverän erlassen werden. Sie dürfen keine Dogmen sein, sondern Gemeinschaftsgefühle, ohne die es |45◄ ►46| unmöglich ist, weder guter Staatsbürger noch treuer Untertan zu sein. Zwar kann niemand gezwungen werden, daran zu glauben, aber der Souverän kann jeden aus dem Staat verbannen, der nicht daran glaubt. Er kann ihn nicht als Ungläubigen verbannen, sondern als Feind der Gesellschaft, der unfähig ist, die Gesetze und die Gerechtigkeit aufrichtig zu lieben und notfalls sein Leben für seine Pflicht zu opfern. Wer diese Glaubenssätze anerkannt hat und sich dennoch benimmt, als glaube er nicht daran, der soll mit dem Tod bestraft werden. Er hat das größte aller Verbrechen begangen: er hat vor dem Gesetz einen Meineid geleistet.53
Es wird deutlich, dass nach wie vor die Frage der inneren Sicherheit ein zentrales Problem für den modernen Staat darstellt. Auch wenn keine spezifische Staatstheologie vorgetragen wird, so wird dennoch umgekehrt die religiöse Verankerung des Staats nach wie vor als unverzichtbar angesehen. Die nähere Betrachtung der Glaubenssätze der bürgerlichen Religion zeigt deutlich die Spuren der Kriterien, die wir bereits bei Herbert von Cherbury als wegweisend registriert haben (→ § 1,1.3). Auffällig ist lediglich, dass nun die ausdrückliche Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages herausgestellt wird, was nochmals den hohen Rang der als notwendig erachten Staatsraison unterstreicht:
Die Glaubenssätze der bürgerlichen Religion müssen einfach sein, gering an Zahl, klar im Ausdruck, ohne Erklärungen und Auslegungen. Diese positiven Sätze sind: Die Existenz einer mächtigen, vernünftigen, wohltätigen, vorausschauenden und vorsorglichen Gottheit; das künftige Leben; die Belohnung der Gerechten, die Bestrafung der Bösen; die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags und der Gesetze. Es gibt nur einen negativen Satz: Unduldsamkeit. Sie gehört den Kulten an, die wir ausgeschlossen haben. (207)
Es sind insbesondere diese Formulierungen Rousseaus, an die dann etwa 200 Jahre später die von Robert N. Bellah angestoßene Diskussion über die Gestalt und die Bedeutung einer civil religion in recht unterschiedlicher Weise immer wieder angeschlossen hat (→ § 8,1.1).
G. Mensching, Rousseau zur Einführung, Hamburg 2003 B. H. F. Taureck, Rousseau. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbeck 2009
8. Gotthold Ephraim Lessing
Gotthold E. Lessing (1729 – 1781 ) hat der deutschen Aufklärung einen besonderen Stempel aufgedrückt, indem er sich nicht in die institutionellen Konkurrenzen zwischen Kirche, Staat und Gesellschaft hineinziehen ließ, sondern der Frage nach den Konstitutionsbedingungen von Wahrheit nachging.
Wenn wir in Lessing gleichsam einer milden Form der Aufklärung begegnen, so hat das seinen Hauptgrund darin, dass er sich kaum an den institutionell orientierten Positionierungen der englischen und französischen Aufklärung beteiligte. Wenn Lessing der Frage nach der Wahrheitsfähigkeit der Religion nachgeht, beeindruckt ihn weder der Weg der Neologen mit ih-rer|46◄ ►47| konsequent rationalen Schriftauslegung (→ § 3) noch der der Deisten mit ihrem Postulat einer vor allem moralisch verstandenen natürlichen Religion. Vielmehr bewegt ihn die Frage, was einer Glaubensaussage ihre besondere Evidenz zu geben vermag. Die schlichte Berufung auf die Vernunft greift zu kurz, wenn nicht auch ihr spezifischer Gebrauch näher bestimmt wird. Zur Begründung einer Glaubensaussage bleibt die Berufung auf irgendwelche zurückliegenden Geschichtsereignisse entschieden zu schwach. Die Geschichte ist nicht der vermeintlich feste Boden, auf dem unverrückbare Tatsachen aufliegen, sondern sie ist im Gegenteil ihrem Wesen nach eine zufällige Berufungsinstanz, die prinzipiell nicht über die Kraft verfügt, „notwendige Vernunftwahrheiten“ zu begründen.
Wenn keine historische Wahrheit demonstriret werden kann: so kann auch nichts durch historische Wahrheiten demonstriret werden.
Das ist: zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von nothwendigen Vernunftwahrheiten nie werden.
Ich leugne also gar nicht, daß in Christo Weissagungen erfüllet worden; ich leugne gar nicht, daß Christus Wunder gethan: sondern ich leugne, daß diese Wunder, seitdem ihre Wahrheit völlig aufgehöret hat, durch noch gegenwärtig gangbare Wunder erwiesen zu werden; seitdem sie nichts als Nachrichten von Wundern sind, (mögen doch diese Nachrichten so unwidersprochen, so unwidersprechlich seyn, als sie immer wollen:) mich zu dem geringsten Glauben an Christi anderweitige Lehren verbinden können und dürffen. Diese anderweitigen Lehren nehme ich aus anderweitigen Gründen an.54
Von den geschichtlichen Ereignissen sieht sich Lessing getrennt; dazwischen liegt der gern immer wieder zitierte „garstige breite Graben, über den ich nicht kommen kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe“ (7). Lessing bestreitet nicht die historische Stimmigkeit von bezeugten Ereignissen und den daraus gezogenen Lehren, wie beispielsweise das Wunder der nicht zu widerlegenden Auferstehung Jesu und dem von den Jüngern daraus abgeleiteten Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes sei.
Wenn ich zu Christi Zeiten gelebt hätte: so würden mich die in seiner Person erfüllten Weissagungen allerdings auf ihn sehr aufmerksam gemacht haben. Hätte ich nun gar gesehen, ihn Wunder thun; hätte ich keine Ursache zu zweifeln gehabt, daß es wahre Wunder gewesen: so würde ich zu einem, von so langeher ausgezeichneten, wunderthätigen Mann, allerdings so viel Vertrauen gewonnen haben, daß ich willig meinen Verstand dem Seinigen unterworfen hätte; daß ich ihm in allen Dingen geglaubt hätte, in welchen eben so ungezweifelte Erfahrungen ihm nicht entgegen gewesen wären.
Oder; wenn ich noch itzt erlebte, daß Christum oder die christliche Religion betreffende Weissagungen, von deren Priorität ich längst gewiß gewesen, auf die unstreitigste Art in Erfüllung gingen; wenn noch itzt von gläubigen Christen Wunder gethan würden, die ich für echte Wunder erkennen müßte: was könnte mich abhalten, mich diesem Beweis des Geistes und der Kraft, wie ihn der Apostel nennt, zu fügen? (3 f.)
|47◄ ►48|
Lessing bestreitet nun aber in der Tat, dass zu seiner Zeit Lehren weiter anerkannt werden müssen, die ihre Begründung in geschichtlichen Ereignissen haben, für die es zur Zeit Lessings keine Analogien und Evidenzen mehr gibt, weil sich die Vorstellungswelt des menschlichen Geistes fortentwickelt hat, wie er es in seiner Schrift Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780) beschreibt. Die geschichtlichen Offenbarungen werden von Lessing gleichsam als pädagogische Beschleunigungen eines geschichtlichen Entwicklungsprozesses der Vernunft verstanden, der sich grundsätzlich auch ohne sie vollzogen hätte, dann aber entschieden langsamer. Die Religion hat vermittels der geschichtlichen Offenbarungen dem Menschengeschlecht die Möglichkeit geboten, eine neue Entwicklungsstufe zu erreichen und damit die Zeit der Entwicklung aufs Ganze gesehen zu verkürzen. Aber das Wesen der Religion kann weder aus diesen Offenbarungen abgeleitet noch gar an sie gebunden werden. Es macht keinen Sinn, diese geschichtlichen Katalysatoren nun an sich zu verehren, indem sie aus ihrer Geschichtlichkeit in die Grundsätzlichkeit einer überzeitlich anzuerkennenden Wahrheit gehoben werden. Vielmehr verlieren sie ihre Bedeutung, wenn sie ihre Funktion erfüllt haben.
Das Wesen der Religion ist jenseits von diesen geschichtlichen Offenbarungen zu suchen. Es liegt in einer dem Menschen entsprechenden tragfähigen Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens nach Maßgabe der Vernunft. Das Geheimnis der Religion – so legt es Lessing in der berühmten Ringparabel in seinem Drama Nathan der Weise (1779) dar – liegt in der Wunderkraft, in der sie die Menschen gegenseitig und vor Gott beliebt und angenehm macht. Daran wird sich die Echtheit einer Religion entscheiden. Blickt sie nur auf sich selbst und liebt somit auch nur sich selbst, so ist sie falscher Schein – es muss sich um einen unechten Ring handeln, der nur vorgibt, ein Geheimnis zu haben. Es ist der weise Rat des Richters über die drei Religionen – Judentum, Christentum und Islam –, deren Erbe durch den jeweils gleichen Ring symbolisiert wird, dass sich die Echtheit nicht an der Religion selbst erweisen kann – möglicherweise sind alle drei Ringe Kopien und somit ‚unecht‘. Die Echtheit der Religion kann sich allein an dem erweisen, was von ihr für die Menschheit ausgeht.
Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater:
So glaube jeder sicher seinen Ring den echten. –
Möglich, daß der Vater nun die Tyranney des Einen Rings nicht länger
In seinem Hause dulden wollen! – Und gewiß,
Daß er euch alle drey geliebt, und gleich geliebt: indem er zwey nicht drücken mögen,
Um einen zu begünstigen. – Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochenen
Von Vorurtheilen freyen Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring’ an Tag zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmuth,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohlthun, mit innigster Ergebenheit in Gott,
Zu Hülf’! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bey euern Kindes-Kindeskindern äußern:
So lad’ ich über tausend tausend Jahre, |48◄ ►49|
Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird
Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen,
Als ich, und sprechen. Geht! – So sagte der
Bescheidne Richter.55
Gern wird Lessing als Pionier der Toleranz zwischen den Religionen ausgegeben. Das wird man nur mit größter Zurückhaltung so aufrechterhalten können, denn ihm geht es mehr um die Verlagerung der Wahrheitsfrage von der Lehr- und Bekenntnisebene auf die Praxisebene als um die Anerkennung verschiedener Wahrheitsansprüche unterschiedlicher Religionen. Vielmehr ergibt sich aus der genannten Verlagerung mit innerer Notwendigkeit, dass die traditionell unterschiedenen Religionen gleichsam unversehens in einer Religion zusammenfallen, auch wenn sie sich dabei auf unterschiedliche Traditionen berufen. Nicht die Traditionen sind das Entscheidende – und deshalb stellt sich im Grunde auch gar nicht die Frage ihrer gegenseitigen Anerkennung –, sondern gerade der Erweis der einen gemeinsamen praktischen Wahrheit.
M. Fick, Lessing-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 22004 F. Niewöhner, Veritas sive varietas. Lessings Toleranzparabel und das Buch von den drei Betrügern, Heidelberg 1988
9. Immanuel Kant
Die deutsche Aufklärung erreicht mit den Kritiken des Königsberger Philosophen Immanuel Kant (1724 – 1804) ihren Höhepunkt und zugleich auch ihre Grenze. Neben den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis bewegte Kant vor allem die Frage der Beerbung der traditionellen Metaphysik durch die sittliche Selbstkonstitution des Menschen.
Mit der Kritik der reinen Vernunft eröffnete Kant 1781 die Reihe seiner berühmten Kritiken, mit denen er gleichsam das ganze Themenfeld der Philosophie abschreitet und auf einen selbstkritisch revidierten Stand zu bringen versucht. Ebenso wie in vielen anderen seiner Schriften kommt der zumindest indirekten Auseinandersetzung mit der Religion auch in dieser erkenntnistheoretischen Grundlagenschrift eine große Bedeutung zu. Kant setzt sich mit den traditionellen Gottesbeweisen (dem ontologischen, dem kosmologischen und dem physikotheologischen Gottesbeweis) auseinander und kommt zu dem ebenso klaren wie schlichten Resultat, dass sie alle keinen tragfähigen Gehalt haben.
Ich behaupte nun, daß alle Versuche eines bloß spekulativen Gebrauchs der Vernunft in Ansehung der Theologie gänzlich fruchtlos und ihrer inneren Beschaffenheit nach null und nichtig sind; daß aber die Prinzipien ihres Naturgebrauchs ganz und gar auf keine Theologie führen, |49◄ ►50| folglich, wenn man nicht moralische Gesetze zum Grunde legt, oder zum Leitfaden braucht, es überall keine Theologie der Vernunft geben könne. Denn alle synthetischen Grundsätze des Verstandes sind von immanenten Gebrauch; zu der Erkenntnis eines höchsten Wesens aber wird ein transzendenter Gebrauch derselben erfordert, wozu unser Verstand gar nicht ausgerüstet ist. Soll das empirisch gültige Gesetz der Kausalität zu dem Urwesen führen, so müßte dieses in die Kette der Gegenstände der Erfahrung mitgehören; alsdann wäre es aber, wie alle Erscheinungen, selbst wiederum bedingt.56
Die auf möglichst nüchterne Erkenntnis ausgerichtete Vernunft bleibt auf Anschauung angewiesen, der es hinsichtlich der Thematisierung Gottes gerade ermangelt, sodass es keine Gotteserkenntnis im Sinne exakter unvoreingenommener Erkenntnis geben kann. Das Zitat benennt bereits den Horizont, in dem die Theologie ihren Gegenstand findet: das moralische Gesetz. Es ist der Horizont der praktischen Vernunft, die den Bestimmungen der für den Menschen essenziellen Möglichkeit moralischer Verantwortlichkeit nachgeht und in dem sich auf spezifische Weise nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit ergibt, Gott zu denken. Die Notwendigkeit, von der hier die Rede ist, erscheint als eine Implikation eben der Notwendigkeit, die eine Erweiterung der reinen Vernunft hin zur praktischen Vernunft erforderlich macht. Nicht schon die Erkenntnis macht den Menschen zum Menschen, sondern erst die Möglichkeit sittlich verantwortlicher und d. h. freier Verwirklichung. Ohne die Ausrichtung des Lebens auf ein sittlich zu erreichendes Ziel, das Kant das höchste Gut nennt, bleibt der Mensch fremdbestimmt und damit unter seinem eigentlichen Niveau. Die apriorische Gegebenheit dieses Erfordernisses verlangt nach einem entsprechenden Gebrauch der Vernunft, den Kant die praktische Vernunft nennt. Das folgende grundlegende Zitat erschließt sich nur bei langsamer und möglicherweise auch mehrfacher Lektüre:
Um eine reine Erkenntnis praktisch zu erweitern, muß eine Absicht a priori gegeben sein, d. i. ein Zweck als Objekt (des Willens), welches unabhängig von allen theoretischen Grundsätzen, durch einen den Willen unmittelbar bestimmenden (kategorischen) Imperativ, als praktisch notwendig vorgestellt wird; und das ist hier das höchste Gut. Dieses ist aber nicht möglich, ohne drei theoretische Begriffe (für die sich, weil sie bloße reine Vernunftbegriffe sind, keine korrespondierende Anschauung, mithin auf dem theoretischen Wege keine objektive Realität finden läßt) vorauszusetzen: nämlich Freiheit, Unsterblichkeit und Gott. Also wird durchs praktische Gesetz, welches die Existenz des höchsten in einer Welt möglichen Guts gebietet, die Möglichkeit jener Objekte der reinen spekulativen Vernunft, die objektive Realität, welche diese ihnen nicht sichern konnte, postuliert; wodurch denn die theoretische Erkenntnis der reinen Vernunft allerdings einen Zuwachs bekommt, der aber bloß darin besteht, daß jene für sie sonst problematischen (bloß denkbaren) Begriffe jetzt assertorisch für solche erklärt werden, denen wirkliche Objekte zukommen, weil praktische Vernunft die Existenz derselben zur Möglichkeit ihres und zwar praktisch schlechthin notwendigen Objekts des höchsten Guts, unvermeidlich bedarf, und die theoretische dadurch berechtigt wird, sie vorauszusetzen.57
|50◄ ►51|
Gott wird nicht aufgewiesen, sondern er ist – ebenso wie die Freiheit und die Unsterblichkeit der Seele – ein zwingendes Postulat, ohne das die den Menschen ausmachende Sittlichkeit nicht recht gedacht werden kann. Gott wird verstanden als Ursache und Garant des höchsten Guts, in dessen Pflicht sich die Sittlichkeit weiß und um dessen willen der Mensch seine Freiheit betätigt. Religion entspringt nach Kant keiner Offenbarung, sondern sie ist das elementare Bedürfnis der Moral, die durch die reine praktische Vernunft bestimmt wird.
Unter Glaubenssätzen versteht man nicht, was geglaubt werden soll (denn das Glauben verstattet keinen Imperativ), sondern das, was in praktischer (moralischer) Absicht anzunehmen möglich und zweckmäßig, obgleich nicht eben erweislich ist, mithin nur geglaubt werden kann.58
Seinem Wesen nach ist der Glaube anschauungslos und gegenstandslos, er dient tatsächlich vor allem der moralischen Erbauung des Menschen.
Das ist der Hintergrund für Kants Unterscheidung zwischen einem vernünftigen Religionsglauben und dem Kirchenglauben. Die „wahre, alleinige Religion“ (der Singular ist bemerkenswert) ist von der statuarischen Religion, wie sie im Kirchenglauben in seinen verschiedenen Variationen auftritt, zu unterscheiden. Kant kann auch von der einen wahren Religion und den vielerlei Arten des Glaubens im Sinne der Konfessionen und verschiedenen Religionen sprechen, in denen je auf besondere Weise die wahre Religion verborgen enthalten ist.59 Zugespitzt heißt es:
Die wahre, alleinige Religion enthält nichts als Gesetze, d. i. solche praktische Principien, deren unbedingter Nothwendigkeit wir uns bewußt werden können, die wir also durch reine Vernunft (nicht empirisch) offenbart erkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, deren es verschiedene gleich gute Formen geben kann, kann es Statuten, d. i. für göttlich gehaltene Verordnungen, geben, die für unsere reine moralische Beurtheilung willkürlich und zufällig sind. Diesen statuarischen Glauben nun (der allenfalls auf ein Volk eingeschränkt ist und nicht die allgemeine Weltreligion enthalten kann) für wesentlich zum Dienste Gottes überhaupt zu halten und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen Wohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein Religionswahn, dessen Befolgung ein Afterdienst, d. i. eine solche vermeintliche Verehrung Gottes ist, wodurch dem wahren, von ihm selbst geforderten Dienste gerade entgegen gehandelt wird. (167 f.)
Die „sogenannten Religionsstreitigkeiten, welche die Welt so oft erschüttert und mit Blut bespritzt haben, [sind] nie etwas anderes als Zänkereien um den Kirchenglauben gewesen“ (108). Die verschiedenen kirchlichen Traditionen können immer nur partikulare Bedeutung beanspruchen, während die wahre Religion einen universalen Anspruch erhebt. Doch die Kirchen sind noch weit davon entfernt, ihre eigene Partikularität wahrzunehmen und daraus im Verhältnis zu den anderen die richtigen Schlüsse zu ziehen.
|51◄ ►52|
Wenn nun eine Kirche sich selbst, wie gewöhnlich geschieht, für die einige allgemeine ausgiebt (ob sie zwar auf einen besondern Offenbarungsglauben gegründet ist, der als historisch nimmermehr von jedermann gefordert werden kann): so wird der, welcher ihren (besondern) Kirchenglauben gar nicht anerkennt, von ihr ein Ungläubiger genannt und von ganzem Herzen gehaßt; der nur zum Theil (im Nichtwesentlichen) davon abweicht, ein Irrgläubiger und wenigstens als ansteckend vermieden. Bekennt er sich endlich zwar zu derselben Kirche, weicht aber doch im Wesentlichen des Glaubens derselben (was man nämlich dazu macht) von ihr ab, so heißt er, vornehmlich wenn er seinen Irrglauben ausbreitet, ein Ketzer und wird so wie ein Aufrührer noch für strafbarer gehalten als ein äußerer Feind und von der Kirche durch einen Bannfluch (dergleichen die Römer über den aussprachen, der wider des Senats Einwilligung über den Rubicon ging) ausgestoßen und allen Höllengöttern übergeben. Die angemaßte alleinige Rechtgläubigkeit der Lehrer oder Häupter einer Kirche in dem Punkte des Kirchenglaubens heißt Orthodoxie, welche man wohl in despotische (brutale) und liberale Orthodoxie eintheilen könnte. – Wenn eine Kirche, die ihren Kirchenglauben für allgemein verbindlich ausgiebt, eine katholische, diejenige aber, welche sich gegen diese Ansprüche anderer verwahrt (ob sie gleich diese öfters selbst gerne ausüben möchte, wenn sie könnte), eine protestantische Kirche genannt werden soll: so wird ein aufmerksamer Beobachter manche rühmliche Beispiele von protestantischen Katholiken und dagegen noch mehrere anstößige von erzkatholischen Protestanten antreffen; die erste von Männern einer sich erweiternden Denkungsart (ob es gleich die ihrer Kirche wohl nicht ist), gegen welche die letzteren mit ihrer eingeschränkten gar sehr, doch keineswegs zu ihrem Vortheil abstechen. (108 f.)
Nach Kants Vorstellung käme es darauf an, dass sich die historischen Religionen mehr und mehr der wahren Religion annähern. Nur so ist den anhaltenden widervernünftigen Streitereien wirksam zu begegnen. Faktisch geht der Vorschlag in die Richtung eines schrittweisen Abbaus der kultischen und gottesdienstlichen Elemente, die vor allem als Ausdruck eines Fron- bzw. Lohnglaubens zu bewerten seien, zugunsten der einen moralischen Religion.
Vom Staat erwartet Kant religiöse Neutralität. Dass sich diese auch für Kant nicht einfach außerhalb der eigenen Interessen des Staates vollzieht, zeigt sich darin, dass die Neutralität ihre Grenzen da hat, wo es um die eigenen Ansprüche an seine Bürger geht: „Was den Staat in Religionsdingen allein interessieren darf, ist: wozu die Lehrer derselben anzuhalten sind, damit er nützliche Bürger, gute Soldaten und überhaupt getreue Unterthanen habe.“60
O. Höffe, Immanuel Kant, München 72007
U. Schultz, Immanuel Kant in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 2003
EXKURS: Eine Glosse über Kant von Heinrich Heine
Auch wenn die eigene Stellung von Heinrich Heine (1797 – 1856) zur Religion ein eigenes interessantes Thema wäre, beschränken wir uns hier auf seinen Kommentar zu Kant, wie er sich in der überaus gewitzten Schrift Zur Geschichte der Religion und |52◄ ►53| Philosophie in Deutschland (1834) findet. Mit journalistischem Schwung, scharfer Zunge, plastischer bis drastischer Bildlichkeit und ebenso umsichtiger wie treffsicherer Zuspitzung lässt Heine eine lebendige, ja beinahe spielerisch inszenierte Geschichte ablaufen, hinter deren großartiger Fassade sich allzumeist ganz ‚menschliche‘, und man kann wohl sagen, allzu menschliche Vorgänge verbergen. Doch es ist nicht nur die faszinierende Art, wie es Heine gelingt, die ‚große‘ Philosophie auf den Boden zu ziehen, sondern vor allem die scharfsinnige Diagnose der in seinen Augen eher verfahrenen Situation, die dem für die französische Zeitschrift Revue des deux mondes abgefassten Text einen besonderen Reiz gibt. Es werden ledig ein paar Beobachtungen zu Kant herangezogen und zwar zu seinem aus Gründen der praktischen Vernunft postulierten Gott auf dem Hintergrund seiner Kritik der reinen Vernunft:
Nach der Tragödie kommt die Farce. Immanuel Kant hat bis hier den unerbittlichen Philosophen trazirt, er hat den Himmel gestürmt, er hat die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen, der Oberherr der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute, es giebt keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte, keine jenseitige Belohnung für diesseitige Enthaltsamkeit, die Unsterblichkeit der Seele liegt in den letzten Zügen – das röchelt, das stöhnt – und der alte Lampe steht dabei mit seinem Regenschirm unterm Arm, als betrübter Zuschauer, und Angstschweiß und Thränen rinnen ihm vom Gesichte. Da erbarmt sich Immanuel Kant und zeigt, daß er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein guter Mensch ist, und er überlegt, halb gutmüthig und halb ironisch spricht er: ‚der alte Lampe muß einen Gott haben, sonst kann der arme Mensch nicht glücklich seyn – der Mensch soll aber auf der Welt glücklich seyn – das sagt die praktische Vernunft – meinetwegen – so mag auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen.‘ In Folge dieses Arguments, unterscheidet Kant zwischen der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft, und mit dieser, wie mit einem Zauberstäbchen, belebte er wieder den Leichnam des Deismus, den die theoretische Vernunft getödtet.
Hat vielleicht Kant die Resurekzion nicht bloß des alten Lampe wegen, sondern auch der Polizei wegen unternommen? Oder hat er wirklich aus Ueberzeugung gehandelt?24
10. Der Idealismus
10.1 Johann Gottlieb Fichte
Die konsequente Entpersonalisierung Gottes zu dem übersinnlichen Inbegriff allen Seins brachte Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814) den Vorwurf des Atheismus ein.
Fichte ist als konsequenter Denker der Freiheit in die Geschichte eingegangen. Anknüpfend an Kant, der Freiheit, Gott und die Unsterblichkeit der Seele aus einer Notwendigkeit der praktischen Vernunft heraus postulierte, bestimmt |53◄ ►54| Fichte nun Gott als eine im Menschen liegende Idee des moralischen Gesetzgebers, in der die Freiheit des Menschen begründet ist. Der Glaube an Gott ist „nichts anderes, als der Glaube an jene Ordnung, deren Begriff sie nur, ihnen selbst unbewusst, ... weiter entwickelt und bestimmt haben“.25 Im menschlichen Geist steht Gott für die intelligible Ordnung, die so wie die Naturordnung maßgeblich ist für seine äußerliche Praxis. Jeder außerhalb des Menschen existierende Gott bedeutete unweigerlich eine Gefährdung seiner Freiheit, sodass Fichte einen sich durch Offenbarung in Szene setzenden Gott für eine den Menschen entwürdigende Vorstellung hält.61 Eine angemessene ‚Bestimmung des Menschen‘ kann nicht aus irgendwelchen Abhängigkeiten gewonnen werden, sondern allein aus einer konsequenten Selbstbesinnung in der Perspektive auf die Gewinnung eines freien Selbstbewusstseins. Damit hat Fichte die Spaltung von Subjekt und Objekt als Grundlage für die Philosophie außer Kraft gesetzt.
Die entscheidende Alternative, vor die Fichte den Menschen gestellt sieht, besteht auf der einen Seite in der Unterwerfung unter die Bestimmungen der Natur oder auf der anderen Seite in der freien Selbstkonstitution mit Hilfe des im Menschen liegenden Geistes.
Ich wollte nicht Natur, sondern mein eigenes Werk seyn; und ich bin es geworden, dadurch dass ich es wollte. Ich hätte durch unbegrenzte Klügelei die natürliche Ansicht meines Geistes zweifelhaft machen und verdunkeln können. Ich habe mich der Freiheit hingegeben, weil ich mich ihr hingeben wollte. ... Ich habe mit Freiheit und Bewusstseyn mich selbst in den Standpunct zurückversetzt, auf welchem auch meine Natur mich verlassen hatte. Ich nehme dasselbe an, was auch sie aussagt; aber ich nehme es nicht an, weil ich muss, sondern ich glaube es, weil ich will.27
Gott wird nicht als persönliches Wesen gedacht, sondern er erscheint in der Latenz der moralischen Praxis, d. h. in der lebendigen moralischen Ordnung.
Jene lebendige und wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen keines anderen Gottes und können keinen anderen fassen. Es liegt kein Grund in der Vernunft, aus jener moralischen Weltordnung herauszugehen, und vermittels eines Schlusses vom Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen, als Ursache desselben, anzunehmen; der ursprüngliche Verstand macht sonach diesen Schluss sicher nicht, und kennt kein solches besonderes Wesen; nur eine sich selbst misverstehende Philosophie macht ihn. Ist denn jene Ordnung ein Zufälliges, welches seyn könnte, oder auch nicht, so seyn könnte, wie es ist, oder auch anders; dass ihr ihre Existenz und Beschaffenheit erst aus einem Grunde erklären, erst vermittels Aufzeigung dieses Grundes den Glauben an dieselbe legitimieren müsstet? Wenn ihr nicht mehr auf die Forderungen eines nichtigen Systems hören, sondern euer eigenes Inneres befragen werdet, werdet ihr finden, dass jene Weltordnung das absolut Erste aller objectiven Erkenntnis ist, gleichwie eure Freiheit und moralische Bestimmung das absolut erste |54◄ ►55| aller subjectiven; dass alle übrige objective Erkenntnis durch sie begründet und bestimmt werden muss, sie aber schlechthin durch kein anderes bestimmt werden kann, weil es über sie hinaus nichts giebt.62
Fichtes Kritik gilt insbesondere dem Schöpfergott, denn durch ihn würde das in sich selbst gründende Ich wieder auf einen außer ihm liegenden Grund zurückgeführt. So gewiss es eine moralische Weltordnung gebe, so gewiss gebe es auch Gott als den Willen zur Verwirklichung, als den im Gesetz enthaltenen und dieses tragenden reinen Akt der Sittlichkeit, der das Ich im Ruf zur Pflicht ins absolute Sein stelle, sodass sich das Ich nicht aus der Individualität, sondern aus seiner Partizipation am reinen geistigen Leben in seiner Freiheit begreift. Gott ist auf diese Weise unauflöslich mit dem Sichselbstwerden der Menschheit verquickt. Von hier aus gesehen erscheint Fichte der von den Kirchen gepredigte Gott als ein Götze, der durch menschliche Bestimmungen zu etwas Endlichem degradiert sei und damit der sinnlichen Genusssucht des Menschen angepasst worden sei. Dabei hat Fichte besonders die Gnadenlehre der Kirche (vor allem die auf Paulus zurückgehende Lehre der Reformation) im Auge, durch die ein übermächtiger – und damit heidnischer – Gott das Verderben der Menschheit noch unterstützt bzw. sogar verewigt. Diese Rechtfertigungsvorstellung wird durch die Vorstellung von der Wiedergeburt des Menschen ersetzt, die nicht im Horizont von Schuld und Vergebung, sondern – mit E. Hirsch gesprochen – „rein als der Akt, durch den der Mensch aus einem sinnlich-nichtigen Scheindasein in das wahre göttliche Leben, das Leben der das Heilige, Gute, Schöne ersehenden und verwirklichenden Freiheit tritt“,63 beschrieben wird. Wenn man so will, ist die Gewissheit, dass in der wahren menschlichen Freiheit Gott lebe, der einzige Haftpunkt für die Rede von der Gnade. So beabsichtigt Fichte mit seinem Religionsverständnis vor allem,
dem Menschen alle Stützen seiner Trägheit, und alle Beschönigungsgründe seines Verderbens zu entreissen, alle Quellen seines falschen Trostes zu verstopfen; und weder seinem Verstande noch seinem Herzen irgendeinen Standpunct übrig zu lassen, als den der reinen Pflicht und des Glaubens an die übersinnliche Welt. ... Unsere Philosophie läugnet nicht alle Realität; sie läugnet nur die Realität des Zeitlichen und Vergänglichen, um die des Ewigen und Unvergänglichen in seiner ganze Würde einzusetzen. Es ist sonderbar, diese Philosophie der Abläugnung der Gottheit zu bezüchtigen, da sie vielmehr die Existenz der Welt, in dem Sinne, wie sie vom Dogmatismus behauptet wird, abläugnet. ... Unsere Philosophie läugnet die Existenz eines sinnlichen Gottes, und eines Dieners der Begier; aber der übersinnliche Gott ist ihr Alles in Allem; er ist ihr derjenige, welcher allein ist; und wir anderen vernünftigen Geister alle leben und weben nur in ihm.30
Entschlossen wehrt sich Fichte gegen den ihm vorgehaltenen Vorwurf, dass er Atheist sei, indem er den Spieß umdreht und nun seinerseits aller auf die eigene Glückseligkeit |55◄ ►56| ausgerichteten Frömmigkeit offensiv vorwirft, dass sie ungeistlich und keiner ernsthaft so zu nennenden Religion würdig sei.
Wer da Genuss will, ist ein sinnlicher, fleischlicher Mensch, der keine Religion hat und keiner Religion fähig ist; die erste wahrhaft religiöse Empfindung ertödtet in uns auf immer die Begierde. Wer Glückseligkeit erwartet, ist ein mit sich selbst und seiner ganzen Anlage unbekannter Tor; es giebt keine Glückseligkeit, es ist keine Glückseligkeit möglich; die Erwartung derselben, und ein Gott, den man ihr zufolge annimmt, sind Hirngespinnste. Ein Gott, der der Begier dienen soll, ist ein verächtliches Wesen; er leistet einen Dienst, der selbst jedem erträglichen Menschen ekelt. Ein solcher Gott ist ein böses Wesen; denn er unterstützt und verewigt das menschliche Verderben, und die Herabwürdigung der Vernunft. Ein solcher Gott ist ganz eigentlich ‚der Fürst der Welt‘, der schon längst durch den Mund der Wahrheit, welchem sie die Worte verdrehen, gerichtet und verurtheilt ist. Ihr Dienst ist Dienst dieses Fürsten. Sie sind die wahren Atheisten, sie sind gänzlich ohne Gott, und sie haben sich einen heillosen Götzen geschaffen. Dass ich diesen ihren Götzen nicht statt des wahren Gottes will gelten lassen, dies ist, was sie Atheismus nennen; dies ists, dem sie Verfolgung geschworen haben.
Das System, in welchem von einem übermächtigen Wesen Glückseligkeit erwartet wird, ist das System der Abgötterei und des Götzendienstes, welches so alt, als das menschliche Verderben, und mit dem Fortgange der Zeit bloss seine äußere Gestalt verändert hat. Sey dies übermächtige Wesen ein Knochen, eine Vogelfeder, oder sey es ein allmächtiger, allgegenwärtiger, allkluger Schöpfer Himmels und der Erde; – wenn von ihm Glückseligkeit erwartet wird, so ist es ein Götze. ...
... Mir ist Gott ein von aller Sinnlichkeit und allem sinnlichen Zusatze gänzlich befreites Wesen, welchem ich daher nicht einmal den mir allein möglichen sinnlichen Begriff der Existenz zuschreiben kann. Mir ist Gott bloss und lediglich Regent der übersinnlichen Welt. Ihren Gott läugne ich und warne vor ihm, als vor einer Ausgeburt des menschlichen Verderbens, und werde dadurch keineswegs zum Gottesläugner, sondern zum Vertheidiger der Religion. Meinen Gott kennen sie nicht und vermögen sich nicht zu dessen Begriffe zu erheben. Er ist für sie gar nicht da, sie können ihn sonach auch nicht läugnen, und sind in dieser Rücksicht nicht Atheisten. Aber sie sind ohne Gott; und sind in dieser Rücksicht Atheisten. – Aber es ist fern von meinem Herzen, sie auf eine gehässige Weise mit dieser Benennung zu bezeichnen. Meine Religion lehrt mich vielmehr, sie zu bedauern, dass sie das höchste und edelste gegen das geringsfügigste aufgeben. Diese Religion lehrt mich hoffen, dass sie über kurz oder lang ihren bejammernswürdigen Zustand entdecken, und alle Tage ihres Leben für verloren betrachten werden, gegen das ganz neue und herrliche Daseyn, welches ihnen dann aufgehen wird. (219 f.)
Fichte unterscheidet im Blick auf das Christentum sein wahres Wesen, das identisch ist mit der von ihm vertretenen wahren Religion, und seiner historischen Erscheinung, den ‚Christianismus‘, zu dem er alles Dogmatische und Konfessionelle zählt. Es ist deutlich, dass er dabei an Kant anknüpft, dann aber in der Konzentration auf das absolute Selbstbewusstsein und die Freiheit seinen eigenen Weg beschreitet.
Chr. Asmuth, Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei J. G. Fichte, Stuttgart 1999
W. G. Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, Reinbek 31998
|56◄ ►57|
10.2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
In seiner Geistphilosophie beerbt Georg W. F. Hegel (1770 – 1831 ) die Theologie, die er an ihr Ende gekommen sieht, indem er die Wahrheit des Christentums als die absolute Religion auf ihren Begriff bringt.
In der integralen Geistphilosophie Hegels hat der Idealismus zu seiner am vollkommensten ausgeprägten Gestalt gefunden. Zugleich war es gerade diese spekulative Geistphilosophie, von der sich dann die Religionskritik im 19. Jahrhundert (Ludwig Feuerbach [→ § 4,2.4], Max Stirner [→ § 4,2.5], Karl Marx [→ § 4,3.3] u. a.) entschlossen abgekehrt hat. Es ist in gewisser Weise die Selbstüberschreitung der Aufklärung durch ihre eigene Apotheose, die Hegel mit seiner spekulativen Systematik ebenso eindruckvoll wie letztlich auch befremdend vor Augen stellt und damit einen Gipfel erklimmt, der bisher durchaus achtsam vor jeder Inbesitznahme geschützt worden ist. Es kann nur wenig verwundern, wenn der mit Hegel erreichte Höhepunkt auch einen Schlusspunkt in einer Entwicklung darstellt, der keine weiteren Entwicklungsperspektiven mehr eingeräumt werden können. In dem Moment, wo Zweifel an den Konstruktionsprinzipien dieses Wirklichkeitskonzepts Platz greifen, führt dies nicht zu Korrekturen, sondern es steht sofort das ganze Konzept in Frage. Es ist, wenn man so will, bei aller Systematik eben auch eine bekennende Philosophie, die ohne ihr tragendes Bekenntnis zum Geist in sich zusammenfällt.
In seinen Frühschriften finden sich religionskritische Äußerungen im Sinne der französischen Revolution (insbesondere J.-J. Rousseau [→ § 2,7]) und dem Geist von Lessing (→ § 2,8) und Kant (→ § 2,9).64 Hervorzuheben wäre die Abhandlung „Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als kantische, jacobische und fichtische Philosophie“ (1802) mit der die gegenwärtige Glaubenssituation charakterisierenden berühmten, allerdings meist unangemessen interpretierten Formulierung „Gott selbst ist tot“.65 Hegels Überlegungen zur kritischen Grundlegung der Religionsphilosophie finden sich in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Religion (1821 – 1831) und in den Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821).
Das Christentum als die ‚absolute Religion‘ soll mit Hilfe der Philosophie von den Glaubensmysterien in eine vollkommene Gestalt einer reinen Geist-Religion überführt werden, in der sie von der überzeugten Vernunft einen verlässlichen Schutz in Anspruch nehmen kann. Religion wird dabei als das durch den endlichen Geist vermittelte Selbstbewusstsein des absoluten Geistes verstanden. Es ist keine andere Wahrheit in der Religion bestimmend, sondern es ist ein anderes Verhältnis zur Wahrheit, das die Religion von der Philosophie unterscheidet. Wie die Religion durch das Gefühl bestimmt wird, so rechtfertigt die Philosophie dieses Gefühl in denkendem Bewusstsein.
|57◄ ►58|
Der Philosophie ist der Vorwurf gemacht worden, sie stelle sich über die Religion: dies ist aber schon dem Faktum nach falsch, denn sie hat nur diesen und keinen anderen Inhalt [sc. Die Wahrheit], aber sie gibt ihn in der Form des Denkens; sie stellt sich so nur über die Form des Glaubens, der Inhalt ist derselbe.
Die Form des Subjekts als fühlenden Einzelnen usf. geht das Subjekt als einzelnes an; aber das Gefühl als solches ist nicht von der Philosophie ausgestoßen. Es ist die Frage nur, ob der Inhalt des Gefühls die Wahrheit sei, sich im Denken als der wahrhafte erweisen kann. Die Philosophie denkt, was das Subjekt als solches fühlt, und überläßt es demselben, sich mit seinem Gefühl darüber abzufinden. Das Gefühl ist so nicht durch die Philosophie verworfen, sondern es wird ihm durch dieselbe nur der wahrhafte Inhalt gegeben.
Aber insofern das Denken anfängt, sich in Gegensatz zu setzen gegen das Konkrete, so ist der Prozeß des Denkens, diesen Gegensatz durchzumachen, bis er zur Versöhnung kommt. Diese Versöhnung ist die Philosophie: die Philosophie ist insofern Theologie; sie stellt dar die Versöhnung Gottes mit sich selbst und mit der Natur, daß die Natur, das Anderssein an sich göttlich ist und daß der endliche Geist teils an ihm selbst dies ist, sich zur Versöhnung zu erheben, teils in der Weltgeschichte zu dieser Versöhnung kommt.66
Hegel ist mit dem Anspruch aufgetreten, mit seiner Religionsphilosophie der rechtmäßige Erbe der Theologie zu sein, die definitiv an ihr Ende gekommen sei. Die Theologie sei nicht einmal mehr über ihre eigene Tradition wirklich auskunftsfähig oder ergehe sich in Historisierungen, sodass die von ihr zu vertretende Wahrheit unbedacht brachliegen würde, wenn sie nicht von der Philosophie aufgegriffen und auf ihren Begriff hin reflektiert würde. Die neuere Theologie habe den größten Teil der überkommenen christlichen Lehre zugunsten einer „beinahe universelle[n] Gleichgültigkeit“67 aufgegeben. Das deutlichste Zeichen für die Verlegenheit der Theologie zeige sich in der dominierenden Neigung, den Lehrbestand der Tradition zu historisieren.
Das größte Zeichen aber, daß die Wichtigkeit dieser Dogmen gesunken ist, gibt sich uns darin zu erkennen, daß sie vornehmlich historisch behandelt und in das Verhältnis gestellt werden, daß es die Überzeugungen seien, die anderen angehören, daß es Geschichten sind, die nicht in unserem Geiste selbst vorgehen, nicht das Bedürfnis unseres Geistes in Anspruch nehmen....
Die absolute Entstehungsweise aus der Tiefe des Geistes und so die Notwendigkeit, Wahrheit dieser Lehren, die sie auch für unseren Geist haben, ist bei der historischen Behandlung auf die Seite geschoben: sie ist mit vielem Eifer und Gelehrsamkeit mit diesen Lehren beschäftigt, aber nicht mit dem Inhalt, sondern mit der Äußerlichkeit der Streitigkeiten darüber und mit den Leidenschaften, die sich an diese äußerliche Entstehungsweise angeknüpft haben. Da ist die Theologie durch sich selbst niedrig genug gestellt. Wird das Erkennen der Religion nur historisch gefaßt, so müssen wir die Theologen, die es bis zu dieser Fassung gebracht haben, wie Kontorbediente eines Handelshauses ansehen, die nur über fremden Reichtum Buch und Rechnung führen, die nur für andere handeln, ohne eigenes Vermögen zu bekommen; sie erhalten zwar Salär; ihr Verdienst ist aber nur, zu dienen und zu registrieren, was das Vermögen |58◄ ►59| anderer ist. Solche Theologie befindet sich gar nicht mehr auf dem Felde des Gedankens, hat es nicht mehr mit dem unendlichen Gedanken an und für sich, sondern mit ihm nur als einer endlichen Tatsache, Meinung, Vorstellung usf. zu tun. (47 f.)
Im Unterschied zu Fichte tritt bei Hegel die Polemik weitgehend in den Hintergrund zugunsten einer Systematisierung der gesamten Wirklichkeit, die im absoluten Geist Gottes sowohl ihren Zielpunkt als auch ihren Ausgangpunkt hat. Die Theologie wird zu einem Bestandteil der Philosophie, so wie die Philosophie ihrem Wesen nach nur dann recht Philosophie sein kann, wenn sie auch Religionsphilosophie ist, nicht nur irgendwo am Rande, sondern essenziell. Wenn es um eine Wahrheit geht, die unsere Subjektivität transzendiert und somit wirklich Anspruch auf Wahrheit erheben kann, so wird die Unterscheidung von Theologie und Philosophie redundant.
Der Gegenstand der Religion wie der Philosophie ist die ewige Wahrheit in ihrer Objektivität selbst, Gott und nichts als Gott und die Explikation Gottes. ... Die Philosophie expliziert daher nur sich, indem sie die Religion expliziert, und indem sie sich expliziert, expliziert sie die Religion. ... So fällt Religion und Philosophie in eins zusammen, die Philosophie ist in der Tat selbst Gottesdienst, ist Religion, denn sie ist dieselbe Verzichtung auf subjektive Einfälle und Meinungen in der Beschäftigung mit Gott. (28)
Es wird noch einmal bestätigt, dass nicht der Gegenstand, sondern lediglich die begriffliche Art und Weise, in der sich die Philosophie mit Gott beschäftigt, von der Religion unterschieden ist.
Gott ist seinem Wesen nach Geist – Geist als Geist. Indem ihm keine endlichen Bestimmungen zugemessen werden können und dürfen, ist er absoluter Geist, nach dem sich der Mensch mit seinem objektiven, weil immer auch bedingten Geist auszurichten vermag. Es wird gleichsam unter Wahrung größtmöglicher Nähe zum absoluten Geist ein umfassendes Gebäude errichtet, in dem in verschiedenen Abteilungen die ganze von Gott angestoßene und wieder auf ihn zulaufende Geschichte des Menschen so verwaltet wird, dass dem gegenwärtigen Selbstbewusstsein des Menschen – insbesondere wenn er sich dem Christentum zurechnen kann – die erhebende Verheißung zuwächst, ein tragendes Subjekt dieser Geschichte zu sein. Es ist der Geist in seinen unterschiedlichen Gestalten, der das Ganze zusammenhält und bewegt und somit als das eigentlich Wirkliche zu würdigen ist. Es geht um den Vollzug der Selbstbewegung und Selbstverwirklichung des all-einen unendlichen Geistes, der im endlich-unendlichen Selbstbewusstsein des freien Menschen seine geschichtliche Bestätigung erwirkt. Dem von allen Idealisten geteilten Grundanliegen, die gesamte Wirklichkeit systematisch begrifflich zu erfassen und der allein aus sich selbst heraus zu verstehenden Vernunft unterzuordnen, gibt Hegel in seiner dialektischen Geistphilosophie ein besonderes Gepräge, indem er allen denkbaren Widersprüchen dadurch ihr bedrohliches Potenzial entzieht, dass er sie in einem übergeordneten Ganzen im doppelten Sinne als aufgehoben vorstellt. Es ist hier nicht der Ort, Hegel Geschichtsphilosophie im Einzelnen zur Darstellung zu bringen.
|59◄ ►60|
Im Blick auf die Religionen bleibt festzuhalten, dass sie sich an ihrem Verhältnis zu dem absoluten Geist qualifizieren. Für Hegel kommen hier spezifische Unterscheide zum Tragen, die zu dem Resümee führen, das Christentum als absolute Religion zu qualifizieren.
Der jüdische Gott ist die Einzigkeit, die selbst noch abstrakte Einheit bleibt, noch nicht in sich konkret ist. Dieser ist zwar Gott im Geist, aber noch nicht als Geist, – ein Unsinnliches, Abstraktum des Gedankens, welches noch nicht die Erfüllung in sich hat, die es zum Geist macht. Die Freiheit, zu welcher sich der Begriff in der griechischen Religion zu entwickeln sucht, lebt noch unter dem Zepter der Notwendigkeit des Wesens, und der Begriff, wie er in der römischen Religion erscheint und seine Selbständigkeit gewinnen will, ist noch beschränkt, da er auf eine gegenüberstehende Äußerlichkeit bezogen ist, in der er nur objektiv sein soll, und ist so äußerliche Zweckmäßigkeit.
... Der Geist, der an und für sich ist, hat nun in seiner Entfaltung nicht mehr einzelne Formen, Bestimmungen seiner vor sich, weiß von sich nicht mehr als Geist in irgendeiner Bestimmtheit, Beschränktheit; sondern nun hat er jene Beschränkungen, diese Endlichkeit überwunden und ist für sich, wie er an sich ist. Dieses Wissen des Geistes für sich, wie er an sich ist, ist das Anundfürsichsein des wissenden Geistes, die vollendete, absolute Religion, in der es offenbar ist, was der Geist, Gott ist; dies ist die christliche Religion. (86 f.)
In seiner Rechtsphilosophie thematisiert Hegel das neuzeitlich spätestens seit Hobbes (→ § 2,2) immer wieder problematisierte Verhältnis von Religion und Staat. Mit Hilfe seiner Staatsmetaphysik gelingt es Hegel, dem vernünftigen Staat, der sich von dem allein weltlichen, endlichen und somit schlechten Staat in seiner Notwendigkeit durch eine eigene religiöse Dimension unterscheidet, eine eigenständige Autorität zu sichern. Indem aber die Religion, auf die er sich gründet, Religion der Freiheit ist, kann dem Staat keinerlei Direktive auf die Innerlichkeit des Menschen zukommen. Umgekehrt bleibt der Religion das dem Staat anvertraute Recht verschlossen, denn seine in Pflicht nehmende Geltung besteht unabhängig vom Gemüt des Menschen. 68
H. Schnädelbach, G. W. F. Hegel zur Einführung, Hamburg 32007
M. Theunissen, Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-politischer Traktat, Berlin 1970
11. Kurze Zwischenbilanz
Die in diesem Kapitel durchschrittene Entwicklung verdeutlicht, dass es einiger Zeit bedurfte, bis der aufklärerische Religionsbegriff zu sich selbst gefunden hat. Auf dem Weg zwischen Hobbes und Kant und dann weiter zu Hegel, der gewiss auch noch sehr viel kleinschrittiger durchlaufen werden könnte, vollziehen sich signifi-kante|60◄ ►61| Veränderungen, die verdeutlichen, dass der zunächst als ein Instrument eingeführte Begriff schließlich selbst zum Gegenstand des Interesses und der sorgsamen Bestimmung wird. Lag zunächst das mit dem Begriff verbundene Interesse außerhalb seiner selbst, sodass auch die für ihn aufgewandte Sorgfalt mehr auf die von ihm erhoffte Wirkung als auf seine stimmige Konsistenz gelegt wurde, so zieht er im Laufe der Entwicklung immer mehr Bestimmungsmerkmale an, sodass er schließlich zu einem Stehvermögen erstarkt, in dem er sich als eine Alternative zu dem konfessionell gebundenen Glaubensverständnis präsentieren kann und schließlich auch ausdrücklich präsentiert. Von daher ist es ganz plausibel, wenn die begriffliche Kontur durchaus über längere Zeit über einen gewissen Schwebezustand nicht hinaus gekommen ist – wie es von Ernst Feil in seinen Untersuchungen betont reklamiert wird. Als eigenständiger Begriff kommt die Religion erst in dem Moment zu eigenen Kräften, in dem ihr eine eigene Attraktivität als mögliche Alternative zu den traditionellen konfessionell geprägten Glaubenverständnissen zugewachsen ist.
Bei seiner Einführung steht die Frieden stiftende und die integrative Kraft im Vordergrund. Um das Ziel der Pazifizierung der Gesellschaft möglichst umweglos und effektiv zu erreichen, wird zunächst die merkwürdige Spannung in Kauf genommen, die durch die eingeführte Unterscheidung von privater und öffentlicher Religion unweigerlich entsteht. In der unterschiedlichen Verwendung des Begriffs der Religion spiegeln sich anfangs gleichsam die im Konflikt liegenden Dimensionen wider, zu deren Vermittlung er ebenso forsch wie eilig auf die Bühne gerufen wurde. Zwar war klar, welche Rolle er spielen solle, weniger klar war allerdings, woher diese Rolle ihre spezifische Überzeugungskraft beziehen solle. In dem Maße, in dem die neu kreierte Religion tatsächlich ihre Rolle zumindest teilweise erfolgreich auszufüllen begann, klärte sich auch ihre Konsistenz und ihr Profil, sodass sie instand gesetzt wurde, immer selbstbewusster auf der Bühne zu agieren. Da von den in unversöhnlichem Streit liegenden Konfessionen keine tragfähigen Lösungen zu erwarten waren und somit keine von innen begründete Überwindung des Konflikts in Aussicht stand, wird das zur Hilfe gerufene Religionsverständnis gleichsam von außen der verfahrenen Situation zugeführt, um die erforderlichen Moderationen vorzunehmen.
Da die Konfessionen nicht selbst das nötige Heilmittel gegen ihre verheerende Unduldsamkeit zu entwickeln verstanden, musste ihnen dieses Heilmittel von außen verordnet und verabreicht werden. Es kann dann nicht verwundern, wenn dieses von außen dem Konflikt aufgedrängte Heilmittel sich vor allem aus Inhaltsstoffen zusammensetzt, die nicht aus den ungenutzten Ressourcen stammen, die den Konfessionen zur Überwindung ihres Dilemmas in ihrem eigenen Arsenal zur Verfügung gestanden hätten. Die konfessionelle Bindung war offenkundig nicht in der Lage, die theologischen Elemente in dem eigenen Selbstverständnis zu mobilisieren, die den irrationalen aggressiven Antagonismen wirksam etwas entgegensetzen konnten. Die Kirchen haben kaum etwas dazu beigetragen, die Geschichte über die Erosionen hinauszuführen, die in den eigenen Reihen ihren Ausgang genommen hatten.
|61◄ ►62|
Das eingesetzte Heilmittel ist von den Philosophen, insbesondere den Staats-und Gesellschaftsphilosophen entwickelt worden. Seine Bestandteile zeichnen sich durch möglichst widerspruchsfreie Allgemeinheit und seine Wirkweise durch den Dominanzanspruch des Allgemeinen gegenüber dem Besonderen aus. Dabei kommt die nahe liegende Affinität des Allgemeinen zum Natürlichen in besonderer Weise zum Tragen. Es ist also überaus plausibel, dass in dem Maße, in dem der Religion möglichst unbestreitbare Allgemeinheit zugeschrieben wird, sie zugleich in einer kaum bestreitbaren Natürlichkeit in Erscheinung tritt. Sie beerbt schließlich den vom Konfessionalismus zerstörten heiligen Singular des gemeinsamen Bekenntnisses zu dem einen Gott und präsentiert sich als natürliche Religion, als die eine wahre Religion, auf die sich die Vielfalt der Konfessionen und überkommenen Religionen unweigerlich zubewegen, wenn sie nicht in ihrer unduldsamen und streitsüchtigen Partikularität verharren wollen.
Es ist deutlich, dass das von der Aufklärung hervorgebrachte Modell der Religion als natürliche Religion selbst einen bekenntnishaften Charakter bekommt, der vor allem in der prinzipiellen Kritik an allen dogmatischen Exklusivismen, die nicht unmittelbar aus der menschlichen Vernunft stammen, in Erscheinung tritt. Es ist das Credo der Dominanz des Allgemeinen gegenüber dem Besonderen, wobei das Allgemeine die Evidenz des als unmittelbar zugänglich ausgegebenen Natürlichen ist. So sehr die Beschreibung dieses Natürlichen durchaus auf unterschiedlichen Wegen vorgenommen wird, so wenig scheint strittig zu sein, dass es eine solche von allen Menschen geteilte und sie einende Größe gibt, von deren Pflege die auf der Menschheit liegende Verheißung abhängig ist.
Das Selbstbewusstsein des Idealismus verweist schließlich indirekt auf die Verlegenheit insbesondere derjenigen Theologie, die sich auf die veränderte Situation einzustellen versucht. Hier zeigt sich eine sich gegenseitig beschleunigende Dynamik, denn der Anschluss der Theologie an den aufklärerischen Diskurs scheint nur über eine weitreichende Selbstrelativierung und somit durch eine schlichte Anpassung an die neue Situation zu gelingen (→ § 3), sodass der Philosophie das theologische Gegenüber zu entschwinden droht, was sie dann wiederum umso entschlossener dazu ermutigt, sich selbst als legitime Erbin der Theologie zu präsentieren, wie es dann von Hegel mit allen Konsequenzen vorgeführt wird.
|62◄ ►63|