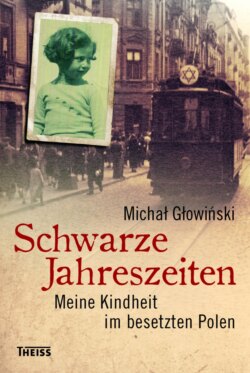Читать книгу Schwarze Jahreszeiten - Michal Glowinski - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Emil
ОглавлениеIn dieser Zeit besuchte ich den Unterricht bei Fräulein Julia und Frau Bronisława, zwei Schwestern, die vor dem Krieg Lehrerinnen gewesen waren und für eine geringe Gebühr eine Gruppe von mehreren Kindern unterrichteten. Es war nicht mein erster Unterricht, denn zuvor hatten mich die Eltern in eine winzige, private Schule geschickt, die von Frau Anna geleitet wurde. Wir wohnten zuerst in den Randgebieten des Ghettos. Als diese von den Deutschen dann ausgegliedert wurden, mussten wir umziehen. Auch Frau Anna wechselte ihre Adresse und es war nun zu weit, um bei ihr in die Schule zu gehen, zumal die Straßen des geschlossenen Wohnbezirks immer gefährlicher wurden und man nie wissen konnte, was geschehen würde. Das Zimmer, in dem Fräulein Julia und Frau Bronisława wohnten, befand sich unweit des Lochs, in dem wir untergekommen waren, ebenfalls am Rand des Ghettos, nur an einem anderen Rand, gleich hinter der Mauer. Es trennten uns nur wenige Häuser, ich erinnere mich jedoch an die Strecke, die ich zurücklegen musste. Oft lagen dort die Leichen von Menschen, die vor Hunger gestorben waren, bedeckt mit Bahnen aus grauem Papier. Ich erinnere mich auch an die Nähe der Mauer, die jenen Raum markierte, in dem alles, was lebte, unweigerlich zum Tode verurteilt war. Ich erinnere mich an viel … Aber mit Sicherheit kann ich mich an noch viel mehr nicht erinnern.
Ich erinnere mich also an das Zimmer, in dem unser Unterricht stattfand: Es war lang, mit einem großen Fenster; für die Zeit unseres Hierseins wurden drei kleine Tischchen aufgestellt, um es zumindest ein wenig einem Klassenzimmer ähnlich werden zu lassen. In einer Ecke war ein provisorischer Herd eingerichtet, und in einer anderen saß meist Herr Mieczysław, der Mann von Frau Bronisława. Er war vor dem Krieg Journalist in einer der auf Polnisch erscheinenden jüdischen Zeitungen gewesen, war also ein Mensch, der im Ghetto nicht in seinem Beruf arbeiten konnte, keinerlei Arbeit fand … und viel Zeit hatte. Während unseres Unterrichts las er in der Regel etwas, manchmal hörte er gelangweilt den Stunden zu, die uns seine Frau und seine Schwägerin erteilten. Ich erinnere mich nicht, wie er aussah, habe aber immer noch die gute und zerbrechliche Frau Bronisława und Fräulein Julia vor Augen, die einer besonderen Beschreibung wert ist. Sie war groß und entsetzlich dürr, es war jene pathologische Dünnheit, wie sie Krankheit und Unterernährung verursachen, so typisch für die Menschen im Ghetto. Im Sommer trug sie ein dunkles kurzärmliges Kleid, man sah also ihre gelblichen und ausgemergelten Arme, nur Haut und Knochen. Ihr längliches Gesicht mit eingefallenen Wangen konnte furchterregend aussehen, ihre Züge hatten eine Schärfe angenommen, die sie in besseren Zeiten gewiss nicht besaßen. Sie war eine sympathische Person, auch wenn manch einer denken mochte, sie erinnere an eine Hexe oder sehe aus wie der Tod. Wenn ich mich an diese Frauen erinnere, so denke ich noch an etwas anderes: Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich der Einzige bin, der sich an sie erinnert, der einzige, dem bewusst ist, dass sie einmal gelebt, gearbeitet, gelehrt haben – und dass sie mit der Welt, deren Teil sie waren, untergegangen sind.
Und ich bin gewiss der Einzige, der die Klassenkameraden, die Schüler von Fräulein Julia und Frau Bronisława, noch im Gedächtnis hat. Ich kenne ihre Nachnamen nicht, ich erinnere mich an die Vornamen, und auch hier nur an einige. Vor Augen steht mir Susi, hochgeschossen und etwas älter, die merkwürdig Polnisch sprach, weil sie in Hamburg geboren war; sie gehörte zu einer Familie, die von den Deutschen kurz vor dem Krieg zur polnischen Grenze gebracht worden war. Vor Augen steht mir die hellhaarige und lächelnde Mela, die einmal ergriffen von einem ungewöhnlichen und freudigen Ereignis des Vortags erzählte, als es zum Mittagessen Nudelsuppe gegeben hatte. Vor Augen steht mir ein Mädchen mit schwarzem Haar, das anonym bleibt, weil ich nicht in der Lage bin, mir ihren Vornamen ins Gedächtnis zu rufen; sie sammelte Briefmarken. Vor Augen steht mir schließlich Tadzio (obwohl ich nicht sicher bin, ob er wirklich diesen Namen trug), stets lebhaft und unbändig, der sich gerne mit seinem Vater brüstete, einem, wie er sagte, hervorragenden Rechtsanwalt. Ich wurde von ihm Giraffe genannt, weil er fand, ich habe einen komisch langen Hals. Außer ihnen habe ich niemanden aus unserem Unterricht vor Augen, obwohl wir mehr waren. In meiner Erinnerung aus dieser ermordeten Welt sind mir nur Fragmente, Fetzen, Reste geblieben.
Doch ein Junge ist geblieben, mit dem ich nie direkt zu tun hatte, auch wenn ich ihn mehrmals sah. Er hieß Emil und war eine lebende Legende unserer Gruppe. Als ich dazustieß, war er nicht mehr bei uns, doch beide Lehrerinnen erinnerten sich mit Sympathie, Zärtlichkeit und Bewunderung an ihn, auch die Mitschüler erwähnten ihn mit Zuneigung. Er war gewiss ein netter, angeblich sogar ein genialer Junge (er war nicht älter als neun). Über Emil sprach man wie über jemand Außerordentlichen, jemanden, der über uns alle herauswächst, der unglaublich begabt ist. Der eine erzählte, dass er Emil auf einer Straße des Ghettos zusammen mit seiner Mutter getroffen habe, ein anderer, dass er etwas über sein Schicksal gehört habe. Er war abwesend und doch unter uns anwesend. Im Ghetto war er mit seiner Mutter, doch auch über seinen Vater sprach man mit Bewunderung und Neugier: Er war als Offizier der polnischen Streitkräfte Kriegsgefangener, hielt sich in einem fernen Lager auf – und konnte natürlich nicht für seine Frau und seinen Sohn sorgen. Einmal in einer Pause zwischen den Stunden (die Kurse von Fräulein Julia und Frau Bronisława waren einer Schule immer ähnlicher geworden) blickte jemand aus dem Fenster im ersten Stock und sah Emil. Aufregung machte sich breit: Emil ist da, Emil ist da. Wir riefen: Emil, komm zu uns! Doch Emil kam nicht, ging weiter mit seiner Mutter über die mit Menschen überfüllte Ghettostraße in der Nähe der Mauer. Sie hatte darauf verzichtet, ihn zum Unterricht zu schicken, weil sie in ein noch größeres Elend als zuvor geraten war und die geringe Summe nicht mehr zusammenkratzen konnte, um ihn zu bezahlen. Wir wussten, dass Fräulein Julia und Frau Bronisława auf alle Gebühren verzichten wollten, um Emil umsonst weiter unterrichten zu können, der die Zierde der Gruppe und aller Liebling war. Es war bekannt, dass sie seine Mutter um ihr Einverständnis gebeten hatten, sie baten sie mehrfach, bedrängten sie geradezu, doch sie war konsequent und wollte darauf nicht eingehen. Vielleicht lehnte sie deshalb ab, weil ihr Ehrgeiz ihr nichts anderes erlaubte; vielleicht befürchtete sie, ihr Sohn, der als Einziger von den Gebühren befreit sein würde, könnte sich in einer erniedrigenden Lage befinden, seine Kameraden könnten ihm seine privilegierte Lage vorhalten. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es zum Teil auch um etwas anderes ging: Seine Mutter glaubte vielleicht, Emil sei so begabt, dass er den Unterricht nicht brauche, denn er wisse sowieso schon viel und würde, sofern nötig, nach dem Krieg rasch alle Lücken aufholen. Und so wurde er zu unserem Vorbild und zu unserem Mythos, vielleicht auch deshalb, weil er am Unterricht nicht teilnahm. Darüber, wie viel über ihn geredet wurde, zeugt auch, dass ich mich an seine Geschichte so gut erinnere, obwohl seit diesen Ereignissen schon mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen ist.
Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist, ich weiß also nicht, ob er eine Chance hatte, seine Bildungslücken nach dem Krieg zu schließen, vermute aber, dass ihm dies nicht gegeben war, dass er wie die Mehrheit umgekommen ist. Die Sommerpause im Unterricht begann wie in normalen Schulen in den letzten Junitagen und sollte nie mehr aufhören. Es kam der 22. Juli 1942, es begann die letzte Phase der „Endlösung”. Als die Deportationen vom Umschlagplatz einsetzten, konnte nicht mehr davon die Rede sein, irgendetwas fortzusetzen. Ich weiß mit großer Sicherheit, dass Fräulein Julia und Frau Bronisława zusammen mit Herrn Mieczysław den Krieg nicht überlebten, sie kamen in Treblinka ums Leben. Ich weiß aber nicht, welches Schicksal meine Altersgenossen hatten. Ich weiß nicht nur nichts über Emil, den ich nie getroffen hatte, ich weiß auch nichts über Susi, die Polnisch mit deutschem Akzent sprach, ich weiß nichts über die heitere Mela, nichts über die kleine Brünette mit den traurigen schwarzen Augen, die Briefmarken sammelte (ich sammelte auch Marken, weshalb mir dieses Detail in Erinnerung geblieben ist), ich weiß nichts über den unbändigen Tadzio. Und umso mehr habe ich keine Ahnung, was mit denen geschehen ist, an die ich mich nicht erinnere. Ich kenne ihr Schicksal nicht, kann aber nicht umhin zu denken, dass alle umgekommen sind und dass das, was ich geschrieben habe, ein kollektives Epitaph ist. Ich schließe nicht aus, dass nur ich lebe und der einzige dieser Unterrichtsgruppe bin – deren ältester Teilnehmer nicht mehr als zehn Jahre alt war –, der sich an ihre Existenz erinnert und etwas über sie sagen kann. Es ist schwer, von sich selbst als den einzigen Zeugen zu denken, und noch schwerer, mit dem Bewusstsein zu leben, dass man dieser einzige Zeuge ist. Ich kann schließlich nicht fragen, warum gerade ich unter den Lebenden weile und nicht der großartige und außergewöhnliche Emil, die so merkwürdig Polnisch sprechende Susi oder der unbändige Tadzio. Warum, warum? … Antworten auf derlei Fragen gibt es nicht, man kann sich nur überlegen, ob zum Beispiel Emil dieses besondere Geschenk des Lebens nicht besser, klüger, schöpferischer genutzt hätte. Das Leben eines Menschen, der schon in der Kindheit zur Vernichtung verurteilt war.