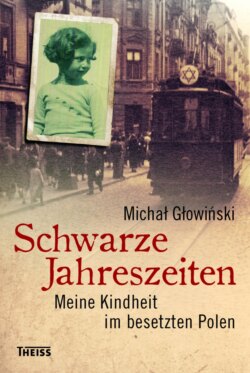Читать книгу Schwarze Jahreszeiten - Michal Glowinski - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Großvaters Selbstmord
ОглавлениеIch begegnete ihm nur wenige Male im Leben und er hat sich meinem Gedächtnis nicht allzu gut eingeprägt – im Gegensatz zu meinem Großvater mütterlicherseits, den ich von frühester Kindheit an kannte und den ich lange kannte, denn er überlebte den Krieg und starb im Jahre 1952, als ich schon studierte. Über diesen weniger vertrauten Opa möchte ich aber einige Worte schreiben, denn ich bewundere ihn für seine Entscheidung in einer Extremsituation.
Sein ganzes Leben verbrachte er in Słupca, doch eines Tages tauchte er bei uns in Pruszków auf. Er war damals nicht mehr jung, ich erinnere mich an einen großen, schlanken Mann, der leicht – aber deutlich – gebückt war. Ich war damals drei, höchstens vier Jahre alt und bin dem älteren Herrn, der mich auf die Knie nehmen wollte, ganz und gar nicht zugeneigt gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber er löste bei mir Angst aus. Erst nach einiger Zeit wurde ich mit ihm vertraut. Doch nur kurz, denn nach einer Weile rief er bei mir Entsetzen hervor: Ich erschrak, als er unerwartet ein kleines rundes Käppchen aufsetzte, wie es die orthodoxen Juden tragen. Er war nicht orthodox, lebte aber in der jüdischen Tradition, in Einklang mit ihren Regeln, und es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade Sabbat war. Zwar wurden die religiösen Regeln in meinem Elternhaus nicht eingehalten, es bestand jedoch kein Grund, dass ein älterer Mensch ihnen nicht treu blieb, selbst wenn er sich nicht durch besondere Frömmigkeit auszeichnete. Ich weiß wirklich nicht, warum er mir von dem Moment an, in dem er das Käppchen aufsetzte, bedrohlich, merkwürdig, fremd vorkam – und ganz anders als noch vor einer Weile. Die Reaktionen kleiner Kinder sind sonderbar und schwer vorherzusagen, also habe ich keinen Grund, mich groß mit meinem Verhalten auseinanderzusetzen. Ich möchte nur anmerken, dass dieses plötzliche Entsetzen groß gewesen sein muss, da es eine meiner deutlichsten Erinnerungen aus der frühen Kindheit war.
Leider erinnere ich mich an den Großvater im Ghetto nicht, obwohl ich ihn zumindest gelegentlich gesehen haben muss. Ich weiß noch nicht einmal, aus welchen Gründen er sich hinter den Mauern in Warschau befand, mit dem er zuvor nichts zu tun gehabt hatte; ich weiß nicht, ob alle Juden aus Słupca hierhergebracht wurden oder ob er Bemühungen unternommen hatte, um zur Familie zu stoßen (er war seit mindestens einem Vierteljahrhundert Witwer). Er wohnte bei seiner ältesten Tochter, die in der Familie unter dem polonisierten Vornamen Zosia bekannt war, am anderen Ende des Ghettos, und somit für die Verhältnisse des abgeschlossenen und maximal komprimierten Stadtteils – sehr weit weg. Mir ist in Erinnerung geblieben, wie wir sie einmal mit Vater besuchten. Immer noch sehe ich ihren Mann vor Augen, der damals schon schwer krank war, mit geschwollenen Beinen im Bett lag und sehr litt (anscheinend gelang es ihm nicht, vor der Deportation nach Treblinka zu sterben). Ich erinnere mich aber nicht an meinen Großvater, obwohl er dort gewesen sein muss.
Alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, ist nur eine Vorbereitung auf die Reflexion über seine letzte Tat, eine Tat, zu der ich in Gedanken oft zurückkehre. Zur Reflexion, nicht zur Erzählung, denn ich weiß zu wenig über die wahren Geschehnisse, die damit einhergingen, um davon erzählen zu können. Ende Juli, Anfang August 1942 (das genaue Datum kenne ich nicht), nachdem die Deutschen schon mit der Deportation nach Treblinka begonnen hatten, beging mein Großvater Selbstmord. Er sprang aus dem zweiten oder dritten Stockwerk, sprang mit Erfolg, denn er war sofort tot. Ich erinnere mich, wie diese Nachricht bis an den entlegenen Rand des Ghettos gelangte, wo wir wohnten, und wie Vater sich um die Beisetzung kümmerte. Ich schreibe bewusst nicht Beerdigung, denn in der Zeit, in der die Deportationen vom Umschlagplatz nach Treblinka stattfanden, wurden im Ghetto keine Beerdigungen im normalen Sinn mehr organisiert. Die Leichen wurden in ein Massengrab auf dem jüdischen Friedhof geworfen. Hierher kam auch der Körper meines Großvaters. Ich weiß nicht, ob außer Vater ihn jemand bis zur Grube begleitete, in die man die Glücklichen fallen ließ, denen es gelungen war, hier, an Ort und Stelle, zu sterben … und der Gaskammer zu entgehen.
Ich würde viel darum geben, zu erfahren, welche gedanklichen und emotionalen Prozesse meinen Großvater zu seiner Entscheidung gebracht haben. In dem Augenblick, in dem er sie fasste, war er bereits ein alter Mann. Ich kenne sein genaues Geburtsdatum nicht, weiß aber, dass er zu Beginn der 1870er-Jahre auf die Welt gekommen ist, also in einer Zeit, in der selbst der pessimistischste Visionär sich keine Welt hätte vorstellen können, in der man massenhaft in Gaskammern ermordet wird. Einmal habe ich darüber gedacht: Der Holocaust betraf auch im 19. Jahrhundert geborene Menschen, also – kürzer – Menschen des 19. Jahrhunderts, die aus dieser Epoche ihre Sitten mitgebracht haben, ihre Weltsicht, Gewohnheiten und Vorurteile. Drei Jahrzehnte im Leben meines Großvaters entfielen auf dieses Jahrhundert, doch weiß ich nicht, ob man ihn einen Menschen des 19. Jahrhunderts nennen kann. Eher nicht, denn eine solche Bezeichnung wäre wahrscheinlich falsch; mein Großvater hatte mit Sicherheit keinen Kontakt zu den großen Ideen des vergangenen Jahrhunderts. Er hatte sich nicht in seine herrliche Literatur eingelesen, er war ein bescheidener Provinzkaufmann, der mit seinen Angelegenheiten beschäftigt war, er erzog seine Kinder und war bestrebt, dass seine nicht allzu große Firma der Familie die materielle Existenz sicherte. Und er hat wohl nicht viel von der Welt außerhalb von Słupca und dessen nächster Umgebung gesehen, die größten Brüche in seiner täglichen Routine waren Fahrten nach Posen von Zeit zu Zeit. Mein Großvater war ein einfacher Mensch, ein jüdischer Kleinbürger, der nur eine elementare Schulbildung besaß, und wenn ich nun gerade an seine Bescheidenheit und seine Normalität denke, kommt seiner finalen Geste in meinen Augen eine besondere Bedeutung zu.
Ich würde also viel dafür geben, zu erfahren, wie er zu dieser letzten Entscheidung gelangt ist. War ihm klar geworden, dass er keine Perspektiven mehr hatte? Er, Lajzer Głowiński, ein besonnener, höflicher, auf seine Weise religiöser Mensch, der die Siebzig überschritten hatte, war alt und kränklich, konnte also nicht damit rechnen, das Kriegsende zu erleben und zu einem normalen Leben zurückzukehren, in Słupca oder sonst irgendwo. Die Entscheidung könnte eine rein persönliche Dimension besessen haben, doch ich glaube, dass sie breitere Bezüge aufwies, etwa aufgrund des Zeitpunkts, zu dem sie umgesetzt wurde. In den Zeiten der Shoah gibt es keine privaten Selbstmorde, denn jeder Tod, vor allem ein solcher, wird gewissermaßen öffentlich. Ich kann nicht sagen, dass mein Großvater sich völlig im Klaren darüber war, was die Deportation nach Treblinka bedeutete, dass er sich bewusst war, dass es sich dabei um keine Ansiedlung im Osten oder um ein Arbeitslager handelte. Doch kann ich auch nicht ausschließen, dass er sich keinerlei Illusionen machte – und dass er nur einen Tod in Verachtung und Qualen vor sich sah. Er wollte ihm entkommen, wählte deshalb das, was er unter den extremen Bedingungen noch wählen konnte, und gab sich selbst den Tod. Er erkannte, dass in der Zeit der „Endlösung” für ihn der Selbstmord die beste Lösung war. Seine Entscheidung war richtig, er hatte schließlich keine Überlebenschance, jede Rettung war ihm versperrt. Das Einzige, was er hätte erreichen können, waren ein paar Tage Aufschub, also unter Aufbringung größter Anstrengungen eine Verschiebung des letzten Wegs auf den Umschlagplatz von, sagen wir, Montag auf Freitag. Für einen solchen Aufschub brauchte man sich nicht anzustrengen, zumal mit ihm keinerlei Hoffnung auf eine zumindest ein wenig längere Zukunft einherging. In dieser Zeit bedeutete das Ende wirklich das Ende. Diesbezüglich gab es kaum Zweifel. Die Beschleunigung des eigenen Endes war ein Akt der Freiheit, damals fast der einzig mögliche. Und mein Großvater traf im sterbenden Ghetto genau diese Wahl.
Ich denke daran mit der größten Bewunderung, zumal ich mir bewusst bin, dass ein Selbstmord, der unter solchen Umständen begangen wird, eine besondere symbolische Bedeutung besitzt. Ich hege die Überzeugung, dass diesem Freitod, einem Tod, zu dem sich dieser alte Mensch entschloss, etwas Imponierendes innewohnt. Es ist eine der Taten, die allein dadurch, dass sie aus freiem Willen entstehen und Folge einer freien Entscheidung sind, das infrage stellen, was man die Logik (oder Ordnung) des Holocaust nennen kann. Wer in einer solchen Situation zum Tode verurteilt wurde, stellt sich dadurch, dass er sich selbst das Leben nimmt, dem Urteil entgegen und demonstriert, dass er moralisch von ihm unabhängig ist. Und das ist auch dann der Fall, wenn dieser Akt die einfache Folge von Verzweiflung ist. Ich weiß nicht, ob es im Warschauer Ghetto oft Selbstmorde gab, wahrscheinlich wurden keine Statistiken geführt. Selbstmorde konnten in seiner Anfangszeit ja etwas anderes bedeuten als in seiner finalen Phase, als die Züge vom Umschlagplatz nach Treblinka aufbrachen.
Kurzum, über den Selbstmord meines Großvaters, den er in einer von der Shoah gezeichneten Zeit beging, denke ich wie über eine heroische Tat, eine Tat mit größter moralischer, existenzieller oder auch nur menschlicher Aussagekraft. Dieser Mensch hatte verstanden, dass in der Lage, in der er sich mit Millionen Verurteilten befand, die einzige verfügbare Form, über das eigene Schicksal zu entscheiden, und die einzige Form von Freiheit der sich selbst zugefügte Tod war, ein Tod aus eigenen Stücken. Würde ich die Geschichte meiner Familie schreiben oder ihre Legende erschaffen wollen, so würde ich meinem Großvater viel Platz widmen, der sich nicht ermorden ließ, weil er es vorzog, es selbst zu tun. Ich würde das tun, obwohl ich ihn wenig kannte und mich kaum an ihn erinnere. Ja, die Erinnerung von vor dem Krieg, aus der frühesten, so idyllischen Kindheit hängt überhaupt nicht mit dem finalen Akt zusammen. Die Mechanismen des Erinnerns unterliegen jedoch keiner rücksichtslosen Logik und keiner Hierarchie der Wichtigkeit. Damals, am Ende der 1930er-Jahre, konnte nicht nur ich, der ich damals nicht älter als vier war, sondern überhaupt niemand vermuten, dass dieser bescheidene Provinzkaufmann zu einer solchen Tat fähig sein würde. Und obwohl das Grauen bereits an die Tür klopfte, konnte sich auch in diesen Jahren niemand vorstellen, dass jemand Gaskammern in Betrieb nehmen würde, um darin mit industriellen Methoden zu morden.
Im Zusammenhang mit der Shoah ist oft vom „würdevollen Tod” die Rede, und gelegentlich gibt es wenig gescheite und leichtsinnige Meinungen dazu. Jeder, der durch verbrecherische Urteile starb, ist würdevoll gestorben – das muss gesagt werden, selbst wenn man Brutus recht gibt, der, unmittelbar bevor er seinem Leben ein Ende setzt, in Shakespeares Julius Cäsar sagt: „Der Feind hat uns zum Abgrund hingetrieben. / Es ziemt sich mehr, von selbst hineinzuspringen, / Als zu erwarten seinen letzten Stoß.” Es gab nur unterschiedliche Stile des Sterbens. Stile der Opfer, die sich ohne Proteste in die Gaskammern bringen ließen, und die Stile derer, die es vorzogen, aktiv zu sterben. Die einen – wie die Aufständischen des Ghettos – leisteten Widerstand, andere begingen Selbstmord. Ein Mensch, der so alt war wie mein Großvater, konnte nur den Selbstmord wählen.