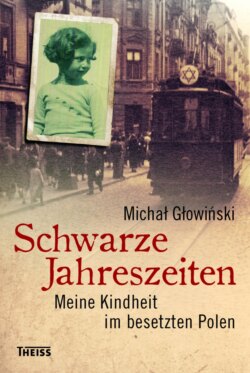Читать книгу Schwarze Jahreszeiten - Michal Glowinski - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Verlassen
ОглавлениеIch gebrauche dieses Wort nur deshalb, weil ich kein anderes bei der Hand habe, eines, das passender wäre. „Flucht” ist für mein Gefühl noch weniger angemessen. Freilich, es hat großartige Konnotationen, es lässt an die biblische Welt denken, doch würde ich den Ausdruck „Exodus” nicht verwenden, weil er in Bezug auf derlei Ereignisse sowohl viel zu erhaben als auch zu prätentiös klänge. Und wenn von einer furchtbaren Welt die Rede ist, von einer der furchtbarsten, welche jemals Menschen bereitet wurde, sind alle erhabenen und feierlichen Worte überflüssig. Ein Missklang stiehlt sich in sie hinein. In den Geschichten, aus denen sich die Shoah zusammenfügt, gibt es noch nicht einmal Analogien zu den grausamsten Episoden der Bibel. Auch in den Fragmenten, in denen nicht vermieden wurde, von erschütternden, ungeheuerlichen Ereignissen zu erzählen, hat die Heilige Schrift stets gewisse Werte festgelegt, hat angenommen, dass es in der Welt eine gewisse Ordnung gibt, die ihren Sinn hat. In der Shoah gab es so etwas nicht. Hier war ein System des Verbrechens am Werk, und in dem, was zur Rettung menschlichen Lebens führte, spielten Zufälle eine gewaltige Rolle – dunkle und unermessliche, die sich nicht beherrschen, verstehen, ordnen lassen.
Ich habe diese allgemeinen Erörterungen gerade hier aufgegriffen, weil das Wort „Verlassen” mich darauf gebracht hat, obwohl sie auch in die anderen Erzählungen passen würden. Ich weiß nicht, aus welchem Grund es eine Konvention geworden ist, vom „Verlassen des Ghettos” (wyjście z getta) zu sprechen, wenngleich man auf Polnisch nicht sagen kann: „das Verlassen des Konzentrationslagers” – und zwar sowohl dann, wenn es um eine dramatische, höchst risikoreiche Flucht ging, als auch dann, wenn man an eine Freilassung denkt (die natürlich im Fall der Juden ganz unvorstellbar war). Also unser Verlassen – das meiner Eltern und meines – des Ghettos erfolgte gleich Anfang Januar 1943, wohl einen Tag nach Neujahr. Wir verließen es als letzte von dem Teil der Familie, der innerhalb der Mauern lebte und ein geschlossenes Ganzes bildete. Ich denke nicht an die Großeltern, die aufgrund eines reinen Zufalls noch vor Beginn der Deportationen auf die arische Seite gelangt waren, ein außergewöhnlicher Zufall, der für sie unerwartet gnädig war. Ich denke an meine beiden Tanten, die eine nach der anderen mit ihren Kindern herauskamen. Und dann an ihre Männer: Beide gelangten etwas später über die Mauer und kamen kurz darauf ums Leben.
Diejenigen Verwandten sowohl meiner Mutter als auch meines Vaters, die an anderen Stellen des Ghettos wohnten, kamen nicht heraus – und nicht mit dem Leben davon. Sie machten sich von dort aus auf ihre letzte Reise, direkt nach Treblinka. Es ist unbekannt, an welchen Tagen das geschah und unter welchen Umständen genau. Als man versuchte, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, was zweifellos nicht leicht war, musste man feststellen, dass sie nicht mehr da waren. Sie waren, existierten, lebten – und dann waren sie auf einmal nicht mehr da. Niemand konnte sich Täuschungen hingeben, es war bekannt, was geschah. Doch ich vermag nicht zu sagen, ob man auf Nachrichten dieser Art reagierte wie auf Trauerbotschaften. Ist denn in einer systematisch und geplant ermordeten Gemeinschaft Trauer in der Form, wie sie sich in etwas normaleren Zeiten zeigt, überhaupt möglich? Wenn ein Tod auf den anderen folgt, wenn er allem und jedem einzeln droht, ist es schwer, zu kontemplieren. Wenn das Nachdenken über ihn überhaupt möglich ist, so lediglich in den Dimensionen eines Augenblicks, nicht in längeren Zeiteinheiten.
Wir waren also von dem Teil der Familie, der der Vernichtung entkommen konnte, am längsten im Ghetto. Ich weiß nicht, was dafür den Ausschlag gab: Vielleicht waren die Umstände ungünstig, vielleicht war es schwer, zu einer Entscheidung zu gelangen, zumal die Entscheidung keine Kleinigkeit war. Das Risiko, die gut bewachte Grenze zu überschreiten, die mitten durch die Stadt führte, musste bedacht werden. Und es war kein Geheimnis, dass man gleich nach der Ankunft auf der anderen Seite leicht in die Hände von szmalcownicy fallen konnte, was bedeutete, erpresst zu werden, gelegentlich aber auch gleichbedeutend mit dem Tod war.
Das Verlassen organisierte Vater – und er machte es gut. Die Operation verlief rasch und reibungslos. Wir zwängten uns, im Gegensatz zu einer Tante, nicht durch die Kanäle (hätte ich eine Flucht durch unterirdische Wege erlebt, so würde ich ihr wohl die Platzangst zuschreiben, die mich in unterschiedlicher Intensität seit der frühen Jugend plagt). Ich weiß nicht, wie Vater es geschafft hat, und ich werde es auch nie mehr erfahren, denn ich habe nicht daran gedacht, ihn nach den Einzelheiten zu fragen, wobei ich auch gar nicht sicher bin, ob er sie behalten hatte. Wie viele von denen, denen das Verlassen gelungen war und die den Krieg überlebt hatten, mied er die Erinnerungen, er unterdrückte sie wohl. Vielleicht war das eine der Bedingungen für die Rückkehr zu einer normalen, banalen Alltäglichkeit, in der sich selbst ernste Schwierigkeiten bewältigen lassen. Doch die Verwirklichung dieser Absicht, bei der es um das Leben ging, die Verwirklichung dieses Auszugs aus einem Teil der Stadt in den anderen, der den hinter den Mauern eingesperrten Menschen als Domäne der Freiheiten und der Normalität vorkam, obschon auch er sich unter der Besatzung befand und schreckliche Dinge in ihm geschahen – diese Verwirklichung war keine leichte Aufgabe. Es ging darum, die Grenze zu überqueren, die von einer Mauer markiert wurde, aber auch darum, etwas auf der arischen Seite vorzubereiten, um nicht im Leeren zu landen, nicht sofort in unerwünschte Hände zu geraten und in eine ausweglose Situation zu kommen, selbst wenn sie eine Folge des Auswegs war.
Wir zogen gemeinsam aus, alle drei, auf riskante Weise. Aber damals gab es nichts, was nicht riskant gewesen wäre. Der Einsatz beim Retten des Lebens war das Leben selbst. Auf riskante, zugleich aber auf – ich muss dieses hier so unangemessene Wort verwenden – luxuriöse Weise: Wir fuhren durch das Tor, welches das Ghetto von der arischen Seite trennte, in einem von einem deutschen Soldaten gelenkten Automobil. Als wir hinausfuhren, war es noch dunkel, es ging alles schnell, den Soldaten habe ich wohl überhaupt nicht gesehen. Ich habe mir das Auto auch nicht angeschaut, ich erinnere mich nicht daran und weiß nur, dass es kein Lastwagen war, aber es war auch kein Personenwagen im engeren Sinne. Mit einer Plane bedeckt war es vielleicht ein Militärwagen, wie sie damals zur deutschen Ausrüstung gehörten. Wir sollten hinten sitzen, gebückt und so gekleidet, dass wir am wenigsten auffielen.
Aber unserem Hinausgehen war ein Ereignis vorausgegangen. Es ist mir nicht klar, wie Vater das Verlassen des Ghettos eingefädelt hatte, ich erinnere mich aber, dass er die Sache mit einem nicht mehr jungen Menschen Namens Kryształ erledigte. In der Endphase des Ghettos übte er irgendeine Funktion aus, er war wohl ein Beamter, der Kontakt zu den Deutschen hatte. Ich weiß nichts über ihn, ich vermag nicht zu sagen, ob er für die aussterbende Gemeinschaft tätig war oder ob es sich um einen Kollaborateur handelte, der die Zusammenarbeit vielleicht in der Hoffnung aufgenommen hatte, dadurch sein Leben und das seiner Familie zu retten. Wie auch immer es sich verhielt, er war es, der bei unserem Hinausgehen vermittelte, er erledigte es. Er kannte einen deutschen Soldaten (es gab so einen, vielleicht sogar mehrere), der bereit war, unter bestimmten Bedingungen und gegen Bezahlung Juden aus dem Ghetto herauszufahren. Er verlangte, dass sie kein semitisches Aussehen haben dürften. Wenn ich mich nicht irre, beauftragte er Kryształ mit der Beurteilung. Offensichtlich hatte er Vertrauen in dessen diesbezügliche Fertigkeiten: Er vertraute Kryształs Kriterien und glaubte sicherlich, dass ein jüdisches Auge ein schlechtes Aussehen besser erkenne als sein germanischer Blick. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er sich aus Sicherheitsgründen nicht mit denen treffen wollte, denen er einen so wichtigen Dienst erweisen sollte.
Mit dieser Rolle Kryształs als Begutachter hängt zusammen, was zum ersten Mal seit Monaten geschah: Ich ging aus der Wohnung, die ich seit Langem nicht verlassen hatte. Vater hatte er schon kennengelernt, Mutter hatte er sich im Shop von Többens angeschaut, nun musste er mich noch ansehen, um festzustellen, wie ich aussehe, ob ich nicht das Stereotyp vom Juden verkörpere. Es war schon dunkel, als wir uns trafen und ich erinnere mich nicht an den Ort, an dem es geschah. Kryształ selbst hat sich in meiner Erinnerung jedoch gehalten: Er war von kleinem Wuchs, ganz grauhaarig, mit kurz gestutztem Bart. Vater besprach lange etwas mit ihm und ich lauschte diesem Gespräch mit Anspannung, weil ich wusste, welch große Sache auf dem Spiel stand. Sicher legten sie die Einzelheiten fest, also Tag und Ort, an dem wir uns gleich nach Ende der Polizeistunde einfinden sollten, aber sie einigten sich auch über die Höhe der Bezahlung. Sie waren eindeutig zu einem Kompromiss gelangt. Kryształ hatte den Preis wohl noch etwas gesenkt, und vielleicht servierte ihm Vater zum Lohn dafür ein Kompliment: „Sie sind ein wahrer Kristall.” Ich schließe nicht aus, dass dieser Satz fiel, nachdem er festgestellt hatte, dass mein Aussehen unsemitisch genug war, um eine positive Meinung über mich abgeben zu können, so also, dass der geheimnisvolle und anonyme Soldat einverstanden wäre, uns fortzubringen. Hätte es dieses Wortspiel nicht gegeben, das sich meinem Gedächtnis eingeprägt hat, so hätte ich vergessen, wie dieser Mensch hieß. Selbst wenn er ein Kollaborateur war, so hat er mit Sicherheit keine größere Rolle gespielt, seinen Namen habe ich in keiner Arbeit über die Geschichte des Warschauer Ghettos je gelesen.
Als sie das Datum festlegten, wurde auch berücksichtigt, welche Mannschaft an diesem Tag am Ghettotor Wache haben würde. Es ging darum, dass sie aus solchen Wachmännern bestand, die – selbst wenn sie nicht geneigt waren, das Hinausgehen zu erlauben – so gleichgültig und wenig neugierig waren, dass sie sich nicht allzu sehr dafür interessierten, wer sich in dem Wagen befand. Wir saßen auf der Rückbank, so zusammengekauert, dass so wenig wie möglich von uns zu sehen war, Mutter mit einem Tuch auf dem Kopf und ich in einer dicken Wollmütze, „Pilotenmütze” genannt, die einen großen Teil des Gesichts verdeckte. Sie war mir noch vor dem Krieg in der ulica Nalewki gekauft worden, in einem Geschäft für Kindermode, das wohl „U Franciszki” (Bei Franciszka) geheißen hat. Diese Pilotenmütze wuchs gewissermaßen zusammen mit mir und leistete mir einige Kriegsjahre hindurch gute Dienste.
Am dramatischsten war die Fahrt durch das Tor. Der Soldat, der eine so explosive Ladung wie eine aus dem Ghetto fliehende dreiköpfige Familie transportierte, musste natürlich anhalten und dem Wachmann seine Dokumente zeigen. Das dauerte nicht lange, die Kontrolle war routinemäßig, und wir fuhren rasch weiter. Am vereinbarten Ort stiegen wir aus, irgendwo in der Innenstadt, wohl nicht allzu weit von der Mauer entfernt. Es war immer noch dunkel. Ich weiß nicht, wie Vater es organisiert hatte, wie es ihm gelungen war, mit jemandem auf der anderen Seite Kontakt aufzunehmen, doch an der vereinbarten Stelle wartete auf uns der Lange zusammen mit einem unbekannten Mann, der – was etwas Besonderes darstellte – ein „blauer Polizist” war. So also gelangten wir auf die arische Seite. Eine neue Etappe meiner Geschichte begann.