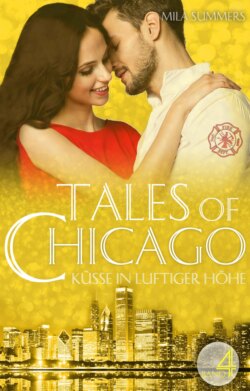Читать книгу Küsse in luftiger Höhe - Mila Summers - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
Оглавление»Du willst, dass wir Freunde bleiben?« Ich drückte das Handy in meiner Hand so heftig, dass mir bereits die Finger wehtaten.
»Ja. Freunde mit gewissen Extras, Baby.«
»Bitte was? Du spinnst ja!« Fassungslos beendete ich das Gespräch und legte das Handy mit zittrigen Händen auf die Arbeitsplatte.
Wie versteinert stand ich in der Teeküche des Museums. Meine Augen brannten und ich konnte einfach nicht glauben, dass er das gerade wirklich gesagt hatte.
Wie konnte mir Samuel nur vorschlagen, dass wir Freunde bleiben könnten? Und dann noch diese Anspielung: »… mit gewissen Extras, Baby.« Pah, dass ich nicht lache!
Anschließend hätte ich meinen Ärger am liebsten in den Untiefen eines gefüllten Schnapsglases ertränkt oder meinem Freund – oder vielmehr Exfreund – den Lack seines neuen Lamborghinis mit einem Schraubenzieher verkratzt.
Aber wer konnte mir das schon verübeln? Schließlich waren wir fast ein halbes Jahr lang ein Paar gewesen. Das war eine halbe Ewigkeit für mich. Samuel hatte sogar bereits von Heirat gesprochen. Er, wohlgemerkt, nicht ich.
Viel zu vertraut kam mir dieser Moment des Abschieds vor, wenn wieder einer meiner Partner die Biege machte und mich einfach so im Regen stehen ließ. Ich spürte diesen Druck auf der Brust, der mich kaum atmen ließ. Vergebens versuchte ich einen Schluchzer zu unterdrücken, der ohne Vorwarnung in ein lautes Husten überging.
Was brachte die Männer in meinem Leben immer wieder dazu, vor mir Reißaus zu nehmen? Lag es an meinem Parfüm oder war es mein Schuhtick? Vielleicht lag es an meinen einflussreichen Adoptiveltern? Es hatte bisher viele meiner Exfreunde eingeschüchtert, wie wohlhabend meine Familie war.
Wahrscheinlich lag es an mir. Jede Mutter liebt doch ihr Baby, oder? Aber mich hatte die Frau, die mich zur Welt gebracht hatte, wenige Stunden nach meiner Geburt in der Feuerwache in der Virginia Avenue abgegeben.
Irgendetwas musste damals bereits nicht in Ordnung mit mir gewesen sein. Anders konnte ich es mir einfach nicht erklären, dass ich immer wieder aufs Neue verlassen wurde.
Im Alter von zweiunddreißig Jahren hatte ich jetzt achtzehn – ja, diese Zahl ließ mich auch erschaudern – gescheiterte Beziehungen hinter mir. Von den zahllosen One-Night-Stands und den bindungsunfähigen Kerlen, die mich immer wieder hinhielten, gar nicht erst zu sprechen.
Was war bloß los mit mir? Ich schüttelte den Kopf, während ich mit vor Wut zittrigen Händen versuchte, das heiße Wasser in meine Tasse zu gießen. Ich spürte nicht mal, wie mir der heiße Dampf ins Gesicht stieg.
Wie in Trance nahm ich mir zwei Stücke Kandiszucker, versenkte sie in meiner Tasse und blickte dabei starr auf die vibrierende Oberfläche. Ich dachte an Samuel. Dachte an unsere gemeinsame schöne Zeit.
Bisher hatte ich mich dagegen wehren können, doch nun stiegen mir die Tränen in die Augen und liefen mir ohne Vorwarnung über die Wangen. Ein Tropfen nach dem anderen fiel auf die marmorierte Arbeitsfläche in der Teeküche des Museums.
Leise schluchzte ich auf, als ich mich daran erinnerte, wie mein Exfreund von Kindern und einem eigenen Haus gesprochen hatte. Im Gegensatz zu den Partnern meiner vorhergehenden Beziehungen standen wir, was das Finanzielle anging, auf Augenhöhe.
Samuels Vater war Großindustrieller und hatte mit dem, was er in seinem Leben erwirtschaftet hatte, bereits für zukünftige Generationen seiner Familie vorgesorgt. Samuel hätte sich die Finger gar nicht schmutzig machen müssen, dennoch war er, ehrgeizig und verbissen wie er war, in die Firma seines Daddys eingestiegen, um eigene Fußspuren zu hinterlassen.
Dieses Bedürfnis hatte ich in der Form nie verspürt. Natürlich liebte ich meinen Job im Museum und genoss es, mit wundervollen Kollegen den Tag zu verbringen. Besonders gefreut hatte ich mich, als Stacy nach der Geburt ihrer Tochter Jolie vor einigen Wochen wieder angefangen hatte zu arbeiten.
Das war es, was für mich im Leben zählte: die glücklichen Momente mit liebgewonnenen Menschen. Darin sah ich meine Erfüllung. Aber auch das war ein Grund, weshalb mir Samuel den Laufpass gegeben hatte.
Er konnte einfach nicht verstehen, dass ich mit dem, was ich tat, glücklich war und nicht die Herausforderung suchte, immer weiter, immer höher zu gelangen.
Wir waren grundverschieden. Diesen Umstand hatte ich mir früh eingestanden, aber ich fand gerade das so reizvoll an der Sache. Schließlich ergänzten wir uns doch irgendwie, oder etwa nicht?
Ich tat es schon wieder: Ich analysierte die Situation, zerbrach mir den Kopf über das Warum dabei und suchte nach einer Antwort auf meine Fragen. Samuel hatte nicht von einer Neuen berichtet oder unüberbrückbare Differenzen genannt.
Nein, er hatte es gleich auf den Punkt gebracht. Sein »Miranda, ich liebe dich nicht mehr« hallte mir noch immer dumpf durch den Schädel, während ich mechanisch den Becher an meine Lippen führte und mir sogleich an dem ersten Schluck daraus die Zunge verbrannte.
Gott, der Tag konnte gar nicht mehr schlimmer werden. War heute zufällig Freitag, der 13.? Oder weshalb sonst wurde ich gnadenlos vom Pech verfolgt? Was hatte ich nur getan, um das kosmische Gleichgewicht dermaßen ins Wanken zu bringen und derart bestraft zu werden?
Mein Kopf schwirrte. Ich brauchte dringend Ruhe, ein bisschen Zeit für mich. In naher Zukunft würde ich mir ein paar Tage freinehmen und weitab des Großstadttrubels alles hinter mir lassen; all den Ballast abstreifen, der mich zentnerschwer unter sich begrub.
Ich schloss die Augen und erinnerte mich zurück an die Urlaube in meiner Kindheit. Weitab der Großstadt im Huron-Manistee Nationalpark hatten wir unsere Abende am Lagerfeuer verbracht, während wir auf den Au Sable River blickten.
Ich sah die knisternden Funken fliegen und rief mir den Geruch nach Holz und Rauch ins Gedächtnis. Das gelang mir sogar so gut, dass ich das Gefühl hatte, es rieche wirklich verbrannt.
Doch Moment mal! Tatsächlich, es roch ganz so, als wäre etwas angebrannt. Ich blickte zu dem Ceranfeld, auf dem ich in einem Kessel das Wasser für meinen Tee erhitzt hatte, und überprüfte die Knopfleiste. Nein, ich hatte nicht vergessen, den Herd auszuschalten. Es musste einen anderen Grund für den beißenden Gestank geben.
Ein Kratzen in meinem Hals zwang mich zu husten. Ich wandte mich um und blickte zur geschlossenen Zimmertür. Unter dem Türschlitz zogen Rauchschwaden hindurch und nahmen den Raum bedrohlich ein. Meine Augen juckten und begannen neuerlich zu tränen.
Panik stieg in mir auf und Adrenalin ließ mich abrupt aufspringen. Was war hier bloß los? Hektisch stürzte ich in Richtung der Tür, um aus meinem Gefängnis zu entkommen. Schützend legte ich dabei meinen Arm vor Mund und Nase, da der beißende Qualm meine Atemwege belegte.
Ich keuchte. Innerhalb weniger Sekunden war ich kaum mehr in der Lage, die Augen geöffnet zu halten. Dennoch zwang ich mich dazu.
Todesängstlich drückte ich die Klinke der Tür herunter und eilte in den Korridor. Hier war es mir kaum mehr möglich, meine eigene Hand vor Augen zu sehen. Panisch rief ich um Hilfe, während mich die Erkenntnis wie ein Schlag traf: Feuer!
Schmerzerfüllt begann ich erneut zu husten, nachdem sich der Rauch unnachgiebig auf meine Schleimhäute legte. Mein Versuch, auf mich aufmerksam zu machen, hatte mir alles abverlangt.
Mühsam tastete ich mich an der Wand entlang Richtung Ausgang. Dabei begegnete ich keiner Menschenseele. Ich war völlig allein. Wo waren alle hin? Wieso hatten sie mich zurückgelassen? Machte sich denn keiner Sorgen um mich? War mein Fehlen womöglich nicht einmal aufgefallen?
Mittlerweile konnte ich kaum mehr atmen. Der Rauch vernebelte mir die Sinne, während mir das Feuer nach und nach den lebensnotwendigen Sauerstoff nahm. Meine Lungen brannten vor Schmerzen.
Ich konnte nicht mehr. Der Ausgang war zu weit weg, als dass ich eine Chance sah, ihn doch noch zu erreichen. Ich schaffte es einfach nicht, mich weiter voranzukämpfen. So sank ich schließlich hoffnungslos auf dem Boden zusammen, während ich spürte, wie sich die traurige Gewissheit in mir breitmachte: Ich würde es nicht überleben.
Qualvoll verrenkte sich mein Körper unter einem neuerlichen Hustenanfall, während eine Stimme aus weiter Ferne an mein Ohr drang: »Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo?«
Nein, das konnte nicht sein. Sicherlich spielten mir meine Sinne einen Streich. Hier war niemand mehr. Ich war mutterseelenallein und würde in wenigen Minuten meinem Schöpfer gegenüberstehen.
Doch da konnte ich wieder jemanden rufen hören: »Hallo, Miranda, sind Sie noch hier drinnen?«
Mit letzter Kraft bäumte ich mich auf, während ich Mund und Nase tief in meiner Ellenbeuge vergrub. Doch ich konnte nicht antworten. Ich war einfach nicht mehr in der Lage, zu sprechen.
Der Nebel um mich herum färbte sich immer dunkler. Es war mir kaum möglich, bei dem beißenden Qualm meine Augen offen zu halten, außerdem drehte sich plötzlich alles um mich herum. Auf allen vieren versuchte ich den Korridor entlangzukriechen.
Schließlich bekam ich irgendetwas Rundes zu fassen, warf es gegen die Wand, um auf mich aufmerksam zu machen, und brach unter der Anstrengung zusammen. Jetzt würde ich sterben. Alle Hoffnung verließ mich. Aber dann wurde ich hochgehoben und kräftige Arme drückten mich an eine breite Brust.
Mit letzter Kraft öffnete ich meine Augen und blickte in das ozeangleiche Blau vor mir. Dann war da nichts mehr: keine Stimmen, kein Nebel, kein Feuer.