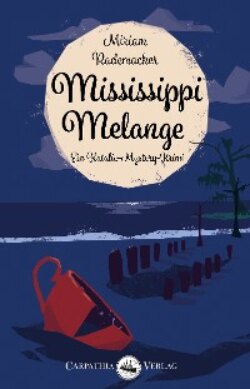Читать книгу Mississippi Melange - Miriam Rademacher - Страница 6
Kapitel 3
Оглавление»Sie streicht die Wände schon wieder um«, hörte ich meinen Vater sagen, der mit einem hellblauen Plastikfeldstecher vor den Augen an der Gardine vorbei aus dem Fenster spähte. Das Fernglas, das er dabei nutzte, hatte ich noch vor Katalies Einzug in einem Spielwarenladen in der Innenstadt erstanden. Obwohl es sich um billigen Schrott aus dem Reich der Mitte handelte, war es uns bei der täglichen Überwachung unserer Zielperson eine kleine Hilfe. Es verriet uns Details aus der gegenüberliegenden Wohnung, die uns ansonsten verborgen geblieben wären.
»Welche Farbe ist es diesmal?«, fragte ich und biss in mein geröstetes Weißbrot, auf dem die noch warme Leberpastete fettig glänzte. Endlich hatten wir wieder einen vollen Kühlschrank, endlich gab es alles, worauf wir gerade Lust und Appetit hatten. Und diesen Luxus verdankten wir der kleinen Katalie. Kaum zu glauben, wie leicht man sein Geld verdienen konnte. Hier saß ich an meinem Schreibtisch und genoss das Leben, sah gelegentlich nach Katalie und den anhaltenden Bussen und schrieb auch hin und wieder einen Brief für die Kummerkastentante der Daisy. Bei Lasse im Antiquariat und auch im Fitnessstudio ließ ich mich immer seltener sehen. Durch Maiberg verdienten wir genug, um uns kleine und größere Wünsche erfüllen zu können. So konnte es weitergehen.
»Die Grundfarbe bleibt erhalten. Sie bereichert das Grün lediglich um eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Blumen. Vielleicht sollten wir dem Kind ein Malbuch schenken. Anonym, versteht sich. Wir könnten es nachts in ihren Briefkasten werfen.«
Meinem Vater war die Kleine bereits ans Herz gewachsen. So wie jedem anderen im näheren Umkreis, wie es mir schien. Es war kaum zu glauben, aber ich hatte Jahre hier an der Gammelgade gewohnt, bevor ich auch nur den Vornamen meiner direkten Nachbarin erfuhr. Katalie hingegen kannte nach drei Wochen scheinbar jeden, grüßte jeden und wurde von jedem gegrüßt. Morgens saß sie auf den Gehwegplatten vor dem Haus und erwartete den Briefträger. Obwohl er so gut wie nie Post für sie hatte, bekam er von ihr eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne und ein paar nette Worte, auch bei Regenwetter.
Kaum anders erging es dem Zeitungsboten, dem alten Schuster, der regelmäßig mit seinem Gehwägelchen die Gammelgade kreuzte, und der Kioskbesitzerin an der Ecke, die es immer eilig zu haben schien, sowohl vor als auch nach den Öffnungszeiten. Katalie saß häufig auf der Stufe zur Gammelgade 104, um die Herzen aller Nachbarn im Sturm zu erobern. Und ich als ihr Chronist durfte Zeuge dieses Siegeszuges werden, ohne dass sie mich auch nur zur Kenntnis nahm. Unbemerkt hatte ich, nein: hatten wir, stets ein wachsames Auge auf sie. Es schien fast, als wären wir hinter den gegenüberliegenden Fenstern kein Teil ihrer Welt, und wir legten auch keinen Wert darauf, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Eine gewisse Distanz machte es mir leichter, meinem Arbeitgeber gegenüber loyal zu bleiben. Und mein Arbeitgeber war Maiberg. Der Mann, der einmal täglich von mir einen knappen Bericht über Katalies Aktivitäten erhielt. Den Bericht lieferte ich bereits gewohnheitsmäßig gegen achtzehn Uhr per Mail ab. Aufregendes gab es meist nicht zu berichten. Katalie erwies sich als äußerst pflegeleicht. Sie verbrachte viel Zeit in ihrer Wohnung oder auf der Stufe zum Hauseingang und ging nur selten aus.
In den ersten Tagen meiner Überwachung war ich ihr nie gefolgt. Maiberg hatte schließlich keine Außer-Haus-Beschattung bei mir bestellt, ihm war es wichtig gewesen, dass ich Katalie in ihrem Heim im Auge behielt. So hatte ich zunächst nur die Zeiten notiert, wenn sie fortging und wenn sie wieder heimkehrte. Inzwischen aber hatte ich mir angewöhnt, sie gelegentlich auf ihren Streifzügen zu begleiten und ihr Treiben zu beobachten. Diese Beschattungen erwiesen sich als erstaunlich abwechslungsreich. Denn Katalie sammelte nicht nur Herzen, sie sammelte auch eine Menge anderer Dinge. Garagenflohmärkte und Haushaltsauflösungen zogen sie nahezu magisch an. Und nach und nach füllte sie die gegenüberliegende Wohnung mit einem Sammelsurium an Möbeln, die sie tapfer nach Hause schleppte. Oder schleppen ließ. Zwei Tage nach ihrer Ankunft in der Gammelgade war sie nach einem ihrer Ausflüge mit einem Bauernschrank und zwei dazugehörigen Möbelpackern wiederaufgetaucht. Mit letzteren hatte sie bis spät in den Abend mit Chips und Cola gefeiert. Ein ganzes Rudel von Helfern hatte ihr nur einen Tag später eine wirklich scheußliche Einbauküche von rotzgelber Farbe in die Wohnung geschleppt, alle Hänge- und Unterschränke aufgebaut und die nötigen Installationen getätigt. Trotz jetzt funktionierendem Herd servierte sie auch diesen Helfern Cola und Chips. Überhaupt war ihre Ernährung ein Punkt, den ich als recht bedenklich empfand. Während eine meiner wenigen Schwächen die warme Leberpastete war, bestand Katalies gesamte Ernährung aus fettigen und übersüßten Speisen. Die Bäckereien und Fast-Food-Restaurants der näheren Umgebung mussten durch sie einen wahren Aufschwung verzeichnen. Akribisch hatte ich Maiberg in meinen täglichen Berichten auf diesen Umstand hingewiesen, was vermutlich dazu geführt hatte, dass Katalie jetzt regelmäßig mit Gemüse beliefert wurde. Dies ließ sie erst vergammeln und entsorgte es danach im Müll. Maiberg mochte in der Lage sein, Katalie nahrhafte Kost zu schicken, aber er konnte nicht dafür sorgen, dass sie sie auch aß.
Auf ihren Spaziergängen erfuhr ich weit mehr über Katalies Vorlieben und Gewohnheiten als durch das Spähen in ihre Fenster. Ich kannte jetzt bereits ihr Lieblingscafé und ihre Lieblingseisdiele, ein Ort, an dem sie skrupellos die seltsamsten Geschmacksrichtungen in ein und derselben Waffel vereinte. Wer hatte je zuvor gehört, dass man Lakritz-Eis mit Eischnee und Marmelade genießen konnte?
Überrascht hatte mich die Kleine, als sie in ihrer zweiten Woche einen Job bei Brugsen am nördlichen Ende der Gammelgade annahm. Akribisch und mit einer unglaublichen Ruhe hatte sie einen Nachmittag lang die Regale im Supermarkt mit frischen Waren bestückt, und trotz ihres Schneckentempos schien man dort von ihr entzückt zu sein, weswegen sie wohl zukünftig jeden Freitag dieser Beschäftigung nachgehen würde.
»Sie hat genug vom Malen«, hörte ich meinen Vater sagen, der das Fernglas absetzte und zu mir an den Schreibtisch kam, wo ich noch immer mein Frühstück einnahm. »Sie hat sich umgezogen.«
»Was trägt sie?«, wollte ich wissen und schob mir den letzten Rest meiner warmen Leberpastete in den Mund.
»Das bunt gestreifte Sommerkleid und die rosa Ballerinas.« Mein Vater lächelte milde, und sein früh gealtertes Gesicht hellte sich auf. »Sie sieht richtig süß aus.«
»Dann geht sie bummeln«, stellte ich fest. Vor einigen Tagen war mir aufgefallen, dass Katalies Garderobe bestimmten Gesetzen folgte. Zur Arbeit im Supermarkt trug sie ausschließlich Blautöne. Hatte sie vor, den Tag in ihrer Wohnung zu verbringen, bevorzugte sie Kleidung in knalligem Rot, und ein buntes Outfit deutete stets auf eine Einkaufstour und einen Cafébesuch hin.
»Sie nimmt die Hundeleine mit«, ergänzte mein Vater in diesem Moment.
Ich gab ein abfälliges Schnauben von mir. Die Hundeleine gehörte zu den Dingen, die wirklich seltsam waren. Verhielt Katalie sich ansonsten fast wie ein ganz normaler Durchschnittsmensch, so war es eben diese Hundeleine, die mir und jedem anderen klar verriet, dass mit diesem Mädchen etwas nicht stimmte. Die Leine war aus dunkelgrünem Leder und etwa drei Meter lang. Zu jedem ihrer Spaziergänge wickelte sich Katalie die Schlaufe um ihr Handgelenk. Das andere Ende, das mit dem glänzenden Karabiner, war an einem enorm großen Halsband befestigt, und jetzt kam das eigentlich Bemerkenswerte: In diesem Halsband fehlte das Tier. Tag für Tag zog Katalie ein leeres Halsband an einer Hundeleine hinter sich her, wenn sie die Wohnung verließ. Man konnte sich vorstellen, welche Blicke sie von Passanten erntete, die sie noch nicht kannten, doch Katalie grüßte nur höflich und zog mit ihrer Hundeleine an ihnen vorbei. Erwähnte ich schon, dass sie mich niemals grüßte? Der Grund dafür war einfach: Da ich stets hinter ihr ging, lief ich nie Gefahr, Katalie entgegenzukommen. Und was hinter ihr lag, existierte genauso wenig für sie wie unsere gegenüberliegenden Fenster. Sie wandte sich niemals um.
»Willst du ihr heute wieder nachgehen?«, fragte mein Vater und sah aus dem Fenster. »Sie verlässt jetzt die Wohnung.«
»Ja«, erwiderte ich, entschied rasch, dass in den kommenden vier Bussen jeweils elf Fahrgäste zusteigen würden und erhob mich von meinem Schreibtisch. Ich hatte bereits drei Weißbrotscheiben mit warmer Leberwurst verdrückt und fand, dass ein wenig Bewegung mir nicht schaden konnte.
So nahm ich meine gefütterte Jacke vom Haken und griff mir mein Belegexemplar der Daisy. Für gewöhnlich las ich den Käse, den ich selbst und andere für dieses Blättchen verfassten, nicht. Doch während der Beschattung stellten sich manchmal Wartezeiten ein, die ich mit der Daisy überbrücken konnte.
In dem Moment, als ich meine Wohnungstür hinter mir zuzog, öffnete sich die der Nachbarwohnung, und Fridegard Mortensen erschien auf ihrer Fußmatte, in den Händen einen prall gefüllten Müllbeutel.
»Ach bitte, Smiljan, wärst du so gut, das hier für mich zu den Tonnen zu tragen? Meine Knie wollen heute nicht so recht.«
Die Knie von Fridegard wollten eigentlich nie so recht, was daran lag, dass ihr Lebendgewicht jenseits der Hundertkilogrenze bei nur recht bescheidener Körpergröße lag. Von unserer ersten Begegnung an hatte ich mir strikt untersagt, ihr diesbezüglich Ratschläge zu erteilen, denn ich ging davon aus, dass sie bereits genug Diättipps und andere unaufgeforderte, aber gut gemeinte Kommentare aus ihrem Umfeld erhielt. Für mein Schweigen und das Erledigen kleiner Gefälligkeiten wurde ich ab und an mit einer kulinarischen Köstlichkeit aus ihrer Küche belohnt, und wer einmal von Fridegards Buttercreme genascht hatte, der wusste, warum sie so war, wie sie war.
»Kein Problem«, gab ich zur Antwort und griff schon nach den zusammengeknoteten Plastikzipfeln am Beutel, als sie plötzlich ausrief:
»Hast du denn diesmal deinen Fernseher ausgemacht?«
Mit fragendem Unterton wiederholte ich arglos: »Fernseher?«
»Ja, oder vielleicht ist es auch ein Radio. In letzter Zeit höre ich oft Stimmen und Musik aus deiner Wohnung, auch wenn du gar nicht da bist.«
Ich verfluchte meinen Vater insgeheim und nuschelte etwas von einem defekten Gerät, das sich selbst einschaltete.
Fridegard hob erstaunt die gezupften Brauen. »Ach? So etwas kann wirklich passieren? Was es nicht alles gibt.«
Ich beeilte mich, ihr den Beutel zu entwinden und rannte die Treppe hinunter, entsorgte den Müll in einer der Tonnen im Hinterhof und stand kurz darauf allein auf der Hauptstraße. Die Gammelgade lag still da, Nebelfetzen trieben an ihrem Ende dahin, von Katalie fehlte jede Spur. Ich hob den Kopf und sah zu meinen Fenstern empor. Oben stand mein Vater, halb verdeckt von einer Gardine, und deutete in eine Richtung. Ich folgte seinem Fingerzeig und entdeckte bald darauf die Hundeleine samt Halsband, die fürsorglich an einen Fahrradständer geknotet worden war. Katalie stattete dem Kiosk einen Besuch ab.
Durch das mit Plakaten fast ganz ausgefüllte Schaufenster beobachtete ich, wie sie eine Auswahl an Schokoriegeln bezahlte. Schon fast gewohnheitsmäßig trat ich in den nächsten Hauseingang und wartete dort ab, bis ich ihre Schritte auf dem Gehweg hörte. Diesen und dem Schleifen der Hundeleine auf den Steinen lauschte ich, bis es leiser wurde. Jetzt trat ich aus meinem Versteck und folgte ihr mit einigem Abstand.
Der Herbsttag war nasskalt. Wir begegneten nur wenigen Menschen, und die meisten kannten Katalie und ihre Hundeleine bereits. Sie grüßten freundlich und hasteten an uns vorbei, einem warmen Heim oder Arbeitsplatz entgegen.
Katalie und ihre Leine hüpften vor mir her über die Gehwegplatten. Nach einigen Minuten erreichten wir das Sukkertop-Café und Katalie mühte sich ab, die Leine um den Fahnenmast nahe der Eingangstür zu knoten. Glöckchen bimmelten, als sie im Innern verschwand. Wie immer, wenn Katalie das Sukkertop besuchte, wechselte ich die Straßenseite, um mir in der gegenüberliegenden Kneipe einen Fensterplatz zu suchen. Das Bier, das ich hier trinken würde, während Katalie im Café saß, würde ich Maiberg als Spesen in Rechnung stellen.
Der Wirt kannte mich und meine Gewohnheit bereits, das Bier fand sich an meinem Fensterplatz unaufgefordert ein, und ich legte die noch druckfrische Daisy vor mir auf den Tisch.
Mit mäßigem Interesse las ich ein paar Schicksalsgeschichten und blätterte dann bis zur letzten Seite vor. Dort fand sich die Bitte-melde-dich-Rubrik, wo sich die ein oder andere amüsante Anzeige fand. So auch heute. Zwischen
Komm zurück, es ist alles vergeben und vergessen. Ich liebe dich. Deine Maike
und
Jonas, wo bist du nur abgeblieben? Seit unserem Gespräch auf dem Balkon habe ich nichts mehr von dir gehört oder gesehen. Du wirst ja wohl nicht runtergefallen sein? Isabel
fand sich eine Anzeige, die so seltsam war, dass ich eine Weile über sie nachgrübelte:
Wer weiß etwas über den Kerl, der mir am Sonntagmorgen in der Havnegade in Esbjerg eine Spritze in den Oberarm gerammt hat? Möchte mich mit dem Schwein mal unterhalten, also Hinweise direkt an mich …
Es folgte eine Handynummer.
Wer um alles in der Welt rannte denn mit einer Spritze im Anschlag durch die Straßen und stach auf unschuldige Passanten ein? Und wer war so dumm, Geld für eine derartige Anzeige auszugeben? Vielleicht war Katalie gar nicht so seltsam. Vielleicht war ein leeres Hundehalsband auch nicht merkwürdiger als eine Spritze in der Hosentasche. Auf jeden Fall war es ungefährlicher.
Ich sah hinüber zum Café, wo sich noch immer nichts rührte, und bestellte ein weiteres Bier. Eine halbe Stunde später orderte ich ein drittes. Über das vierte dachte ich kurz nach, ging aber stattdessen rasch auf die Toilette. Als ich wieder an meinen Fensterplatz trat, sah ich die noch immer fest verknotete Leine am Fahnenmast. Was trieb das Mädchen nur so lange da drüben? Stellte sie einen neuen Rekord im Rumkugel-Essen auf? Das Sukkertop war berühmt für seine Rumkugeln, die keinen Rum enthielten, wie Touristen oft vermuteten, sondern nach Lebkuchen schmeckten und ihren Namen allein durch das Rumkugeln in Schokostreuseln erlangt hatten.
Nach einer weiteren halben Stunde ungeduldigen Wartens siegte die Neugier. Ich ließ die ausgelesene Daisy auf dem Tisch liegen, bezahlte und trat auf die Straße hinaus. Ein Bus fuhr an mir vorüber und ich schätzte die Zahl seiner Insassen auf über fünfzehn. Ich würde meine Zahlen nach oben korrigieren und sie alle meiner Haltestelle zuschlagen, sobald ich zu Hause ankam. Dann wechselte ich die Straßenseite und betrat das Café.
Fröhlich bimmelnder Glöckchenklang kündigte meinen Besuch an und ein rundlicher Herr mit Halbglatze hinter der Kuchentheke hob den Kopf.
»Was darf’s sein?«, fragte er. »Wir schließen gleich, aber ich kann Ihnen den Kuchen gern einpacken.«
Irritiert blickte ich auf meine Armbanduhr. Wahrhaftig, es war bereits kurz nach der Mittagszeit und das Sukkertop schloss für eine Stunde, damit auch der Herr hinter dem Tresen zu einer Pause kam. Rasch sah ich mich in dem kleinen Café um und stellte fest, dass alle Tische verlassen waren.
»Nun?« Der Herr hinter seinen Kuchen wartete noch immer auf meine Bestellung.
»Tja …« Ich war noch nie besonders schlagfertig gewesen.
»Oder wollen Sie gar nichts kaufen?« Er beugte sich vor. »Sind Sie der Kerl, dem ich etwas ausrichten soll?«
»Ausrichten?«
»Ja, von der kleinen Prinzessin.«
»Von wem?« Meine Güte, ich wusste, dass ich mich wie ein Vollidiot anhörte, aber mein Hirn kam einfach nicht schnell genug mit.
»Na, von Prinzessin Katalie. Die suchen Sie doch, oder?« Der Mann sah mich erwartungsvoll an.
Was hatte es für einen Sinn, zu leugnen? Ich war aufgeflogen. Ich wusste nicht wie und wann, aber es war so.
»Die Kleine ist durch die Hintertür abgedampft. Meinte, es sei ganz wichtig, dass sie mein Café mal nicht durch den Haupteingang verlässt. Und dem Ritter, der kommen würde, um nach ihr zu fragen, soll ich bestellen, dass er bitte das Ding heimbringen soll. Ich nehme an, Sie wissen, wovon die Kleine redet.«
Er deutete mit dem Daumen auf die hinter mir liegende Tür. Verunsichert drehte ich mich um und fragte: »Ding? Was denn für ein Ding?«
»Na das, das sie nicht mit hereinbringen will. Meint, es nimmt zu viel Platz weg.« Der Mann lachte schallend über seine eigenen Worte und mir dämmerte, wohin er gewiesen hatte. Zum Fahnenmast, wo eine Hundeleine und ein leeres Halsband auf mich warteten. Nur, dass es für Katalie niemals leer gewesen war. Sie hatte ein unsichtbares Ding über die Gammelgade gezerrt? Und nun befand sich dieses Ding plötzlich in meiner Obhut?
Hastig sah ich mich um. »Ist sie schon lange fort?«
»Ja.«
»Und hat sie gesagt, wohin sie geht oder wann sie wiederkommt?«, versuchte ich mein Glück noch einmal.
»Nee.« Mein massiges Gegenüber schüttelte sein Haupt. »Aber dass das Ding nur Chips frisst, das hat sie gesagt.«
Grußlos wandte ich mich zum Gehen und ließ die Glöckchen über der Tür kräftig bimmeln. Draußen starrte ich Leine und Halsband feindselig an. Teufel stand in geschwungenen Lettern auf letzterem. Teufel war also ein Ding. Ein großes unsichtbares Ding. Nicht, dass ich mir viel darunter vorstellen konnte, aber das musste ich ja auch nicht. Gut, ich würde Katalie den Gefallen tun und ihren imaginären Freund nach Hause bringen. Aber ich würde ihn nicht hinter mir herziehen. Teufel würde in meiner Jackentasche reisen und im Briefkasten auf die Rückkehr seiner Herrin warten müssen. Sollte das Ding sich doch ein bisschen zusammenrollen.
Ich besah mir das gewaltige Halsband noch einmal und empfand plötzlich einen heftigen Widerwillen dagegen, es zu berühren. Es musste zu einem recht prächtigen Ding gehören, das wahrscheinlich kaum durch den Briefschlitz zu quetschen war. Auch in meiner Jackentasche würde das Untier nicht glücklich sein.
Ich sah die Straße hinauf und hinab. Niemand war unterwegs. Keiner würde es bemerken, wenn ich die Leine hinter mir herschleifte. Ich könnte … Hastig schüttelte ich den Kopf, um diesen Gedanken zu vertreiben. Wer war ich denn, dass ich ein leeres Halsband spazieren führte?
Mit schnellen Bewegungen löste ich den Knoten am Fahnenmast und wollte die Leine schon zusammenknüllen, brachte es aber einfach nicht über mich. Stattdessen zog ich aus unerfindlichen Gründen daran. Das Halsband machte ein scharrendes Geräusch auf dem Fußweg. Es hörte sich vertraut und richtig an.
Teufel also. Ein Ding war er. Schade nur, dass ich ihn nicht sehen konnte. »Na, dann komm, Teufel.« Hatte ich das gerade wirklich gesagt?
Fast trotzig wandte ich mich zum Gehen und lief mit schnellen Schritten voraus. Hinter mir scharrte und schlurfte Leder auf Stein.
»Jetzt ist es soweit, Smiljan«, sagte ich laut zu mir selbst. »Jetzt wirst du bescheuert.«
Nie werde ich die drei Tage vergessen, die auf Katalies Verschwinden folgten. Wie hatte ich auch so blöd sein können, zu glauben, sie würde mich nicht bemerken? Natürlich hatte sie mich bemerkt, vielleicht schon am Tag ihres Einzugs. Und nun hatte sie einen Weg gefunden, um meiner Bewachung zu entgehen.
Aber musste sie nicht trotzdem irgendwann zurückkehren? Dort drüben auf der anderen Straßenseite befand sich ihre Wohnung, dort drüben hatte ich die Leine an einem Straßenschild angebunden und einen Napf mit Chips danebengestellt, der sich wie durch Zauberei immer wieder leerte, ohne dass ich erfuhr, wohin der Inhalt verschwand, so sehr ich ihn auch im Auge behielt. Seit drei Tagen lief ich jetzt täglich zum Straßenschild und füllte den Blechnapf nach, in dem ich üblicherweise mein Salatdressing anzurühren pflegte. Nie entdeckte ich auch nur eine Schuppe oder ein Haar von dem gefräßigen Ding. Und natürlich glaubte ich auch nicht an dieses Hirngespinst. Es war nur eine von Katalies kleinen Verrücktheiten, die ich ihr zuliebe eine Zeitlang am Leben hielt. Genauso lange, wie Katalie brauchte, um heimzukehren.
»Wie konntest du das Mädchen nur verlieren?« Zum wiederholten Male stellte mir mein Vater diese Frage und begleitete sie wie jedes Mal mit einem fassungslosen Kopfschütteln.
Ja, wie? Hätte ich doch nur geahnt, dass Katalie von meiner Existenz wusste, dann hätte ich mich von Anfang an anders verhalten, hätte mich darum bemüht, ihr Vertrauen zu gewinnen, statt wie ein Geheimagent hinter ihr herzuschnüffeln. Doch jetzt war es zu spät, um über alternative Strategien nachzudenken. Ich musste Maiberg seine tägliche Mail zukommen lassen, und darin würde, wie auch in den vorangegangenen, auf keinen Fall zu lesen sein, dass Katalie ihre Wohnung seit nunmehr drei Tagen nicht mehr betreten hatte.
Es fiel mir nicht schwer, mir ein paar Zeilen über Katalies Beschäftigungen der letzten Stunden auszudenken. Oft genug schrieb ich ja herzerweichende Briefe für die Daisy und erfand auch regelmäßig recht plausibel klingende Zahlen für die Haltestellenstatistik. Da war es auch keine große Sache, sich etwas für die leere Mail auf meinem Rechner auszudenken. Doch je länger der Cursor fröhlich blinkte, desto mehr musste ich einsehen, dass es gar nicht so einfach war, einen passenden Tag für Katalie zu erfinden. Schließlich behauptete ich dreist, dass sie den Vormittag verschlafen, danach Papierblumen gebastelt und auf ihre Fensterbänke gelegt hatte, während sie jetzt am frühen Abend zu einem Spaziergang durch die Gassen nahe der Gammelgade aufgebrochen war. Den Abend würde sie sicher wieder einmal Chips essend vor dem Fernseher zubringen, so meine Prognose. Ja, ich konnte sie jetzt fast vor mir sehen, wie sie da im roten Jogginganzug vor der Glotze saß.
Lächelnd drückte ich auf Senden, als mein Vater hinter mir murmelte: »Aber heute ist Freitag. Und freitags arbeitet sie doch immer bei Brugsen.«
Ich schloss für einen Moment die Augen. Mein Vater hatte natürlich Recht. Vor lauter Bemühungen, ein paar fiktive Katalie-Stunden zu ersinnen, war mir das Naheliegende entfallen. Sofort jagte ich der ersten Mail eine zweite hinterher, in der ich ausführlich erklärte, warum Katalie von ihrem gewohnten Rhythmus abgewichen war.
Gerade hatte ich sie per Mausklick auf die Reise geschickt, als mein Vater, der noch immer hinter mir stand, leise sagte: »Jetzt würde ich an seiner Stelle erst recht misstrauisch werden.«
Noch einmal schloss ich die Augen und konzentrierte mich auf eine von mir selbst erdachte Atemübung, von der ich hoffte, dass sie den Geist klärte und beruhigte. Die Übung taugte nichts.
»Warum kannst du deine Einwände nicht anbringen, bevor ich eine Nachricht abschicke«, fauchte ich.
»Du hast mich nicht nach meiner Meinung gefragt«, war die knappe Antwort. »Aber aus reiner Freundlichkeit lasse ich dich an meinen Bedenken teilhaben. Wenn ich dieser Maiberg wäre, würde ich nach Erhalt dieser beiden Mails augenblicklich hier bei dir anrufen. Oder noch besser: Ich würde mich ins Auto setzen und gleich selbst herkommen.«
»Und gnade mir Gott, wenn ich dann keine gute Erklärung dafür habe, warum ich seit Tagen in die Fenster einer verlassenen Wohnung starre. Vielleicht ist das alles nur ein Test und sie hat die letzten Tage bei Maiberg selbst verbracht. Dann bin ich soeben durchgefallen«, entfuhr es mir. »Was soll ich denn jetzt nur machen?«
»Antworten auf seine Fragen suchen, bevor er sie stellen kann. Das würde ihn beeindrucken«, schlug mein Vater vor. »Oder noch besser: Du gehst los und suchst das Mädchen. Ich kann sowieso nicht verstehen, warum du noch hier herumsitzt, anstatt jeden Kieselstein links und rechts der Gammelgade umzudrehen.«
»Fein«, erwiderte ich, und meine Stimme klang unfreundlicher als beabsichtigt. »Dann bleib du bitte hier und beobachte für mich den gegenüberliegenden Hauseingang. Und sobald Katalie heimkehrt, rufst du mich auf meinem Handy an, verstanden?«
Mein Vater nickte artig und griff nach dem Plastikfernglas auf der Fensterbank.
Ich aber war noch nicht fertig. »Und behalte auch gleich diesen Fressnapf neben dem Halsband im Auge. Ich will endlich wissen, auf welche Weise sein Inhalt immer wieder verschwindet.« Mein Vater sah bereits aus dem Fenster, doch ich hatte noch ein paar Abschiedsworte für ihn. »Und kein Fernsehen und kein Radio, hörst du? Die Nachbarn werden schon misstrauisch.«
Draußen auf der Straße fiel feiner Nieselregen auf den Asphalt. Bald würden die Läden schließen, über allem lag ein seltsames Dämmerlicht.
Ich schlug den Jackenkragen hoch und lief mit schnellen Schritten dem Sukkertop entgegen, bog aber kurz vor dem Café in eine Seitenstraße ein. Mein Interesse galt der Rückseite des Gebäudes, dem Ort, an dem sich Katalies Spur verlor. Schon bald fand ich mich auf einem Hinterhof wieder, der neben großen Mülltonnen auch einem Kaninchenstall und einem Fahrradschuppen Platz bot. Der Gestank verrottender Essensreste lag in der Luft. Ich drückte beide Nasenflügel fest zusammen und überlegte: Von hier aus hätte Katalie in den Seitengassen der Gammelgade abtauchen, einige hundert Meter später wieder zur Hauptstraße zurückkehren und an einer der weiter unten gelegenen Haltestellen den Bus in die Innenstadt nehmen können. Vom Zentrum Esbjergs aus konnte ihr Weg sie einfach überall hingeführt haben. Vielleicht war sie mittlerweile nicht einmal mehr in Dänemark.
Ich gab der größten Mülltonne einen Tritt und dann noch einen. Zu einem dritten kam es nicht, weil mein Handy in der Innentasche meiner Jacke zu klingeln begann. Hastig zog ich es hervor. Aber der Anruf kam nicht von meinem Vater. Es war Piet vom Fitnesscenter, der mich bat, vorbeizuschauen, um einen verstopften Abfluss zu reinigen. Außerdem hatte seine Yogalehrerin zu Anfang November gekündigt und er brauchte eine Vertretung. Ich sagte allem zu, in der Hoffnung, im November noch am Leben zu sein, was zweifellos davon abhing, ob es mir gelang, Katalie wiederzufinden, bevor Maiberg mich fand, und legte auf.
Irgendwo musste dieses Mädchen doch stecken. Und wer wusste schon mehr über sie und ihr Leben als ich?