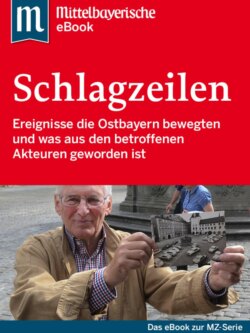Читать книгу Die großen Schlagzeilen Ostbayerns - Mittelbayerische Zeitung - Страница 11
ОглавлениеDer Samuraimord und seine Folgen
In Amberg metzelt ein psychisch-kranker Mann einen anderen mit einem Schwert nieder. Eine Augenzeugin erklärt, wie man so einen Schock verarbeitet.
Der „Samuraimord“ sorgte bundesweit für Entsetzen und Schlagzeilen: 38 Hieb-, Stich- und Schnittverletzungen zählte der Leichnam, nachdem der Täter von dem Amberger Familienvater abließ. Fotos: Archiv/dpa
Von Pascal Durain, MZ
Amberg. Es war das Schaufenster, das über den Tod des Waffenhändlers Wolfgang B. (*) entscheiden sollte. Um kurz vor 10 Uhr betrat Max D., ein junger, kräftiger Mann den Laden, und ließ sich von B. die Schwerter zeigen, wählte eines aus und bezahlte 99 Euro dafür. Dann geschah an diesem sonnigen Herbsttag, dem 11. Oktober 2004, das Bestialische.
Als Wolfgang B. gerade das Packpapier holte, prüfte sein Kunde die Schärfe der Klinge. „Schärfer wird’s nimmer“, soll B. mit einem Grinsen zu D. gesagt haben, der sich dann dachte: „Jetzt gibt es keine bessere Gelegenheit“, und dann plötzlich auf den Mann hinterm Tresen einschlug.
Geschockt und mit einer klaffenden Wunde versuchte der 50-Jährige noch zu fliehen. Er schleppte sich über die Hintertür in das benachbarte Haushaltswarengeschäft, in dem sich gerade sieben Menschen aufhielten. Darunter waren auch drei Redakteure des Bayerischen Rundfunks, die für die Sendereihe „Montagsretter“ hier Station machten. Zu stoppen war der Mann mit dem Schwert aber nicht. Ein Passant, der das Geschehen mitbekam, rannte in den Laden, sprang auf Max D. und rang ihn zu Boden. Der Helfer fiel dabei in eine Vitrine. D. richtete sich einfach wieder auf, schaute den Mann drohend an, ehe er sich wieder Wolfgang B. zuwendete, der auf einem Treppenabsatz liegen geblieben war. Die BR-Redakteurin Beate P. versteckte sich unter einem Tisch und hörte B. noch sagen: „Jetzt sterbe ich.“
Der Täter stellte sich wenige Minuten später widerstandslos der Polizei. Wolfgang B. starb im Haushaltswarengeschäft.
Im Auftrag eines Erzengels
Später an diesem Tag erklärte der Amberger Polizeidirektor Michael Liegl der Presse, der junge Mann habe in dem Geschäftsmann den „Teufel“ gesehen. Max D. glaubte von sich, der Erzengel Gabriel zu sein, der den Auftrag gehabt habe, das Böse zu „eliminieren“. Der Mann stamme aus geordneten Familienverhältnissen, er wohne noch bei seinen Eltern und wirke derzeit „apathisch“.
Minuten vor der Tat hing die Waffe noch in diesem Schaufenster. Foto: Archiv
Die Augenzeugen haben Grausames erlebt, eine der brutalsten Taten in der der Geschichte der Oberpfalz. Wolfgang B.s Körper zählte später bei der Obduktion 38 Hieb-, Stich- und Schnittverletzungen. Max D. hatte ihm eine Hand abgeschlagen, den Kopf und einen Unterarm fast vollständig abgetrennt.
Die meisten Zeugen konnten vor Gericht nicht aussagen. Beate P. (*) traute sich doch. Die Radiojournalistin hoffte, mit einer Aussage das Geschehene besser verarbeiten zu können, sagte sie dem Richter. Zehn Jahre nach der Tat sagt sie immer noch: Das war richtig. Es habe gut getan zu sehen, dass auf der Anklagebank nur ein Mensch sitze – nur ein kranker Mann und kein Monster. „Das hat den Horror genommen.“
Max D. war krank. Er litt an einer schizophrenen Psychose, Tage zuvor hatte er seine Medikamente abgesetzt. Am Morgen des 11. Oktober bat ihn seine Mutter noch, die Tabletten wieder zu nehmen. Max D. sagte bei seiner Vernehmung: „Niemand hätte mich davon abhalten können.“
Fast genau ein Jahr nach der Tat wurde er verurteilt. Er entschuldigte sich noch im Gerichtssaal, blieb aber meist emotionslos auf der Anklagebank sitzen. Seine Gleichgültigkeit schockierte. Am Ende schloss sich sein Verteidiger dem Antrag des Anklägers an. D. selbst sagte, er wollte lieber in der Psychiatrie bleiben, aus Angst „so etwas wieder zu tun“. Dem folgte der Richter.
Beate P. hat heute diese tiefe Verletzung der Seele, wie sie sagt, überwunden. Und zwar dank dem Kriseninterventionsteam, dem Pfarrer in Amberg, einer Traumatherapie und einer sehr klugen Chefin. Wenn Beate P. ins Erzählen gerät, merkt man schnelle, dass sie viele Forschungsthemen für das Radio bearbeitet. Sie erklärt, welche Stoffe der Körper in so einer Situation freisetzt. „Das ist wie ein Drogencocktail. Wenn man die Stresshormone nicht abarbeitet, setzen sie sich fest.“
Am 11. Oktober 2004 wusste sie das noch nicht: Als die Polizei sie aus dem Laden geholt hat, hätten weder sie noch ihre beiden Kollegen realisiert, was da gerade vorgegangen sei. Die Beamten brachten die Augenzeugen zum evangelischen Pfarrer, der ihnen zunächst ein Gefühl der Sicherheit wieder vermitteln wollte. „Doch erst mal habe ich überhaupt nicht kapiert, dass ich Hilfe brauche.“ Sie habe sich nur gedacht: „Ja, jetzt ist ja alles rum.“
So titelte die MZ am 12. Oktober 2004 am Tag nach der Tat. Foto: pd
Kollegen haben sie dann zurück nach München in die Redaktion gebracht; Mitleid haben die „Montagsretter“ allerdings nicht hören wollen. Beate P. glaubt, dass sie einfach auf ein Standardprogramm umgeschaltet habe. Sie wollte nicht überempfindlich wirken, und wies daher alles zurück. Ihre Chefin schickte sie nach Hause, ordnete aber an, die Nummer des Kriseninterventionsteams in den Geldbeutel zu stecken. Eine weise Entscheidung, wie sich schon am folgenden Tag herausstellen sollte.
Reden, weinen, schreien
Am nächsten Morgen, als die Radiojournalistin ihren Morgenkaffee in ihrem Lieblingscafé trank, eine Boulevardzeitung aufschlug und neben der Schlagzeile zur Bluttat ihr Bild unter dem des Täters entdeckte, löste sich der Schock. P. konnte nicht mehr sprechen, plötzlich war sie mit allem überfordert. Der Kellnerin drückte sie nur die Nummer des Kriseninterventionsteams in die Hand. Und dann fuhr auch schon der Krankenwagen vor.
Ihre Chefin hatte das Münchner KIT bereits vorgewarnt – so fiel das erste Aufarbeitungsgespräch noch vor Ort leichter. Angekommen in der Redaktion setzten sich alle drei Beteiligten mit den Experten zusammen und redeten. Lange. P. glaubt, dass ihr genau das schon viel gebracht habe, dass sie dort eingesehen habe, dass sie vielleicht eine Traumatherapie braucht entgegen aller Vorurteile.
Heute ist sie mehr als dankbar darüber, dass sich Menschen ehrenamtlich bei KIT engagieren, um Fremden zu helfen. „Es ist unnötig, sich alleine damit herumzuplagen und Fachleute nicht in Anspruch zu nehmen.“ Bei einer schweren körperlichen Krankheit lehne man Tabletten ja auch nicht ab. Die Journalistin begab sich also zur Therapie. 20 bis 30 Sitzungen, genau weiß sie das nicht mehr. Viel reden, viel weinen, viel schreien, war das. „Klar, das gehört eben dazu.“
Nach dem Prozess gegen Max D. war die Radiofrau nur noch einmal in Amberg. Und kehrte zum Tatort zurück. Dort redete sie mit der Ladenbesitzerin. Den Kontakt habe sie inzwischen aber verloren. „Für mich war es vielleicht leichter, das aufzuarbeiten. Ich war weit weg vom Geschehen.“ Natürlich werde sie diesen Tag wohl nie vergessen. Jeden Tag daran denken, muss sie aber auch nicht. Zum Glück. Durch die Therapie habe sie das abgearbeitet – das sei viel wichtiger. „Verdrängen kostet nur Energie.“
Hinweis: *Namen aller Beteiligter wurden im Text verfremdet.