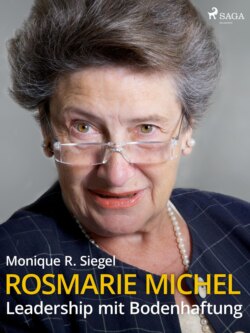Читать книгу Rosmarie Michel - Leadership mit Bodenhaftung - Monique R. Siegel - Страница 5
I
ОглавлениеWer seine Wurzeln nicht kennt ...
Wer seine Wurzeln nicht kennt, kennt keinen Halt.
Stefan Zweig
In der Welt der business nomads, der mobilen Führungskräfte in unserer globalisierten Wirtschaft, gehören Tradition oder das Sich-Besinnen auf seine Wurzeln eher in die Mottenkiste als zur Standardausrüstung für den Führungsalltag. Das ist sicher generationsbedingt, und wer weiss, ob sich nicht in absehbarer Zeit hier eine Trendwende anzeigt, ähnlich wie bei den Familiengeschichten von Migranten, wo sich die zweite Generation total an die neuen Gegebenheiten anzupassen versucht, die dritte jedoch gerne von den einstmals eingewanderten Grosseltern Geschichten, Tradition und Folklore aus dem Auswandererland abruft. Rosmarie Michel verträte in diesem Szenario die Generation der Grosseltern, die sie ja auch in Wirklichkeit vertritt; sie hat immer die Kraft für all ihre Tätigkeiten auf das zurückgeführt, was sie im Elternhaus, in der Familie, in ihrer Vaterstadt mitbekommen hat.
Tatsächlich hat das Elternhaus den besten Anschauungsunterricht geboten, in mehr als einer Hinsicht, ganz besonders aber in der für Leadership so unerlässlichen Sozialkompetenz.
Es sieht so aus, als sei sie in eine heile, bürgerliche Welt geboren: Das grosse Haus steht unübersehbar am Anfang der Zürcher Altstadt, jetzt 30 Meter von der Limmat entfernt, damals näher am Wasser, dessen Rauschen den Verkehrslärm im Stadtzentrum übertönte. Man hatte damals das Gefühl, am Fluss zu leben, der für kleine Höhepunkte im Leben der beiden Kinder sorgte. Ein Spaziergang mit der Kinderschwester Anna führt oft über einen bebauten Flussübergang, wo es zwei Attraktionen gibt: ein Velogeschäft und den Verlag, der die Micky-Maus-Bücher herausgab, die im Schaufenster die kleinen Betrachter verführerisch anlachen. Dass im Herbst und im Winter auch noch ein italienischer Marroni-Mann seinen Stand dort hat, erhöht die Attraktivität dieser Stelle am Fluss.
Kinderschwester? Ja. Kein Luxus, wenn man bedenkt, dass beide Eltern beruflich sehr engagiert waren, ihre Kinder aber sicher und behütet wissen wollten. Das, was man heute mit quality time bezeichnet – ein zwar zeitlich beschränktes, aber intensives Familienleben –, erlebt das Kind schon in den 30er-Jahren. Mitgeliefert wird eine sehr gesunde, von grossem Respekt geprägte Einstellung zur Arbeit und zur Rolle berufstätiger Mütter.
Zürich, die ehemalige römische Garnison, war trotz des Kleinstadtgepräges in der Zeit zwischen den Weltkriegen schon damals eine offene Geschäftsstadt, und das grosse Haus am Central ist ein echtes Gewerbehaus, eine Mischung aus einer Produktionsstätte mit Backstube und grossen Nebenräumen, einem Geschäft mit Ladenlokal und Café, einem Personalhaus mit dem Gepräge einer Grossfamilie und schliesslich dem Familiensitz der Schurters. Das Haus ist ein Erbstück der Mutter, die ihre Schwester ausgezahlt hat und das renommierte Geschäft jetzt in Eigenregie betreibt.
Gründer der Familiendynastie ist der Urgrossvater, der 1869 für seine Frau dieses Haus am Central gekauft hat, zusammen mit einem kleinen Rebberg. Als die kleine Rosmarie die Szene betritt, befindet sie sich in einem gemischten Umfeld von Familie und Angestellten: aktive Dienstboten ebenso wie langjährige treue Mitarbeiterinnen wie die Haushälterin, die fünfzig Jahre lang die Familie betreut hat, inzwischen zwar pensioniert ist, aber keine Bleibe hat.
Der Grosshaushalt wird fast wie ein kleines Hotel geführt; Köchin, Putzerin, Wäscherin gehören sozusagen zur Familie, der Waschtag alle vier Wochen ist ein Grosskampftag, an dem jede Beteiligte ihr Revier beansprucht und ihre Spezialwäsche zu erledigen hat, und am Esstisch sitzen oft ein Dutzend Personen.
Das ganze Haus durchweht der Duft der Backstube, in der acht Konditoren unter Führung eines Chefkonditors Qualitätsarbeit leisten. Das Geschäft ist gross, hat einen guten Namen und seinen festen Kundenkreis: traditionsbewusste Zürcherinnen und Zürcher, die die frisch gebackenen lokalen Spezialitäten nach Rezepten aus früheren Jahrhunderten schätzen.
Der Mutter, Trudy Schurter, ist bewusst, dass der Besitz des Familienhauses gewisse Verpflichtungen mit sich bringt. So bewirtet sie alleinstehende Verwandte aus der Generation ihres Vaters am gastlichen Familientisch, und so gibt es auch jeden Samstag einen Familienkaffee, den die Jüngste allerdings langweilig und eher bemühend findet; zu jener Zeit ist das Kaffee-Einschenken ausschliesslich Mädchensache, und obwohl sie später eine der besten Gastgeberinnen wird, behagt ihr diese Art des Mithelfens gar nicht. Schlimmer noch sind die diversen Erziehungsversuche, die bei solchen Gelegenheiten an wehrlosen Kindern verübt werden. Irgendwann merken die meisten Gäste dann aber, dass solche Versuche bei diesen Kindern von keinerlei Erfolg gekrönt sind; Bruder und Schwester sind sich einig, dass sie ganz gut ohne diese überflüssigen Bemerkungen und Ratschläge auskommen können.
Die Hausbewohner bilden eine starke Gemeinschaft mit den für derartige Konstellationen üblichen Problemen: Gesundheits-, Sprach-, Ehe- und Kinderprobleme, auch Konfliktsituationen in der Führung (der Chef der Backstube hat hie und da Mühe, eine Chefin zu akzeptieren) – für all dies ist die Mutter zuständig, die gelegentlich unter dem Druck der Geschäfte emotional oder sogar ungerecht reagiert.
In diesem Umfeld hatte man nur zwei Möglichkeiten: Man konnte sich absondern – das war eher das Muster meines Bruders – oder man hat mitgemacht, das war eher meins. Was ich dort lernen konnte, nämlich mit allen möglichen Menschen, egal, welcher Herkunft, gut durchzukommen, mit allen zu sprechen, mit allen eine Verbindung aufzubauen, das habe ich alles in diesen ersten Jahren gelernt. Ich habe damals schon wahrgenommen, wie in diesem Haus geführt worden ist, wie man miteinander umgegangen ist, wie man versucht hat, zu einem Ergebnis zu kommen.
Hier also holt sie sich ihre ersten Lektionen in Sachen Führung, von einer starken Mutter, die weiss, was es heisst, seinen sozialen unternehmerischen Verpflichtungen nachzukommen. Hier nimmt sie aber auch Situationen wahr, die sie auf keinen Fall wiederholen möchte. Positiv oder negativ: Es sind Lektionen, die ihr später wertvolle Dienste leisten werden. Aus diesen Anfängen entwickelt sich unter anderem eine Einstellung zur Arbeit, die sie ein Leben lang begleiten wird:
Respekt vor der Arbeit der anderen, vor dem Beruf, dem täglichen Brotverdienen – da war eine Mentalität, dass wer gearbeitet hat und wie er gearbeitet hat, Respekt verdient. Zweitens: Das war kein Kinderspiel und der Arbeitsplatz kein Kinderspielplatz, sondern man hat sich ernsthaft damit auseinandergesetzt, und es gab nur eine Möglichkeit, damit umzugehen: mitzuhelfen, seinen Kräften entsprechend.
Ihren Kräften entsprechend, wird die Kleine früh zum Mithelfen angehalten. Da gibt es Aufgaben hinter und vor den Kulissen; diejenigen im sogenannten «Office» beinhalten das, was kleine Mädchen meistens zuerst auch im Haushalt zu tun lernen:
Damals gab es noch keine Abwaschmaschinen, also war Tellertrocknen angesagt. Das war, im Alter von neun Jahren, mein Debüt im Arbeitsleben. Allerdings habe ich mich schon damals gerne mit Maschinen befasst: Die Kaffeemaschine zum Beispiel hatte so ein Zäpfli, das man ziehen musste, um Kaffee herauszulassen. Ich fand das faszinierend; schon damals hat sich offenbar nicht nur eine gewisse technische Begabung manifestiert, sondern auch mein Pragmatismus: Weil ich schon früh gemerkt habe, dass Stehenlassen auch Teller trocknet, habe ich mich mit Hingabe der Kaffeemaschine gewidmet, den Kaffee herausgelassen und in die Durchreiche gestellt. Ich wurde also die Hilfskaffeeköchin.
Schon früh darf sie auch auf die eigentliche Bühne des Geschehens, in den Laden, in dem die Schokolade so herrlich duftet:
Am Sonntag nach dem Kirchgang kamen fast alle Kunden, um das Sonntagsdessert zu holen, viele Väter und die dazugehörigen Kinder. Ich durfte dann an der Türe stehen und sagen: «Auf Wiedersehen, danke vielmal!»
Ich habe das sehr gerne gemacht, denn ich hatte keine Angst vor fremden Leuten. Bei diesen Kunden aller Altersklassen und verschiedener Schichten habe ich gesehen, dass die alle so normal sind wie meine Eltern. Und natürlich waren sie auch sehr nett zu der Kleinen, die da an der Tür stand und, sich ihrer wichtigen Aufgabe voll bewusst, Auf Wiedersehen sagte.
Nun ist es aber nicht so, dass es sich hier um echte Kinderarbeit handelt, im Gegenteil: Rosmarie Michel wächst behütet auf. Kinderschwester Anna ist ein Teil ihres Alltags – und Mitglied ihres Fan-Clubs, ist man versucht zu sagen. Die Kleine ist der Liebling der Frau, die als ausgebildete Kinderschwester zuerst einmal für den Sohn Hansjürg in die Familie geholt wird. Der findet Kinderschwestern allerdings völlig überflüssig, und dementsprechend bekommt er sofort Krach mit ihnen. Nachdem schon einige das Haus betreten und es ziemlich schnell wieder verlassen hatten, reisst der Mutter der Geduldsfaden. Diese hier, die der Dreijährige auch nicht mag, wird bleiben, dekretiert sie, zumal ja jetzt auch noch ein Säugling zu betreuen ist.
Die Kinderschwester bleibt also – und zwar noch zwanzig Jahre! Nicht dass Rosmarie Michel diese Betreuung so lange gebraucht hätte, aber die treue Angestellte wird natürlich ein Teil des sozialen Gefüges: Man konnte doch jemanden, der so lange so treu der Familie gedient hatte, nicht entlassen! Schon früh lernt das behütete kleine Mädchen, dass viele Menschen auch in weniger komfortablen Umständen leben, und sie ist entschlossen, das zu ändern, wenn auch in diesem Fall vielleicht weniger pragmatisch:
Einmal hat die Kinderschwester mich, als kleines Mädchen, mit zu sich nach Hause genommen. Ihr Vater arbeitete in einer grossen Tuchfabrik, und die Mutter betrieb eine kleine Landwirtschaft. Ich hatte es gut: Wo immer ich hingekommen bin, fand man mich süss und nett und war lieb zu mir. Also, ich bin dorthin gegangen und musste irgendwann mal auf die Toilette: Sie hatten natürlich ausserhalb des Hauses ein Plumpsklo. Dann bin ich nach Hause gekommen, und meine Mutter hat gefragt, obʼs schön gewesen wäre, und da hab ich gesagt: Ja, es wäre sehr schön gewesen; das seien ganz liebe Leute, aber meine Eltern müssten ihnen unverzüglich ein WC fürs Haus schenken, damit diese netten Menschen nicht mehr im Winter frieren müssten. Natürlich haben meine Eltern diese Sache etwas anders gesehen und mir klargemacht, dass das nicht ihre Aufgabe sei.
Sie war, wie sie das nennt, «der Chouchou der Kinderschwester», was sie mit Kinderlist auch weidlich ausgenutzt hat. Schon damals manifestiert das kleine Mädchen frühe Führungsambitionen: Sobald das Kind sprechen kann, macht die Kinderschwester das, was das kleine Mädchen will – auch wenn sie dies wahrscheinlich selten realisiert. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander; hie und da kommt Anna sogar mit in die Ferien. Und oft werden sie zu Komplizen, sei es gegen Bruder und Haushälterin, die sich zu einer neuen Allianz verbündet haben, oder gegen Aussenstehende, die der Kleinen nicht passen. Rosmarie Michel hat nie einen Kindergarten von innen gesehen (sie sinniert heute darüber, ob das vielleicht ein Manko gewesen sein könnte ...), aber da ihre Mutter sich verpflichtet fühlte, gestrandeten Existenzen beizustehen, wird das Kind zum Beispiel in eine Rhythmik-Schule geschickt.
Eine Kundin hat im Laden auf diese Frau hingewiesen, die dringend ein Einkommen brauchte, und schon wurde Klein-Rosmarie in die Bewegungsschule geschickt. Aber ich habe zur Bedingung gemacht: nur mit der Kinderschwester! Ich hab das allein nicht ausgehalten; mir hat es vor der Frau wirklich gegraust.
Viele Menschen haben lernen müssen, dass man sich Rosmarie Michel gegenüber nicht ungerecht, unredlich oder unethisch verhalten darf. Ein solches Verhalten zieht Folgen nach sich. Zu denjenigen, die das zu spüren bekommen, gehört auch Frau Berg, ein weiterer «Fall». Sie unterrichtet Kinder aus dem Quartier in Bastel- und Handarbeiten, und obwohl die Kleine kein übermässiges Interesse an dieser Art von Unterricht an den Tag legt, muss sie zu Frau Berg, denn das Kursgeld der fünf oder sechs Kinder, die dort pro Woche ein paar Stunden verbringen, ist ein Beitrag an das nicht gerade üppige Einkommen dieser Dame. Ein Zwischenfall beendet diesen Unterricht dann sehr abrupt, und hier zeigt sich deutlich, wie konsequent Rosmarie Michel bereits als kleines Mädchen auf Ungerechtigkeit reagiert:
Ich hab das noch ganz gern gemacht, besonders die Bastelarbeiten mit Lederresten. Eines Tages hat Frau B. etwas gesucht – ich glaube, es war irgendein Stück Leder –, und als sie es nicht fand, hat sie behauptet, jemand hätte es genommen. Wir daraufhin: Nein. Danach hat sie mich angeguckt und gesagt, ich hätte das genommen. Da habe ich wortlos mein Säckli gepackt und bin nach Hause gegangen – und danach nie mehr zu Frau Berg.
Natürlich wollte meine Mutter wissen, warum ich schon so früh zu Hause war. Ich sagte ihr, das sei nicht so wichtig. Doch Frau Berg war nicht nur ungerecht, sondern wohl auch nicht besonders intelligent. Sie kam eine Woche später in den Laden, um sich zu beklagen, dass ich nicht zur Bastelstunde gekommen sei. Meine Mutter meinte, ich müsse ihr nun doch sagen, was da passiert sei. Also habe ich es ihr gesagt. Ich hatte eine Mutter, die so etwas begriff und nachvollziehen konnte, und so sagte sie zu Frau Berg, als die wiederum im Laden auftauchte: «Es hat keinen Zweck, dass Sie sich bei mir beklagen. Sie haben meine Tochter angeschuldigt für etwas, was sie nicht getan hat. Das ist sie nicht gewöhnt. Machen Sie sich keine Hoffnungen: Sie wird nie mehr zu Ihnen gehen.» Damit war für Frau Berg eine Einnahmequelle weg, aber ich nehme an, man hatte ein Halbjahr im Voraus gezahlt. Auf der Strasse, wenn ich Frau Berg kommen sah, habe ich mich hinter der Kinderschwester versteckt – damals begegnete man sich ja noch häufiger –; ich konnte sie nicht ausstehen.
Wenn bisher in erster Linie von Trudy Michel, geborene Schurter, die Rede war, dann ist das keine Abwertung des Vaters Fritz Michel, aber auch kein Zufall. Der Umgang mit der tüchtigen, stilsicheren Mutter – einer Frau mit Ansprüchen und allure einerseits und sozialem Gewissen andererseits –, und die enge Bindung an sie, geprägt von Liebe und Respekt, ist eine der starken Wurzeln, auf die Rosmarie Michel ihre Zukunft bauen darf. Die Liebe zum Vater ist jedoch ebenfalls da, aber der Vater, Spross einer etablierten Hoteliersfamilie, ist es nicht, oder zumindest nicht in dem Ausmass wie die Mutter. Mit ihm verbinden sie andere Dinge – Aktivitäten, die mit einem Hauch von Abenteuer daherkommen, wie zum Beispiel Filme machen oder Auto fahren.
Letzteres hat ihm dann doch noch die Liebe seines Lebens beschert. Als er Trudy Schurter bittet, seine Frau zu werden, lehnt sie ab. Der junge Mann, acht Jahre älter als sie, ist als Hotelier mit internationaler Ausrichtung tätig, und sie möchte Zürich nicht verlassen. Enttäuscht sucht er Trost im entfernten Ägypten: In Luxor ist er Direktor der Upper-Egypt Hotels. Doch sie wird ihn vermissen, so sehr, dass sie nach seiner Rückkehr die Initiative ergreifen wird ...
Nach einem Versuch, sich im Schurterschen Geschäft zu betätigen, zieht es ihn wieder in seinen angestammten Beruf, die Gastronomie. Er übernimmt als erster Pächter das renommierte Zürcher Gesellschaftshaus «Zum Rüden». Seine Frau ist einverstanden, auch wenn sie dafür ein Haus mit Seeanstoss in Meilen verkaufen muss. Hinzu kommt, dass sie jetzt alle Arbeiten für die Confiserie alleine bewältigen und zusätzlich noch Aufgaben hinter den Kulissen des Restaurants übernehmen muss. Für ihren Mann ist es jedoch der richtige Schritt, und sie wird ihn unterstützen, bis er Mitte der 50er-Jahre krank wird und nicht mehr voll arbeiten kann.
Mein Vater war der Inbegriff eines korrekten, weltgewandten, international tätigen Hoteliers, immer im dreiteiligen Anzug und mit Hut. Er war ein sehr guter Ehemann, der meine Mutter geliebt und verwöhnt hat, und ein liebevoller Vater. Wir waren eine Vierereinheit, ein kompaktes Team, und wir haben jedes Jahr wunderschöne Ferien zu viert verbracht.
Meine Eltern hatten allerdings sehr verschiedene Interessen, die sie ganz unabhängig verfolgten. So war zum Beispiel meine Mutter eine begeisterte Bergsteigerin, die in den Ferien am liebsten jeden Schweizer Berg erklommen hätte, während mein Vater dem nichts abgewinnen konnte, dafür aber seine grossen, bequemen Autos liebte. Der demokratische Beschluss: Wir Kinder verbrachten in den Bergferien meistens einen Tag mit dem Aufstieg zu irgendeiner Bergspitze – wobei das Einkehren in einer Berghütte natürlich nicht fehlen durfte – und den nächsten in Papis Auto. Da er Cabriolets liebte, wurden mein Bruder und ich «verkleidet», mit eng anliegender Kappe und den sogenannten Staubmänteln, genossen aber sowohl die Fahrt selbst als auch die Aufmerksamkeit, die man dem schönen Auto seitens der Fussgänger entgegenbrachte.
Die andere grosse Leidenschaft meines Vaters war das Filmen, wobei er dort, wie bei den Autos auch, wenn möglich das Neueste haben musste, was an Produkten auf dem Markt war. Diese Liebe zum Technischen habe ich auch von ihm mitbekommen. Am Central gibt es immer noch ein grosses Archiv von Filmen, hauptsächlich von der Familie. Nein, eigentlich hauptsächlich von meinem Bruder. Als ich dann kam, war das Aufregende an diesen filmischen Familiendokumentationen wohl schon vorbei; jedenfalls hat man um mich viel weniger Aufhebens gemacht.
Andererseits: Offenbar hatte mein Vater viel Vertrauen in mich als Autofahrerin. Ich habe sehr früh meinen Fahrausweis gemacht, und ich war die Einzige, die ausser meinem Vater das Auto benutzen durfte. Beide Eltern haben mir vertraut, wenn ich am Steuer sass, und in späteren Jahren konnte ich meiner gehbehinderten Mutter die grösste Freude machen, wenn ich sie durch die Gegend chauffierte.
Rosmarie Michel ist auch heute noch eine hervorragende Autofahrerin, egal ob es Links- oder Rechtsverkehr zu bewältigen gilt; sie hat Mutproben in den verschiedensten Orten auf der Welt mit Wagen unterschiedlichster Qualität bestanden und wird hoffentlich noch lange nicht auf den geliebten fahrenden Untersatz verzichten müssen. Beim Fahren ist sie grosszügig, flucht nicht und hält sich im Grossen und Ganzen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber in Bezug auf ihr Auto kommt eine ihrer Macken zum Vorschein: Sie erträgt es nicht, wenn jemand in ihrem Auto hinter ihr sitzt (mit ganz wenigen Ausnahmen), und versucht ziemlich erfolgreich zu vermeiden, dass sie Leute mitnehmen muss. Nie würde sie daher ein viertüriges Auto fahren, und wer sich auf dem Beifahrersitz befindet, ist sich des Privilegs, bei ihr mitfahren zu dürfen, bewusst. Die Macke hat aber auch eine positive Seite: Wenn sie grössere Strecken alleine fährt, kann sie in Ruhe über ein anstehendes Problem nachdenken; zur Überraschung aller kommt sie dann meistens ganz entspannt an ihrem Zielort an, weil sie unterwegs eine Lösung erarbeitet hat.
Die Liebe zum Fahren verbindet sie mit ihrem Vater, der damals schon wusste, wie sehr sich der Charakter eines Menschen beim Autofahren zeigt: Wenn ein junger Mann sich im Leben seiner Tochter so weit bewährt hatte, dass er nach Hause eingeladen wurde, musste er schon bald einen Charaktertest beim Autofahren ablegen ...
Es ist der Vater, der die Richtung der Ausbildung seiner Tochter bestimmen wird: Sie wird die renommierte Lausanner Hotelfachschule besuchen. Als sie bei der Abschlussfeier einen Preis bekommt, den die Tochter übrigens eher auf das Renommee der Hoteliersfamilie als auf ihre Leistungen zurückführt, sieht sie Tränen in den Augen des Vaters. Es wird ihm gut getan haben zu sehen, wie auch das väterliche Erbgut in den Genen der Tochter zu finden ist – etwas, was sich dann später bei ihrem von ihm arrangierten Stage im Londoner Hotel Dorchester an der Park Lane sehr deutlich manifestieren wird. Fritz Michel stirbt viel zu früh im Alter von 71 Jahren; seine Witwe wird ihn um 26 Jahre überleben, und die liebevolle, wenn auch nicht konfliktfreie Beziehung zwischen einer autonomen Mutter und einer willensstarken Tochter wird diese Zeit prägen und über den Verlust hinweghelfen.
Es gibt vieles, was an Rosmarie Michel erstaunt. Die meisten ihrer Aktivitäten und Entwicklungen stehen auf den ersten Blick in pointiertem Gegensatz zu ihrer Herkunft, Kindheit und Jugend, allen voran die Tatsache, dass sie weltweit tätig sein wird. Denn dies war ihr wirklich nicht an der Wiege gesungen worden, und hätte man es dem kleinen Mädchen prophezeit, es wäre wohl in seinen eigenen Tränen ertrunken. Weinen ist zwar nicht das operative Wort im Leben von Klein-Rosmarie, aber wenn ihre Lebensumstände bedingen, dass sie auch nur ein paar Hundert Meter vom Haus am Central entfernt ist – ohne Eltern oder Kinderschwester –, öffnen sich die Schleusen, die sich erst schliessen, wenn sie wieder glücklich zu Hause ist.
Sie fasst den Begriff «Heimweh» sehr eng, und sämtliche Versuche, ihn zu erweitern, sind zum Scheitern verurteilt. Mit Kinderschwester Anna zu deren Eltern in den Nachbarkanton Aargau zu fahren ist in Ordnung, solange man am selben Tag wieder zurückkehrt. Dasselbe gilt für das Haus in Meilen, wo man im Kreise von Verwandten schöne Sommertage verbringen kann – das Kind outet sich früh als Wasserratte, lässt sich einfach in den See plumpsen, um dort mit einem Gummiring stundenlang herumzuschwimmen – und das Landleben geniesst, aber eben nur am Tage: Übernachten kommt nicht in Frage!
Diese Kindheitsphobie nimmt mehrmals dramatische Ausmasse an, und wenn auch die Erwachsene heute selbstironisch darüber lachen kann, hat die Kleine diese Anlässe alles andere als lustig gefunden.
Man vergisst es immer wieder, aber die Schweiz hat Anfang der 40er-Jahre eine kurze Bedrohungsphase erlebt, auf die die Regierung mit einer Art Evakuierungskampagne reagierte: Der Bevölkerung wurde geraten, die Städte zu verlassen und sich aufs Land zurückzuziehen. Wer in der Stadt bleiben musste oder wollte, sollte wenigstens nicht in der Nähe von besonders gefährdeten Lokalitäten wie zum Beispiel Industrieanlagen oder Bahnhöfen bleiben. Da das Haus am Central in Spucknähe des Zürcher Hauptbahnhofs liegt, beschliessen die besorgten Eltern, wenigstens ihre Kinder bei Tante Lydia an der Bellerivestrasse hinter dem Opernhaus, also einen guten Kilometer vom Central entfernt, unterzubringen, selbst aber im eigenen Haus zu bleiben. Rosmarie ist inzwischen im frühen Teenageralter, ihr drei Jahre älterer Bruder fast schon ein junger Mann.
Der Onkel und die Tante, beides liebenswerte Menschen, sind nur allzu bereit, die beiden jungen Pensionäre für eine Weile bei sich zu beherbergen, kommen jedoch gar nicht in die Verlegenheit, diese Bereitschaft unter Beweis stellen zu müssen. Nach dem Abendessen bringt man die Kinder in den ersten Stock, wo Betten für sie vorbereitet sind. Das junge Mädchen traut ihren Augen nicht: Sie sollen in diesem Haus SCHLAFEN?! Und schon treten die Tränenkanäle über die Ufer und schwemmen alles hinweg. Man erklärt ihr nochmals in Ruhe, warum die Eltern ihre Kinder in einer weniger gefährdeten Gegend sehen möchten, aber das bewirkt nur einen neuen Höhepunkt: «Wenn meine Eltern sterben, will ich mit ihnen sterben!», schluchzt das Kind melodramatisch. Nun, für diesen Abend ist Sterben kein Thema, weil die Kinder frühestens am nächsten Tag wieder abgeholt werden können. Vor diesem nächsten Tag liegt jedoch noch eine Nacht, und die muss durchgestanden werden. Der Onkel begeht eine Verzweiflungstat: Er nimmt einen Underberg aus dem Schrank und gibt ihn seiner Nichte zu trinken! Wie erhofft, beruhigt sie sich und wird, erschöpft vom Weinen und der Aussicht auf das Sterben, bald müde genug, um einzuschlafen. Am nächsten Morgen geht es zurück ans Central. Die Tränenflut ist vorbei; was bleibt, ist die Erkenntnis, dass man gut beraten ist, sie nicht allzu weit von ihrem Zuhause zu entfernen.
Aber da sind auch noch andere Überbleibsel: Für den Rest ihres Lebens werden die Underberg-Fläschchen sie begleiten, wird deren Inhalt sie beruhigen, ihrem Magen seine Balance wiedergeben – und vor den vielen alkoholfreien Anlässen, die sie als Verwaltungsratspräsidentin eines Unternehmens, das eine alkoholfreie Gastronomie betreibt, durchführen muss, noch einen kleinen Kick geben. Aber noch wichtiger: Nie wird sie das tun, was man so vielen Frauen in Entscheidungsfunktionen vorgeworfen hat: in einem Gremium mit Tränen eine Entscheidung nach ihrem Gusto erzwingen oder auf einen zu ihren Ungunsten in dieser Art reagieren!
Das würde sich auch wohl kaum mit echter Leadership vereinbaren lassen, nicht wahr?