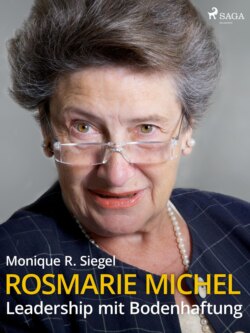Читать книгу Rosmarie Michel - Leadership mit Bodenhaftung - Monique R. Siegel - Страница 7
III
ОглавлениеÜbung im Weitsprung
Make no small plans. They have no power to stir the blood.
Dr. Lena Madesin Phillips 2
Die Zeit war reif für den grossen Wechsel, und Rosmarie Michel war es auch; als Nächstes war eine Übung im Weitsprung angesagt: Im Frühjahr 1956 verlässt Rosmarie Michel Zürich, um einen einjährigen Stage in London anzutreten. Das war mehr als eine Schule in einer anderen Stadt, aber im eigenen Land; da waren die Fremde, eine andere Sprache, andere Lebensgewohnheiten, ein unbekanntes Umfeld. Hier war es ziemlich egal, ob sie die behütete Tochter aus gutem Hause war – das «gute Haus» war hier unbekannt, ihre sehr guten Schulabschlüsse interessierten niemanden, und 1956 gab es keine Billigflüge, die einen in ein paar Stunden wieder nach Zürich brachten. Sie wollte ein Zeichen setzen, aber es war mehr als das: Es war die organische Entwicklung im Leben einer jungen Frau, die wusste, dass die Zeit gekommen war, um diesen Schritt der Abnabelung zu tun.
Das Dorchester ist die Art von Hotel, in dem ihr Vater tätig war und in denen ihre Eltern abstiegen. Sie kommt jetzt als Trainee, im Status einer lernenden Angestellten also, mit einem Salär von £ 2,5 pro Woche. Das «Tochter aus gutem Hause»-Image bringt sie so schnell nicht weg; der Londoner Taxifahrer fährt die junge Frau jedenfalls vor den Haupteingang des Hotels – nicht zuletzt, weil er sich Hotelangestellte, die mit Überseekoffer anreisen, wohl nicht vorstellen konnte. Daraufhin geht sie ins Hotel und gibt immerhin zu verstehen, dass sie fürchtet, nicht den richtigen Eingang benutzt zu haben. Nein, natürlich nicht. Aber mit dem Schrankkoffer ist sie auch am Personaleingang fehl am Platz, also schleust man sie durch den Eingang zum Ballsaal. Was für ein Eintritt!
Dies ist allerdings das letzte Mal, dass ihre Herkunft bei ihrer Tätigkeit eine Rolle spielen wird. Von jetzt an widmet sie sich ganz der Aufgabe, die vor ihr liegt: das Hotelwesen à fond kennenzulernen. Sie möchte etwas leisten, möchte der Familie beweisen, dass sie etwas kann, und ganz nebenbei die Erinnerungen an den Mann, der ihren ersten grossen Liebeskummer verursacht hat, loswerden. London wird die echte Abnabelung sein, und sie ist innerlich bereit dazu.
Seltsam, nicht wahr? Die Ach-so-Heimweh-Geplagte weiss gar nicht mehr, was Heimweh ist – das Gefühl, das sie so oft überwältigt und die Tränenschleusen geöffnet hat, ist wie weggeblasen. Das Töchterchen, das sich gerne hat verwöhnen lassen, möchte auf einmal nicht mehr dem Elternhaus auf der Tasche liegen, sondern selbstständig ihr Geld verwalten – und «ihr Geld» bedeutet hier genau das, was ein Trainee verdient. Das heisst unter anderem:
Ich habe natürlich in der Stadt nur normale Verkehrsmittel benutzt und nie mehr als die Teilstrecke für den ersten Tarif gelöst, den Rest bin ich dann gelaufen. Als ich nach Hause kam, musste ich sämtliche Schuhe zur Reparatur bringen; überall waren Löcher in den Sohlen. Dafür habe ich London zu Fuss kennengelernt, viel mehr gesehen, als wenn ich Taxi gefahren wäre, und mein Monatssalär habe ich so gut verwaltet, dass ich sogar noch vieles von dem grossartigen kulturellen Angebot – Theater, Musik, Museen – geniessen konnte.
Sie ist jetzt eine von den 350 Mitarbeitenden, die sich um 200 Gäste kümmern. Sie ist selbstbestimmt und kann ihre freie Zeit an Orten ihrer Wahl und auf die Art verbringen, wie es ihr zusagt. An dem einzigen freien Tag pro Woche fährt sie dann mit der «Green Line», einem ausgedehnten Verkehrsnetz, in andere Städte; dabei besichtigt sie berühmte Burgen, Gärten, Bibliotheken – und natürlich auch Kathedralen. Als sie einmal in Windsor mitten in eine Messe gerät, ist sie etwas erstaunt, dass die Menschen, die eben noch auf Augenhöhe neben ihr sassen, plötzlich ganz klein geworden sind: Sie beten kniend. Rosmarie Michel ist es peinlich, als Einzige in Normalgrösse dazusitzen; sie geht in die Hocke und harrt aus, bis das Gebet vorbei ist; erst dann entdeckt sie unter dem Sitz vor ihr das Kissen, das für diesen Zweck vorgesehen ist. Es ist ein ständiger Lernprozess – im Kleinen wie im Grossen –, aber auch eine Zeit voller neuer, aufregender Erlebnisse.
Eines Abends läuft sie zurück ins Hotel, von Westminster Abbey in die Park Lane. Hinter ihr Schritte, als sie am St. James’ Park entlangläuft – Schritte, die beharrlich auch hinter ihr bleiben. Sie hat zwar keine Angst, aber sie schielt ein wenig nach links, was der junge Mann, der zu den Schritten gehört, als Aufforderung nimmt, sie anzusprechen. Er will sie nicht überholen, sondern nur mit ihr sprechen. Er stellt sich vor, ganz korrekt; kommt aus den Vereinigten Staaten, um seine verheiratete Schwester in Cornwall zu besuchen, und macht einen fünftägigen Stopp in London. Ob sie London gut kennt und ihm helfen könne? – Nein, eigentlich nicht. Aber man kommt ins Gespräch. Auch sie erwähnt ihren Namen und ihr Herkunftsland. Ob er sie dorthin begleiten darf, wo sie wohnt? – Nein, eigentlich auch nicht. «Park Lane» als Strassennamen lässt sie sich noch entlocken, mehr aber nicht. Danke und adieu!
Das Adieu entpuppt sich als ein «Auf Wiedersehen». Am nächsten Tag nämlich wird für den Trainee aus der Schweiz ein wundervoller Rosenstrauss im Dorchester abgegeben, mit Dank für die Konversation des Vorabends und einer Einladung zu einem Opernabend. Er muss mir gefolgt sein, ohne dass ich es gemerkt habe, denn ich habe das Hotel nie erwähnt, meint sie, immer noch schmunzelnd. Natürlich fühlt sie sich geschmeichelt und sagt zu:
Es war ein Gastspiel der Münchner Staatsoper, und man gab «Siegfried» in deutscher Sprache; ich habe in den Pausen für die drei Reihen vor und hinter mir übersetzen müssen. Die restliche Zeit haben wir dann Ausflüge gemacht, Kultur genossen oder sind essen gegangen. Ich habe jede freie Minute dieser fünf Tage mit ihm verbracht – es war einfach eine schöne Erinnerung. Nicht mehr und nicht weniger.
Und das war es dann wohl auch. Bedauern, dass es nur so kurz war? Nein. Ein Flirt? Nicht einmal das. Was soll sie auch mit einem Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt? Zu jener Zeit war ich wohl ins Alter der Paarung geglitten. Ich habe aber weniger interessierte oder interessante Partner gefunden, sondern viele potenzielle Schwiegermütter, die in mir die ideale Schwiegertochter sahen. Heiraten ist nicht das Thema der Stunde (schon gar nicht käme dafür der Nachtportier in Frage, dem es die Schweizerin angetan hat); der berufliche Lernprozess steht im Vordergrund. Und der ist umfassend und wird für sie eines der wichtigsten Teile im Leadership-Puzzle sein ...
Als Alleinstehende ist es ihr egal, wann sie ihren freien Tag nimmt; sie macht also oft und gerne Sonntagsdienst und ist dann als Gouvernante für acht Stockwerke alleine verantwortlich. Da gibt es viele Geschichten von ganz berühmten Gästen, die sich zum Teil ganz unmöglich aufgeführt haben; die Gäste des Dorchester sind gewöhnt zu bekommen, was sie wollen, und einige männliche Gäste sind überrascht, beleidigt oder wütend, wenn ihre eindeutig-zweideutigen Angebote bestimmt, aber höflich abgelehnt werden. Dann aber sind da auch Menschen, die sich trotz Berühmtheit und Status als ganz umgänglich herausstellen, vielleicht einsam sind und sich gerne ein wenig mit der sehr korrekten jungen Schweizerin unterhalten.
Auf der anderen Seite des Spektrums sind die Mitarbeitenden, die ihr unmittelbar unterstellt sind: die sogenannten bath women. Sie reinigen die Badezimmer und verrichten andere gröbere Arbeiten. Bei ihnen lernt sie unter anderem, sich mit ganz verschiedenen Typen von Englisch zu arrangieren, denn diese Frauen sprechen entweder unverfälschtes Cockney oder kommen aus Irland mit einem Englisch, das für Schweizer Ohren fast nicht verständlich ist. Aber die erdgebundenen Frauen glänzen mit Mutterwitz und mögen die junge Schweizerin, die selbst über einen guten Sinn für Humor verfügt, und man arrangiert sich irgendwie in Bezug auf die Sprache.
In diesem Hotel zu arbeiten hat mir so viel gebracht – ich kann nur dankbar sein für diese Erfahrung! Hotelverantwortliche sind 150 prozentige Dienstleister; 24 Stunden pro Tag dreht sich alles um den Gast. Das kann in der Atmosphäre eines Bienenhauses stattfinden oder in der eines Hexenkessels. Die Nacht wird zum Tag, die Planung kann zum Chaos werden, wenn jemand Wichtiges unangemeldet erscheint oder ein anderer Gast trotz Reservierung einer Suite und einer nicht enden wollenden Liste von Sonderwünschen nicht erscheint.
Die theoretische Ausbildung in Lausanne war zwar eine gute Grundlage, hätte aber ohne die Praxis längst nicht genügt, um in diesem Beruf gut zu sein. Rosmarie Michel weiss zwar immer noch nicht, was genau sie werden will, aber sie kombiniert die Theorie mit viel praktischer Arbeit, hört zu, sieht hin, lernt ständig dazu. Gewisse Talente bringt sie schon mit, andere Ansätze entwickelt sie – es ist ein echtes learning by doing:
Nach und nach habe ich alles wahrgenommen: wann die Türe aufging, wer hereinkam, was am Sitzungstisch passierte – man muss mehr als zwei Augen und zwei Ohren haben. Ich habe immer gesehen, wo etwas fehlte, zum Beispiel im Service oder in der Kommunikation. Man kann diese Art von Wahrnehmung schulen, aber man kann auch dankbar sein, wenn man in dieser Richtung vorbelastet ist, denn dieser Bereich ist so wichtig.
Und dann der Bereich der Kommunikation, besonders angesichts der sozialen Unterschiede! Ich habe schnell begriffen, dass es nur einen Weg gibt, wie man da durchkommt: Für mich waren alle gleich, die Gäste, das Management, die bath women, und ich habe versucht, immer höflich und korrekt, aber auch bestimmt aufzutreten – wenn es zu Sprachschwierigkeiten kam, tat es oft auch nur ein Lächeln.
Das ist alles eine Frage des Trainings, das wird einem nicht in die Wiege gelegt, aber dieses Training ist mir später sehr zugute gekommen.
Das kann man wohl sagen. Noch heute sieht sie «alles» – jede kaputte Glühbirne in einer Hotelhalle, jedes unvollständige Besteck auf einem Nebentisch im Restaurant; sie sieht, wo ein Aschenbecher oder ein Glas fehlt – nicht immer einfach für diejenigen, für deren Arbeit sie am Ende verantwortlich ist, aber sehr eindrücklich und hilfreich, wenn man daran denkt, dass sie fast ein halbes Jahrhundert ihr Café und ihre Confiserie geführt hat. Und noch heute ist sie eine hervorragende Kommunikatorin, egal in welcher Sprache, in welchem Land, mit welchen Menschen, und das ist – abgesehen von den wirklichen Lösungsvorschlägen, die ihr gewöhnlich rechtzeitig einfallen – in erster Linie eine Frage der verbalen und nonverbalen Kommunikation.
Learning by doing ist eine Art Lebensmotto; sie eignet sich nicht so gut als Befehlsempfängerin, ist also nur bedingt brauchbar für erzieherische Versuche, die mit «Du musst ...» anfangen:
Der Lernprozess war bei mir immer eine Folge von Umständen, wo Menschen mich geführt, beeinflusst oder mitgenommen haben. Ein Beispiel ist diese «No Sports!»-Angelegenheit. Ich wusste schon früh, dass mich Sport, mit Ausnahme von Schwimmen und Tanzen, nicht sonderlich interessiert, aber Mami und Papi denken da ja oft anders: Sie fanden, es gebe gewisse Sportarten, die man einfach ausüben muss. Bei meiner Mutter war das Tennis, bei meinem Vater Skilaufen.
Beim Skifahren war ich aber eine absolute Niete, bis ich einen didaktisch begabten Skilehrer fand. Der erzählte mir nicht, was ich tun musste, sondern motivierte mich, ihm einfach nachzufahren. Ich erkannte beim Hinterherfahren die richtigen Schwünge, die richtigen Tempi, die richtige Haltung – und dann war es kein Kunststück mehr, unten heil anzukommen.
Meine Mutter hatte dieses Muster etabliert. Wenn ich sie fragte, wie ich etwas machen sollte, war die Antwort: «Du kannst ja ‹luege›!» Das Motto der Schweizer Polizei für Erstklässler, die zum ersten Mal in ihrem Leben alleine die Strasse überqueren müssen, hätte von ihr kommen können: «Luege, lose, laufe.» 3 Dazu kam ein Urvertrauen, dass ich «wohl schon heil unten ankommen würde» und danach in der Lage wäre, das zu tun, was ich zu tun hatte.
Es hat immer Menschen in meinem Leben gegeben, die Mentoring auf dieser Ebene betrieben und mich auf diese Weise gefordert und gefördert haben. Ich betrachte das als absoluten Glücksfall.
England wird immer einen besonderen Platz in ihrem Leben einnehmen. Später wird sie sogar in London ein Büro haben und regelmässig hin- und herfliegen, und noch heute ist ein Wochenende in London eine Rückkehr in eine ihr vertraute Umgebung, auch wenn der Reisegrund ein Besuch in der Tate Modern ist, die damals noch eine Industrieanlage am Ufer der Themse war. Vorerst aber ist es die Gastfreundlichkeit der Engländer, die sie beeindruckt. Kommunikation ist auch hier wieder der bestimmende Faktor: Wenn sie eine Kirche anschaut, kommt innerhalb von fünf Minuten der Sakristan oder eine Kirchenbesucherin auf sie zu und beginnt ein Gespräch mit ihr. Sie kann sehr gut fragen, und die Menschen sind nur zu bereit, ihre Fragen zu beantworten. Die Engländer, so findet sie, geben einem nie das Gefühl, fremd zu sein. So wird sie später auch Irland erleben und Neuseeland. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir es hier mit Insulanern zu tun haben; Inselbewohner freuen sich, wenn sie Besuch bekommen, und das drückt sich eben in ihrer Kommunikation aus.
Nicht nur; manchmal geht es auch noch weiter. In Sidmouth, einem beliebten Badeort an der Südküste Englands, möchte sie mit einer Freundin in dem Hotel absteigen, das sogar schon Queen Victoria beehrt hat. Der junge Mann am Empfang ist wirklich betrübt, als er ihr sagen muss, dass das Hotel ausgebucht ist. Schade, meinen beide Seiten. Vielleicht kann er ihnen etwas anderes im Ort empfehlen? «Do you have a little time?», fragt er.
Zeit hat man genug und ein Auto auch. Der junge Mann macht ein paar Anrufe und kommt mit einem unwiderstehlichen Angebot zurück: Er ist der Sohn der Besitzerfamilie und bietet den beiden Damen das Gästezimmer seiner Eltern in deren Haus, ein wenig ausserhalb von Sidmouth, an! Wer könnte da widerstehen? Rosmarie Michel bittet ihn noch, im Hotelrestaurant einen Tisch für die Mahlzeiten zu reservieren, denn das Gästezimmer seiner Eltern ist natürlich ein «Garni»-Angebot. Am Ende ihres Aufenthalts bekommt sie die Rechnung – und mit der Rechnung eine Überraschung: Lediglich die Mahlzeiten stehen darauf; die Übernachtungen waren gratis. Als ob das nicht schon etwas wäre, woran man sich ein Leben lang erinnerte, bekommt die junge Schweizerin noch ein Geschenk: einen echt englischen door knocker, den sie heute noch hat.
In London selbst lebt eine befreundete Familie, bei der sie sich sehr wohlfühlt. Da gibt es eine gemeinsame Basis: Diese Familie hatte in London eine Kinderschwester, und das war Anna, die dann zuerst für den Sohn Hansjürg von den Michels übernommen wurde und danach seiner kleinen Schwester zugeordnet wurde – eine Beziehung, die ja bekanntlich zwei Jahrzehnte lang gehalten hat. Als die kleine Schwester in London ist, ist ihr englisches Pendant natürlich auch schon eine junge Frau; es ist eine Beziehung, die bis zum Tode der Freundin Anfang der 90er-Jahre andauern wird:
Es war eine Freundschaft, die keine Worte brauchte. Später, wenn ich jeweils an einem Freitagabend nach London flog, um am Wochenende dort zu arbeiten, bin ich immer zuerst vom Flughafen zum Haus meiner Freunde gefahren, wo mich Käse und Wein erwarteten. In intensiven Gesprächen haben wir dann einander auf den neuesten Stand der Dinge in unseren Leben gebracht.
Die Schweizer Freundin wird Patin der jüngsten Tochter, und die fast jährlichen Besuche des Patenkindes in der Schweiz oder die gelegentlichen Begegnungen in London haben die freundschaftliche Beziehung zwischen den Familien bis heute erhalten.
Wer Rosmarie Michel kennt, weiss um ihre Liebe zu Schokolade und anderen süssen Genüssen. Im Hause ihrer Freunde macht sie Bekanntschaft mit aussergewöhnlich guten «Florentinern». Das Gebäck – «ein echtes Wunder» – wird von Freunden der Freunde hergestellt, einem aus Ungarn geflüchteten Ehepaar, das es, aufgrund der vorzüglichen Qualität seiner Produkte, mit seinem Catering Business zu dem begehrten «By Appointment of the Queen» auf dem Firmenschild gebracht hat: Maria und Frederic Floris.
Das interessiert natürlich die Tochter einer Confiserie-Inhaberin, und Maria Floris denkt an ihre beiden Söhne im heiratsfähigen Alter, als man ihr von der Schweizer Freundin erzählt, die jetzt in London lebt. Sie sind eine eher unenglische Familie, die Floris mit dem florierenden Geschäft: Elegant, feingliedrig, dunkelhaarig und dunkeläugig sind sie mit gutem Aussehen und östlichem Temperament ausgestattet, und Maria Floris bringt der jungen Schweizerin, die sie zu sich einlädt, spontan grosse Sympathie entgegen. Hier ist wieder mal jemand, mit dem sie über ihr Geschäft und über alles, was mit Schokolade zu tun hat – ihr Mann ist der hervorragende Chocolatier, sie ist Managerin der Bäckerei und Cateringfirma, ein begnadetes Marketingtalent und ganz einfach die Seele des Geschäfts – fachsimpeln kann. Rosmarie Michel hat vor dieser Einladung fast 24 Stunden lang aufs Essen verzichtet und schwelgt nun in den Kostproben der diversen süssen Produkte. Als sie geht, erhält sie noch ein Paket mit Süssigkeiten, die für eine ganze Woche reichen.
Maria Floris ist wirklich eine begnadete Verkäuferin, denn im Hintergrund ist da natürlich immer auch der Gedanke an die noch unverheirateten Söhne. Eine neue potenzielle Schwiegermutter also? Ja. Warum auch nicht? Es wäre doch ideal: diese Schweizerin aus demselben Berufsstand, hübsch, tüchtig, wohlerzogen, im richtigen Alter und nicht unbemittelt ... Und dann die Schweiz als eventueller Fluchtpunkt, falls noch einmal «etwas passieren» sollte. Als sich die junge Frau artig für den Abend und das «Mitnehmsel» bedankt, geht Maria Floris zur Offensive über: George, ihr Ältester, soll Rosmarie, ihre neue Freundin, zum Abendessen einladen. Ins Ritz natürlich. Alles andere wird sich dann schon ergeben.
Damit sich etwas ergibt, müssten die Voraussetzungen allerdings ganz und gar anders sein. George ist gross, dunkelhaarig und -äugig, aber «etwas linkisch», wie seine Rendezvous-Partnerin sofort erkennt. Er ist vom Business seiner Mutter so weit entfernt wie die Erde vom Mars: Er träumt nämlich davon, Schriftsteller zu werden und in Entwicklungsländern Gutes zu tun. Schwärmerisch erzählt er der weltgewandten jungen Frau von Projekten in Indien oder Marokko; dazu trinkt er Milch, sie Wein.
Letzteres hätte alleine schon einer Verbindung im Wege gestanden, aber Maria Floris wäre nicht Maria Floris, wenn sie sich von solchen Lappalien abschrecken liesse. So schnell gibt sie nicht auf. Nachdem Rosmarie Michel wieder in Zürich ist, wird George dorthin spediert. Er ist ein absoluter Fan der Schweizerin geworden, weil sie viel von der Energie seiner Mutter hat. Aber auch das richtige Timing gehört offenbar nicht zu seinen Talenten: Im kahlen Korridor ihres Elternhauses macht er ihr einen Heiratsantrag, den ich natürlich abgelehnt habe.
Was mag der arme Junge ausgestanden haben, als er unverrichteter Dinge wieder in London ankommt?! Die Verheiratung des Ältesten wird nun zur Chef(innen) sache erklärt – Maria Floris kümmert sich selbst um die Zukunft ihres Sohnes, und sie tut das mit einem Auftritt, wie ihn ein Hollywood-Regisseur nicht besser hätte inszenieren können.
Eines schönen Tages hält vor unserem Haus ein Bentley, eine Frau mit viel Schmuck und einem wunderschönen grossen Hut steigt aus: Maria Floris. Sie wollte selbst mal sehen, wo und wie ich wohne. Die ganze Familie wird zum Diner ins Hotel Baur au Lac eingeladen, und danach fährt man noch nach Hause, um den Digestif zu nehmen. Auf dem Weg nach draussen, auch wieder im Korridor, stoppt Maria, öffnet ihre Riesentasche, greift zweimal mit ihren langen, eleganten Fingern hinein und breitet auf einem Tischchen einen Juwelenhaufen vor mir aus: «You may have the whole lot, if you take George!», 4 sagt sie beschwörend.
Sie hatte mich zwar überrascht, aber nicht überrumpelt. Ich habe den ganzen lot voller Wut wieder in ihre Tasche geschmissen und gesagt: «Not even for that!» Damit war das Kapitel «George» zwischen uns erledigt. Allerdings war ich im Nachhinein beeindruckt, wie sie den Mut gehabt hatte, mit einer Handtasche voller uneingepackter Juwelen durch den Zoll zu gehen ...
Was ich ihr hoch angerechnet habe, ist, dass sie mir trotz dieses dramatischen Zwischenfalls die Freundschaft nicht gekündigt hat. Sie brauchte eine Gesprächspartnerin, hat immer wieder telegrafiert, sie käme innerhalb der nächsten 48 Stunden – das hiess, dass ich dann eine Suite und andere Dinge bestellen und mich zwei Tage freihalten musste, damit ich die ganzen Geschäftsgeschichten und -probleme abhören und mit ihr aufarbeiten konnte.
Ich liebe London und bin dorthin gereist, wann immer ich konnte. Es war selbstverständlich, dass Maria jeweils davon wusste und ich sie am nächsten Tag anrief und dann besuchte. Eines Tages rief sie kurz nach meiner Ankunft am Abend im Hotel an und bat mich, noch am selben Abend zu ihr zu kommen, statt erst am nächsten Tag. Ich fuhr also hin, und es war wie immer: Wir hatten unser gutes Gespräch.
Am nächsten Morgen war sie tot. Typisch Maria: Kein Wort über Krankheiten oder Todesahnungen, obwohl sie ja offensichtlich gespürt hatte, dass ihr Leben zu Ende ging. Präsent und elegant wie immer, hatte sie in aller Stille Abschied genommen. Es war für mich ein bedeutender Verlust.
Ein Jahr hätte der Aufenthalt im Dorchester dauern sollen, nach sechs Monaten ist er vorbei: Fritz Michel hat eine Lungenembolie erlitten, ist danach nicht mehr voll einsatzfähig im Geschäft, und Rosmarie Michel möchte ihre Mutter mit dieser Belastung nicht alleine lassen. Die junge Frau, die nach nur einem halben Jahr nach Hause zurückkehrt, ist nicht mehr dieselbe, die Zürich verlassen hat, sondern eine gereifte junge Erwachsene, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Und dazu wird sie viel Gelegenheit haben – nicht nur im elterlichen Geschäft.